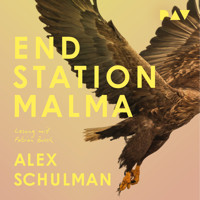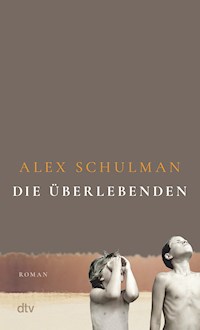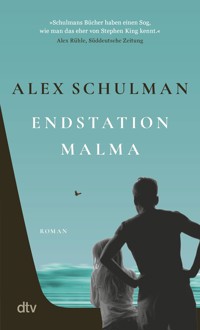
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Macht der Erinnerung und das, was wir Familie nennen Ein Zug, drei Menschen und ihre miteinander verwobenen Schicksale: Nach ›Die Überlebenden‹ und ›Verbrenn all meine Briefe‹ erzählt Alex Schulman hier erneut mit großer emotionaler Wucht. Ein Zug fährt durch eine Sommerlandschaft. An Bord sind ein Ehepaar in der Krise, ein Vater mit seiner kleinen Tochter sowie eine Frau, die das Rätsel ihres Lebens lösen will. Sie alle fahren nach Malma, einen kleinen Ort, wenige Stunden von Stockholm entfernt, umgeben von Wäldern. Und keiner von ihnen weiß, wie ihre Schicksale verwoben sind und ob das, was sie in Malma erwartet, ihrem Leben nicht eine neue Wendung geben wird. In bestechender Prosa baut Alex Schulman seine Erzählung auf: wie einen Zug, der durch die Zeit fährt und in dem jedes Kapitel ein eigener Waggon ist, der an den nächsten angehängt wird. Lässt sich die Zukunft frei gestalten, oder ist sie durch Vergangenes vorgezeichnet? »Ein tief bewegender Roman, der zu Herzen geht. Ein großes Leseerlebnis.« Aftonbladet »Mit ›Endstation Malma‹ bestätigt Alex Schulman, dass er einer der größten Erzähler unserer Zeit ist.« Ölandsbladet Ebenfalls von Alex Schulman bei dtv erschienen sind: ›Die Überlebenden‹ ›Verbrenn all meine Briefe‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ein Zug, drei Menschen und ihre miteinander verwobenen Schicksale. In bestechender Prosa baut Alex Schulman seine Erzählung auf: wie einen Zug, der durch die Zeit fährt und in dem jedes Kapitel ein eigener Waggon ist, der an den nächsten angehängt wird. Ist es möglich, die Zukunft freier zu gestalten, oder ist sie bereits durch Vergangenes vorgezeichnet?
Von Alex Schulman ist bei dtv außerdem lieferbar:
Die Überlebenden
Verbrenn all meine Briefe
Alex Schulman
Endstation Malma
Roman
Aus dem Schwedischen von Hanna Granz
Für Amanda
Oh no, love, you’re not alone
You’re watching yourself, but you’re too unfair
You got your head all tangled up
But if I could only make you care
Oh no, love, you’re not alone
David Bowie, Rock ’n’ Roll Suicide
Kapitel 1Harriet
Sie steht im Schatten ihres Vaters auf dem Bahnsteig und beobachtet, wie er in die noch tief stehende Morgensonne blinzelt. Sie warten. Harriet sucht nach Anzeichen von Verärgerung in seinem Blick oder in seinen Bewegungen. Heute achtet sie besonders darauf, denn dass sie diese Reise unternehmen, liegt an ihr, sie fühlt sich deshalb in seiner Schuld. Nur ihretwegen steht Papa jetzt dort, sie trägt die Verantwortung dafür, dass es so warm ist, für das frühe Aufstehen, für die Verspätung des Zugs, für alles, was er von jetzt an ertragen muss, und er schweigt, und sie kann ihn nicht deuten.
Harriet spürt die Hitze des Asphalts durch die Schuhsohlen hindurch. Sie ist vollkommen schwarz gekleidet, denn das gehört sich bei einer Beerdigung so. Über ihrer Schulter hängt Papas Kameratasche, sie stellt sie nicht ab. Nicht einmal, als klar ist, dass der Zug Verspätung hat und sie wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten müssen. In der Tasche befinden sich Objektive im Wert von Tausenden von Kronen. Harriet weiß, dass diese Ausrüstung Papa viel bedeutet. Sie weiß auch, dass es ihre Zukunft ist, die sie über der Schulter trägt, denn eines Tages wird sie das alles erben, und jedes Mal, wenn er ihr das sagt, hat sie das Gefühl, als senke sich ein Gewicht auf sie herab. Einmal pro Woche ist Kameraputztag, da reinigt Papa alle Teile und möchte, dass sie dabei ist. Dann sitzen sie im orangen Schein der Küchenlampe, und er reiht die Objektive auf dem Küchentisch auf, und manchmal reicht er ihr eins, damit sie es anfassen kann. »Guck dir diesen Kerl an«, sagt er dann. Und sie wiegt es in der Hand, es ist schwer und massiv, will zum Boden. »Und jetzt den hier«, sagt er und reicht ihr ein weiteres. »Guck dir nur mal diesen Kerl an.« Papa bezeichnet ganz unterschiedliche Dinge als Kerl. Vor allem Dinge, die er gekauft hat und um die er sich kümmert, aber auch anderes. Zum Beispiel, wenn sie im Auto unterwegs sind. Manchmal hält er dann plötzlich an, weil er ein Reh entdeckt hat, und dann zeigt er darauf und sagt: »Guck dir diesen Kerl an.« Ein umgestürzter Baum im Wald kann ebenfalls ein Kerl sein, zumindest, wenn es ein großer ist. Doch vor allem verwendet er den Begriff für Dinge, die man besitzt, nicht nur solche, die ihm gehören. Er ist sehr großzügig mit Lob, auch für die Dinge anderer Leute. Manchmal pfeift er durch die Zähne, wenn vor ihnen ein Porsche fährt. »Guck dir mal diesen Kerl an!« Ein netter Charakterzug, in solchen Momenten mag sie Papa sehr.
Vielleicht will er sich ja setzen? Sie blickt sich um, alle Bänke sind bereits belegt, die Leute sehen albern aus mit ihren gereckten Hälsen, wie sie Ausschau nach einem Zug halten, der nicht kommt. Ein Schaffner eilt über den Bahnsteig, jemand fragt ihn, was los sei, und da zeigt er nur auf den Bahndamm, als liege die Antwort irgendwo da draußen und er sei unterwegs, um sie zu finden. Dann plötzlich Hektik, über Lautsprecher wird die Ankunft des Zugs vermeldet, alle haben es furchtbar eilig, als wüssten sie genau, dass der Zug hier nur ganz kurz halten wird. Papa aber hat die Ruhe weg. Das hat er immer. Er hat so eine Art, sich zu bewegen, als würde er alles halb so schnell tun wie andere. Nichts geschieht im Handumdrehen, nichts wird aus einem Impuls heraus getan, Harriet hat das Gefühl, dass alles von Beginn an geplant ist. Manchmal stellt sie sich vor, dass er bereits morgens festlegt, was er im Laufe des Tages tun wird und wann, vom Frühstück bis zum Abend, und dass er dann alles nacheinander erledigt, genau wie er es sich vorgenommen hat. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er nie Gefühle zeigt; ihn kann nichts überraschen, er ist nie um eine Antwort verlegen. Jetzt sieht er zu, wie die Leute zu ihren Waggons rennen, und lässt sie gewähren, erst ganz am Ende setzt er sich langsam in Bewegung, und Harriet folgt ihm.
Im Waggon ist es genauso heiß wie draußen, Harriet geht an den Leuten vorbei und sieht, wie unzufrieden sie mit sich selbst sind. Sie setzt sich Papa gegenüber auf einen Fensterplatz. Mit einer Geste bedeutet er ihr, dass er die Kameratasche haben will, und sie reicht sie ihm. Dann schaut sie auf den inzwischen fast menschenleeren Bahnsteig. Die Geräusche um sie herum kriechen näher, das Rascheln vom Aufschlagen der Zeitungen, das Zischen einer Dose mit einem kohlensäurehaltigen Getränk, Gespräche nehmen Gestalt an, Bruchstücke von Konversationen. Wenn Harriet erst einmal angefangen hat zuzuhören, kann sie sie nicht mehr ausblenden, die Gespräche klingen wie leises Summen und bilden Melodien, Geschichten aus dem Leben der Mitreisenden. Die meisten klingen traurig und wie von einem unerklärlichen Gewicht niedergedrückt. Und sie selbst fürchtet die ganze Zeit, ertappt und von einem von ihnen zur Rede gestellt zu werden – wieso sitzt du da und lauschst?
Sie soll nicht lauschen.
Harriet erinnert sich an jenen Abend im Frühling letzten Jahres, als sie und ihre Schwester schlafen sollten. Das Kinderzimmer liegt Wand an Wand mit der Küche, und dort saßen Mama und Papa. Sie hörte jedes Wort klar und deutlich. Es war beinahe unheimlich – konnte es sein, dass die Wand die Geräusche sogar noch verstärkte? Wahrscheinlich war es so, denn es kam ihr vor, als säße sie bei ihnen drinnen, und sie hörte das Seufzen, das Stühlescharren, das leise Brummen des Kühlschranks, das verstummte, als Papa ihn öffnete. Er blieb ein bisschen zu lange davor stehen und schaute hinein. Mama mochte es nicht, wenn man vor dem offenen Kühlschrank stand, sie hatte etwas gegen diese Unschlüssigkeit – »Mach was!« –, und außerdem sorgte sie sich wegen der Kosten; sie glaubte, die offene Kühlschranktür sei der Grund für die hohen Stromrechnungen. Deshalb konnte es passieren, dass sie plötzlich losschrie: »Steh nicht lange rum, mach die Tür zu!« An diesem Abend jedoch durfte Papa so lange vor dem Kühlschrank stehen, wie er wollte, und die Möglichkeiten betrachten, die sich ihm boten, ohne dass Mama etwas sagte.
Das machte Harriet stutzig, irgendetwas war anders als sonst. Rascheln von Papier, Papa nahm wahrscheinlich den Schinken heraus, legte etwas auf die Spüle, das etwas schwerer war – die Butter? Er öffnete das Gefrierfach für die Eiswürfel. Papa trank Milch mit Eiswürfeln, das tat er gern. Klirren und Klappern aus der Besteckschublade, als durchwühle jemand einen Goldschatz. Sie hörte, wie Mama die Kerzen auf dem Tisch anzündete und wie Teller aufgedeckt wurden, es war still und dauerte lange, und Harriet lag im Bett und lauschte auf die Unheil verkündenden Geräusche, als ihre Eltern sich einander gegenüber ans Fenster setzten.
»Wie wollen wir es denn jetzt machen?«, fragte Mama.
Papa antwortete nicht. Was geschah da drüben?
»Möchtest du?«, fragte Papa.
»Danke.«
Diese Freundlichkeit zwischen ihnen. Ihre sanften Stimmen, die das Kauen unterbrachen. Diese Rücksichtnahme, dieses beinahe übertriebene Wohlwollen. Möchtest du etwas trinken? Ich hole es dir. Sie schienen sich so einig zu sein wie schon lange nicht mehr.
»Ich nehme an, du ziehst zu ihm hoch«, sagte Papa.
»Ja«, antwortete Mama. »Er hat ein großes Haus, da ist auch Platz für Kinder.«
»Du nimmst aber nicht beide.«
»Nein«, sagte Mama. »Ich schlage vor, dass ich Amelia nehme und du Harriet.«
Papa lachte kurz auf.
»Ich wollte vorschlagen, dass wir es umgekehrt machen.«
»Du willst Amelia?«, fragte Mama.
»Ja.«
Schweigend aßen sie weiter. Ein Glas wurde gefüllt.
»Amelia und ich stehen uns sehr nahe«, sagte Mama. »Und uns verbindet das Reiten.«
»Mir geht es genauso.«
»Aber du reitest doch gar nicht?«
»Nein, aber Amelia und ich stehen uns nahe.«
»Warum willst du nicht Harriet?«, fragte Mama.
»Warum willst du sie nicht?«
»Ich habe dich zuerst gefragt«, sagte Mama.
Harriet lag im Bett und schaute zur Decke.
»Das weißt du genauso gut wie ich«, sagte Papa. Er trank seine Milch aus. »Ich finde es schwierig mit ihr. Wir haben nicht dieselbe Wellenlänge.«
Harriets Bett war schmal und hatte einen hohen Rand, wie ein Sarg ohne Deckel, und draußen hatte es aufgehört zu regnen, das Unwetter war abgezogen, kein Wind zerrte mehr an den Baumkronen im Park. Nichts war zu hören, außer ihren Eltern, die in der Küche saßen und leise miteinander redeten.
Sie hatten nicht dieselbe Wellenlänge.
Später fand Harriet diese Formulierung immer so diffus, so schwer zu fassen. Was sollte sie tun, um sich zu bessern? Sie wollte gerne dieselbe Wellenlänge haben wie er, wusste aber nicht, wie sie es anstellen sollte.
Sie drehte sich zum Bett ihrer Schwester um.
»Amelia«, flüsterte sie. »Hast du das gehört?«
Ihre Schwester antwortete nicht, aber im Halbdunkel konnte Harriet erkennen, dass sie hellwach war, sie lag auf dem Rücken, den Blick zur Decke gerichtet.
»Amelia.«
»Die reden nur dummes Zeug«, flüsterte ihre Schwester. »Hör gar nicht hin.«
Ihre Eltern sprachen an diesem Abend nicht weiter über das Thema, ihre Diskussion ging vermutlich woanders weiter, und ein paar Tage später wurden die Schwestern nachmittags einzeln in die Küche gerufen. Mama öffnete eine Coladose und reichte sie Harriet, obwohl nicht Samstag war. Die Cola war warm, und die Bläschen wuchsen beim Schlucken in der Kehle. Mama und Papa lächelten seltsam. Sie würden sich scheiden lassen, sagte Mama, und da sie so weit voneinander entfernt leben würden, sei es am besten, die Kinder aufzuteilen. Harriet werde bei Papa wohnen und Amelia bei Mama. Harriet wartete, ob Papa etwas dazu sagen wollte, doch der schwieg. Sie blickte verstohlen zu ihm auf und sah sein ausdrucksloses Gesicht, und er tat ihr leid, weil er nicht bekommen hatte, was er wollte.
Sie sitzen einander gegenüber am Fenster, und Papa schaut über sie hinweg, zu den Türen. Sie weiß, worauf er wartet, und ist bereit, sie haben es genau durchgesprochen – wenn er ihr das Zeichen gibt, muss es schnell gehen. Er öffnet die Kameratasche auf seinem Schoß. Den Blick hält er weiter auf die Tür gerichtet, er braucht nicht hinunterzuschauen, er kennt seine Kameratasche in- und auswendig. Die Brille lässt seine Augen kleiner erscheinen, zwei schwarze Punkte hinter Glas. Man sieht ihm nie an, was er denkt.
Harriet schaut wieder aus dem Fenster. Sie fahren über Brücken, hoch über dem Wasser, der Zug ist schnell, die Blumen entlang der Gleise bilden einen blauen Tempo-Streifen. Jetzt haben sie die Großstadt hinter sich gelassen und kommen zunächst an Vororten vorbei, dann an Gehöften und grünen Feldern, und da Harriet rückwärtsfährt, sieht sie die Menschen draußen schrumpfen, wenn sie zurückbleiben, und ihre Leben werden zu kleinen Punkten, die in den Feldern aufgehen. Dann wird der Zug langsamer – und bleibt stehen. Aus dem Lautsprecher eine Durchsage, der Streckenabschnitt vor ihnen sei eingleisig, sie müssten auf einen entgegenkommenden Zug warten. Sie stehen inmitten einer Wiese, die Blumen reichen den Leuten bis zum Kinn. Wenn der Sommer noch ein paar Zentimeter ansteigt, ertrinken sie. Etwas weiter entfernt entdeckt Harriet zwei Vögel auf einem Feld, die mit langen, dünnen Beinen umherstaksen und über das Tal blicken, und Harriet muss daran denken, wie Papa ihr einmal ein Eichhörnchen gezeigt hat, das in einem Baum saß. »Guck dir diesen Kerl an.« Das Tier war mitten in seiner Tätigkeit erstarrt und schaute in den Wald. Wie paralysiert, in einem Gedanken gefangen. »Er sitzt da und erinnert sich«, hatte Papa gesagt, und diese Vorstellung war ihr so unangenehm und unerträglich vorgekommen. Denn sie machte die Traurigkeit in der Welt noch größer, auf einmal gab es die Schwermut nicht mehr nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren, und sie musste auch noch für sie die Verantwortung übernehmen. Und als sie jetzt die beiden Vögel auf dem Feld erblickt, denkt sie, dass sie sich an etwas aus ihrer Kindheit erinnern, und das macht sie einfach nur traurig.
Vor ein paar Monaten, als es im Unterricht um das Gehirn ging, sollten sie als Hausaufgabe eine Erinnerung aufschreiben, so ausführlich wie möglich. Abends erzählte sie Papa davon, der sich sofort interessiert zeigte.
»Über welche Erinnerung willst du schreiben?«
»Keine Ahnung, irgendwas aus meiner Kindheit.«
Da lachte Papa und sagte: »Du bist acht. Du bist ein Kind.«
Später saß sie mit dem Schreibheft in ihrem Zimmer und schrieb über das Kruzifix, das bei Papa an der Wand hing. Früher hing es über seinem Schreibtisch, aber nach der Scheidung hat er es über seinem Kopfkissen an der Schlafzimmerwand befestigt. Sie hat gesehen, wie er sich neben das Bett kniet, die Hände faltet und betet. Wenn er nicht da ist, geht sie manchmal ins Zimmer und betrachtet das Kreuz. Den Jesus aus dunklem Metall auf schwarz bemaltem Holz, das Tuch um die Hüfte, wie eine Windel. Die dicken Pflöcke, die durch seine Hände gehen, und der eine Nagel, der durch beide Füße getrieben wurde, die Knie übereinander, was ihn irgendwie weiblich macht. Mit festem Blick betrachtet Gottes Sohn die Tagesdecke, und wenn sie sich direkt vor das Kreuz stellt und ihn anschaut, kommt es ihr vor, als erwidere er ihren Blick. Papa hat erzählt, dass es manchmal Tage dauerte, bis ein Gekreuzigter starb, bisweilen sogar eine ganze Woche, und wenn er starb, dann häufig nicht wegen der Wunden, sondern an Hunger oder Austrocknung. Darüber schrieb Harriet, und dann gab sie noch eine Erinnerung wieder, die ein Jahr alt war, von einem Vorfall kurz nach der Trennung ihrer Eltern.
Sie war bei ihrer Großmutter väterlicherseits zu Besuch gewesen. Oma hatte ein Ekzem an den Händen, und um das Jucken zu lindern, benutzte sie Kartoffelstärke, sie hatte immer ein Stoffsäckchen voll dabei, und Harriet erinnert sich, wie es staubte und die kleinen Körnchen herumwirbelten, wenn die Sonne durch die großen Fensterscheiben hereinfiel. Manchmal zog Oma sich durchsichtige Gummihandschuhe an und ließ die Kartoffelstärke über die Handgelenke hineinrieseln, füllte nach, wenn es wieder zu jucken begann, und am Ende solcher Tage waren die dünnen Handschuhe voll und schwer von dem weißen Pulver.
Oma fürchtete sich vor dem Sterben, sie dachte oft darüber nach und saß dann schweigend und abwesend am Küchentisch. Und manchmal, wenn ihre Angst vor dem Tod überhandnahm, ging sie ans Klavier und haute in die Tasten, dass man das Gefühl hatte, die Welt stürze ein. Anschließend blieb sie noch eine Weile sitzen und rang die Hände, dass die Gummihandschuhe quietschten.
Nur Alkohol konnte sie aus den Klauen der Angst befreien. Sie trank Rotwein aus dem Kühlschrank, und nach ein paar Gläsern wurde sie leutselig und begann, Fragen zu stellen. An jenem Abend erzählte Harriet ihr, wie ein anderes Kind im Kindergarten mal bei ihr Brennnessel gemacht hatte, und Oma fragte, was das sei, und Harriet erklärte, dass man dabei dem anderen die Haut am Unterarm in entgegengesetzte Richtungen dreht, als würde man einen Spüllappen auswringen, und Oma lachte. »Zeig mal«, sagte sie und krempelte ihre Seidenbluse hoch.
Und Harriet drehte an ihrem dünnen Arm, und es begann sofort zu bluten, und Oma schrie, und das Blut lief ihr den Arm hinunter, und sie suchte im Schrank nach dem Erste-Hilfe-Set, fand es aber nirgends. Schränke, die geöffnet und geschlossen wurden, dazu Omas Gejammer.
»Mein Gott, hilf mir doch beim Suchen«, sagte sie, doch Harriet konnte nicht. Wie erstarrt stand sie mitten in der Küche, das Blut ihrer Großmutter an den Händen. Papa musste sie früher abholen kommen, und als sie abends an seinem Zimmer vorbeikam und das Kreuz überm Bett hängen sah, kam es ihr vor, als blicke Jesus sie auf neue Weise an.
Sie gab die Hausaufgabe ab, und dann dachte sie nicht weiter daran, doch eines Nachmittags, als sie von der Schule kam, saß Papa an ihrem Schreibtisch und las in ihrem Heft.
»Hast du das so abgegeben?«, fragte er.
»Ja.«
Er las weiter, während sie schweigend danebenstand, dann schlug er das Heft zu und blickte zu Boden.
»Du hast ein richtig gutes Gedächtnis«, sagte er.
»Ja.«
»Aber weißt du was? Was hier bei uns zu Hause passiert, das bleibt unter uns.«
»Okay.«
»Ich möchte nicht, dass die Leute wissen, was ich an den Wänden hängen habe, ob ich bete und ob ich verheiratet bin oder geschieden. Es ist respektlos von dir, über so etwas zu schreiben. Verstehst du das?«
Sie nickte. Eine Weile blieb er noch mit leerem Blick sitzen. Dann ging er raus. Harriet nahm ihr Schreibheft und stopfte es schnell in eine Schublade.
Noch immer warten sie mitten in der Wiese auf den entgegenkommenden Zug. Durch das Blechdach heizt sich das Wageninnere immer weiter auf, je länger sie in der Sonne stehen. Harriet sieht die beiden Vögel, die sich erinnern, und plötzlich hört sie das vertraute Klicken des Auslösers. Sie dreht den Kopf zu Papa, sieht jedoch sein Gesicht nicht, weil die Kamera im Weg ist. Noch immer ist das Objektiv auf sie gerichtet, vielleicht will er noch ein Foto von ihr machen. Sie mag es, wenn er sie fotografiert, es fühlt sich gut an. Harriet lächelt ihn an, zeigt dabei die Zähne und macht mit einer Hand das Victory-Zeichen.
»Nein«, sagt Papa und senkt die Kamera. »Wieso machst du dich so zum Affen?«
Er legt die Kamera auf den Tisch zwischen ihnen und schaut weg. Harriet wünscht sich, dass er ihr noch eine Chance gibt, doch jetzt ist es zu spät. Wieder wird sie traurig. Die Gefühle kriechen unter ihre Lider, ihr Herz klopft nervös, und sie starrt auf die Tischplatte. Jetzt bloß nicht weinen, das mag Papa nicht. Da knipst Papa ein weiteres Foto von ihr.
Er hantiert umständlich mit der Kamera, stellt die Blende ein. Sie schaut erneut aus dem Fenster. Einer der Vögel fliegt tief über dem hohen Gras davon, der andere bleibt stehen und schaut. Nach einer Weile flattert er ebenfalls fort.
»Jetzt!«, zischt Papa ihr zu.
Und dann geht es ganz schnell. Er steht auf und sie ebenfalls, sie treten auf den Mittelgang, und Harriet erkennt im nächsten Waggon bereits die Umrisse des Schaffners, der langsam näher kommt. Rasch schlüpfen sie in die Toilette und ziehen die Tür hinter sich zu. Papa schließt ab, aber Harriet öffnet die Verriegelung wieder.
»Was machst du da?«, flüstert er mit großen besorgten Augen.
»Wenn er sieht, dass jemand drin ist, wartet er vielleicht, bis derjenige wieder rauskommt«, antwortet sie.
Papa überlegt kurz, dann nickt er. Mit gesenktem Kopf bleibt er direkt hinter der Tür stehen. Lauscht den Schritten des Schaffners, der draußen vorbeigeht.
»Noch zugestiegene Fahrgäste?«, sagt die Stimme auf der anderen Seite. »In Stockholm zugestiegene Fahrgäste?«
Sie warten noch eine Weile, dann öffnet Papa vorsichtig die Tür und schaut hinaus. Rasch verlassen sie die Toilette, setzen sich wieder auf ihre Plätze und verschmelzen mit den zahlenden Passagieren. Er nickt ihr kurz zu, und sie nickt zurück. Ihr Herz klopft, und ihr ist schlecht, sie möchte sich übergeben, weil sie etwas tun, was man nicht darf, noch stärker aber breitet sich ein anderes Gefühl in ihr aus, eine Wärme, ein kleines Feuer in ihrem Brustkorb, als sie ihn ansieht und er sie ansieht und sie sich anlächeln.
Sie haben dieselbe Wellenlänge.
Kapitel 2Oskar
Auf dem Bahnsteig ist es heiß, alle sind gereizt. Der Zug hat Verspätung, aber es gibt dazu keine Ansage. Als eine Lautsprecherstimme endlich die Einfahrt des Zuges verkündet, haben es die Reisenden plötzlich sehr eilig; alle, bis auf seine Frau. Ganz ruhig bleibt sie stehen und kramt in ihren Taschen. Oskar schaut zu, wie sie die Hände in ihre enge Jeans steckt, dann in die Jacke und wie sie anschließend ihre Handtasche durchwühlt, bis sie endlich findet, was sie gesucht hat: das Feuerzeug. Der Zug fährt ein, aber sie will anscheinend noch eine rauchen.
»Wollen wir nicht los?«, fragt Oskar.
»Ich rauche nur noch eine.«
Obwohl es windstill ist, wölbt sie die Hand um die Flamme, zieht den Rauch tief ein. Er wartet. Das Rattern der Rollkoffer in unmittelbarer Nähe, das Rauschen des morgendlichen Verkehrs auf einer Autobahn weit entfernt. Es wird wohl wieder ein heißer Tag werden. Erst halb acht morgens, es ist der 17. September, und der Sommer nimmt kein Ende. Rasch leert sich der Bahnsteig, seine Frau aber raucht, als wüsste sie, dass der Zug ohne sie nirgends hinfahren wird.
Als sie einsteigen, ist er direkt hinter ihr, er nimmt einen Hauch des Parfüms wahr, das sie gestern aufgelegt hat. Rasch geht sie durch den engen Mittelgang, und er beobachtet die Blicke der Leute, die sie zum ersten Mal sehen. Das tut er immer, selbst jetzt. Sie setzt sich auf einen Fensterplatz, schnappt sich einfach irgendeinen Sitz. Oskar bleibt im Gang stehen, schaut auf ihre Tickets.
»Das sind nicht unsere Plätze.«
»Ist doch egal, du siehst doch, dass der Zug leer ist.«
Der Zug ist gar nicht leer, und an den nächsten Bahnhöfen werden noch Leute zusteigen. Oskar sitzt nicht gern auf den Plätzen anderer Leute, da kann er sich nicht entspannen. Und wenn dann plötzlich jemand neben ihm steht und sich räuspert und auf sein Ticket zeigt und sie müssen ihre Sachen zusammenraffen und davongehen, dann fühlt er sich gedemütigt. Oskar setzt sich ihr gegenüber. Der Zug verlässt den Bahnsteig fast geräuschlos, gleitet über die Centralbron, das Meer liegt still zu beiden Seiten der Brücke. sogar die Ostsee wirkt heute einladend, das Wasser kräuselt sich nur dort ein wenig, wo die Strömung stark ist. Der Zug beschleunigt, und als sie in den Tunnel fahren, erblickt Oskar sich selbst in der Spiegelung des Fensters. Wie immer reagiert er mit Unbehagen und will den Blick rasch abwenden, aber etwas lässt ihn innehalten und sich in dem dunkelgelben Licht betrachten. Als Kind hat er mal mit Filzstift Pimmel an die Wände der Schultoilette gemalt, ein Lehrer hat ihn dabei erwischt. Er wurde zum Schulsozialarbeiter geschickt, der hinter einem großen Schreibtisch saß und ihn scharf ansah und sagte: »Jetzt will ich dir mal was Lustiges erzählen. Als ich euch Erstklässler am ersten Schultag gesehen habe, bist du mir sofort aufgefallen. Ich dachte: Mit dem wird es bestimmt mal Probleme geben. Man konnte dir ansehen, dass du unter hohem innerem Druck stehst.«
Diese Formulierung ist ihm im Gedächtnis geblieben, sein »innerer Druck«. Er sieht sein Spiegelbild, seinen ernsten Gesichtsausdruck, den breiten Mund, die Lippen, die nicht ganz schließen. Die braunen Augen, die im schwachen Licht fast schwarz wirken. Ist das ein Mann mit hohem innerem Druck? Er weiß immer noch nicht, was genau damit gemeint ist.
Ein Zugbegleiter begrüßt über Lautsprecher die Zugestiegenen. Er ist etwas zu sehr von seiner eigenen Stimme eingenommen, redet mehr als nötig, und Oskar hat sofort den Impuls, einen Blick mit seiner Frau zu wechseln, über solche Leute regen sie sich beide immer auf, aber dazu ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Außerdem hat sie bereits die Augen geschlossen. Er kennt sie und weiß, was das heißt; sie will nicht schlafen, sie hat nur keine Lust zu reden.
In letzter Zeit hat sie das fast nie. Gestern während ihres Streits, der am Vormittag begann und dann abends und in der Nacht weiterging, hat er gedacht, wie wortlos er in weiten Teilen war. Ein paar Sätze, die alles in Brand setzten, ihr Gebrüll und seins und dann die heftigen gegenseitigen Beschuldigungen, doch die meiste Zeit schwiegen sie. Als hätten sie beide eingesehen, dass es sinnlos war, das Ganze mit Worten lösen zu wollen. Am Ende hatte sie in der Küche zwei Kerzen angezündet. Völlig absurd, als wollte sie es ihnen im Untergang ein bisschen gemütlich machen. Vielleicht dachte sie, es wäre möglich, in diesem Schweigen zu leben. Ein Butterbrot zu essen, Zeitung zu lesen. Und heute, am frühen Morgen, immer noch dieses Schweigen. Sie haben die Wohnungstür hinter sich geschlossen und sind zum Hauptbahnhof gegangen, ohne zu reden, und als sie sich in den Zug gesetzt haben, sind sie in noch tieferes Schweigen verfallen, und wenn das das Ende der Geschichte ist, dann ist es ein stummes Ende. Zu Beginn ihrer Beziehung haben sie ohne Unterlass geredet. Ihr erstes Date etwa, in dieser Bar. Nach der Zugfahrt, auf der sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Diese legendäre Zugfahrt! Erzählt noch mal, wie das war! Sie haben die Geschichte so oft wiederholt, voreinander wie auch vor anderen. Einmal hat sie gesagt, sie wisse allmählich selbst nicht mehr, was daran stimme und was nicht, Oskar dagegen erinnert sich an alles.
Vor vielen Jahren saß er allein im Zug von Göteborg nach Stockholm. An einem Bahnhof hielten sie länger als gewöhnlich. Irgendwann blickten die Passagiere von ihren Zeitungen auf – was war los? Wieso fuhren sie nicht weiter? Keine Lautsprecherdurchsage. Eine Viertelstunde verging, die Leute wurden gereizter, je mehr ihre Nachmittagspläne in Gefahr gerieten. Dann wurde plötzlich die Tür aufgerissen, und sie platzte herein, ging eilig durch den Zug. Sie trug eine Lederjacke über einem langen, durchgeknöpften Kleid mit lauter kleinen weißen Knöpfen und warf sich auf den Sitz ihm gegenüber. Erst da bemerkte Oskar, dass sie eine Verletzung an der Augenbraue hatte, es blutete ein wenig. Und dann kamen die beiden Polizisten. Sie kamen aus derselben Richtung wie die Frau und hatten es nicht eilig. Sie wussten, dass sie ihnen nicht entkommen konnte. Langsam gingen sie durch den Waggon, ihre Funkgeräte rauschten, ein Pfeifen und Knistern, jetzt hatten sie die Aufmerksamkeit aller Fahrgäste geweckt. Als sie die Frau erreichten, die sich ihm gegenübergesetzt hatte, blieben sie stehen. Einer der Beamten war etwas breiter als der andere und hatte rote Flecken zwischen den Augen und auf der Stirn, es sah nach einer Entzündung aus. Er zeigte mit dem Finger auf sie.
»Sie«, sagte er, »steigen jetzt mit uns aus.«
»Nein«, erwiderte die Frau.
»Doch, und zwar sofort.«
»Wieso?«
»Das wissen Sie ganz genau.«
»Nein, weiß ich nicht. Ich muss nach Stockholm, und ich werde mit diesem Zug fahren.«
Der Polizist trat einen Schritt vor, und sofort begann sie, gellend zu schreien: »Fassen Sie mich nicht an!« Der Mann zog sich wieder zurück, und es sah beinahe aus, als wäre er beleidigt, weil es ihr gelungen war, ihn zu erschrecken.
»Soll ich Sie hier raustragen, oder was?«, fragte er.
»Ich habe es der Schaffnerin doch schon erklärt«, sagte sie. »Ich konnte am Bahnhof kein Ticket mehr kaufen. Und als ich im Zug bezahlen wollte, hat das Gerät nicht funktioniert. Ich kann bezahlen, wenn wir in Stockholm sind.«
»So läuft das aber nicht«, sagte der Polizist.
»Meine Geldkarte ist doch geladen, es ist nicht meine Schuld, wenn man hier nicht bezahlen kann.«
»Jetzt hören Sie mir mal gut zu.« Der andere Polizist trat nun ebenfalls einen Schritt vor. »Sie halten hier den gesamten Verkehr auf, nur weil Sie nicht tun, was wir sagen. Sie haben keine Fahrkarte, also steigen Sie bitte aus.«
Sie tat, als wären die beiden Männer Luft, schlug eine Zeitung auf, und Oskar sah, wie die beiden Männer sich kurz zunickten, kaum sichtbar für jemand anderen, ein Einvernehmen, das durch viele Jahre gemeinsamer Schweinereien im Streifendienst gewachsen war. Dann packten sie sie an den Armen. Ob zu fest, konnte er nicht beurteilen, aber die Frau schrie, und zwar immer lauter, während die beiden sie in den Mittelgang beförderten. Sie klammerte sich an die Kopfstütze eines Sitzes, und jetzt geschah etwas: Die Mitreisenden, die bislang schweigend zugesehen hatten, begannen zu protestieren. Aus verschiedenen Richtungen wurde gerufen.
»Was soll das denn?«
»Lassen Sie die Frau los!«
»Sie hat doch gesagt, sie bezahlt in Stockholm.«
Und die Frau selbst rief weiter, sie wolle ja bezahlen, und plötzlich schien die Situation den Polizisten über den Kopf zu wachsen, alle Mitreisenden schlugen sich auf die Seite der Frau, und sie wussten nicht mehr recht, was sie tun sollten. Einige Passagiere waren aufgestanden, um das Schauspiel besser verfolgen zu können, und da fasste Oskar einen Entschluss.
»Was kostet das Ticket?«, fragte er die Polizisten. »Wie viel muss sie zahlen?«
»Das weiß ich doch nicht«, sagte der eine von ihnen.
»Zweihundert«, mischte die Frau sich ein. »Die Fahrkarte kostet zweihundert Kronen.«
Oskar nahm sein Portemonnaie und zog zwei Einhundertkronenscheine heraus, die er den Polizisten hinhielt.
»Ich will die nicht haben«, sagte der Dicke und lachte nervös. »Ich bin doch kein Schaffner.«
Da gab Oskar ihr die Scheine.
»Okay«, sagte er und wandte sich wieder an die Polizisten. »Jetzt hat sie Geld für die Fahrkarte, jetzt können Sie gehen.«
Die Beamten wirkten konfus und überfordert, vielleicht wurde ihnen das auch zu philosophisch. Es brauchte die Hilfe der Mitreisenden, von überall klangen auffordernde Stimmen, der ganze Waggon wollte, dass sie den Zug verließen. Und das taten sie, zum Jubel aller, und die Frau presste die Handflächen aneinander und gestikulierte zu den anderen hin. »Danke«, formte sie mit den Lippen, und dann setzte sie sich wieder, beugte sich zu Oskar vor und ergriff seine Hände.
»Du kriegst das Geld, sobald wir in Stockholm sind«, sagte sie. »Wir können gleich am Bahnhof zum Automaten gehen.«
Der Zug verließ den Bahnsteig, vor dem Fenster zog der schwedische Sommer vorbei, und drinnen waren die Fahrgäste wie ausgewechselt. Sie waren nicht mehr mit sich allein, sie waren vereint. Sie waren für diese Frau aufgestanden, und sie hatten es gemeinsam getan. Alles fühlte sich leicht und weich an, ein Lächeln auf allen Gesichtern, jetzt gehörte sie ihnen, sie hatten sie sich geholt, einen Pokal für ihre Güte, der jetzt auf Platz Nummer siebenundzwanzig funkelte.
Da kam die Schaffnerin herein, die schwarze Ledertasche mit den Messingschnallen vor dem Bauch. Sie kontrollierte die Fahrscheine der Zugestiegenen, und als sie bei Oskar ankam, sprang die Frau auf, knüllte die beiden Scheine zusammen und warf sie der Schaffnerin vor die Brust.
»Da haben Sie Ihr Scheißgeld.«
Leichte Unruhe im Waggon. Denn das wäre ja nun auch nicht nötig gewesen, oder?
Die Schaffnerin bückte sich, hob die Scheine auf und glättete sie.
»Sie hatten keine Fahrkarte«, sagte sie ruhig. »Deshalb habe ich Ihnen angeboten, hier im Zug eine zu kaufen. Dazu braucht man aber Bargeld. Sie hatten kein Bargeld. Sie wollten mit Karte bezahlen, aber das geht im Zug nicht. Wir haben gar nicht die Technik dafür. Und ich habe Ihnen erklärt, wenn man keine Fahrkarte hat und kein Geld, um sich eine zu kaufen, dann muss man aussteigen. Da haben Sie mich eine Hure genannt.«
Die Schaffnerin nahm eine Fahrkarte heraus, schrieb eine Notiz auf das Stück Papier und reichte es der Frau.
»Und wissen Sie was?«, fuhr sie fort. »Ich möchte nicht als Hure bezeichnet werden.«
Dann ging sie weiter. Unsicherheit breitete sich im Waggon aus. Hatte sie die Schaffnerin tatsächlich eine Hure genannt? Wer war diese Frau, für die sie sich eingesetzt hatten? Oskar traute sich kaum, sie anzublicken, er nahm sie am Rande seines Gesichtsfelds wahr, ihr schwarzes Haar, das sie sich hinter die Ohren gestrichen hatte und das ihr immer wieder ins Gesicht fiel. Sein Vater hatte ihm mal gesagt, sobald er eine schöne Frau sehe, solle er sich vorstellen, wie sie wohl gehäutet aussähe. Dann laufe er nicht Gefahr, sich von irgendeiner Schönheit blenden zu lassen. Der Zug nahm wieder Fahrt auf, sie hatten Verspätung, und als die Abenddämmerung hereinbrach, waren sie immer noch in Mittelschweden, und Oskar sah die Stromleitungen entlang der Gleise, die abtauchten und wieder aufstiegen, Elektrozäune, die in der tief stehenden Sonne blinkten, eine knallgelbe Wiese, die auftauchte und wieder verschwand, und als es dunkel wurde, sah er wie in einer Doppelbelichtung die Frau in der Spiegelung des Fensters.
Oskar betrachtete die kleinen Dörfer und die Laternen, die vor den Häusern ansprangen, eine Weile lieferte sich der Zug auch ein Wettrennen mit einem Lkw auf einer Überlandstraße, sie preschten an Binnenseen vorbei, auf denen Plastikbojen über Reusen dümpelten, sie fuhren mitten in die Sommernacht hinein, und er konnte nicht aufhören, die Frau verstohlen in der Spiegelung zu beobachten, konnte den Blick nicht von ihr wenden.
Als sie am Hauptbahnhof ankamen, meinte sie, es gebe einen Bankautomaten in der Vasagatan, und Oskar fragte, ob sie nicht lieber was trinken gehen wollten. Im Nachhinein konnte er sich das nie richtig erklären. Sie war sehr viel jünger als er, und so etwas tat er normalerweise nie, im Gegenteil, es war ihm immer schon schwergefallen, sich Frauen zu nähern, denn er wurde gleich schüchtern und wusste nicht, was er sagen sollte. Manchmal denkt er heute noch daran, wie er damals war: Wenn er ausging, dann in enge Bars, kurz vor Thekenschluss. Er stellte sich mit einem Bier an den Tresen und ließ das Gedränge entscheiden, wohin es ihn trieb. Wieso eigentlich? Vielleicht, um physische Nähe zu spüren, denn in solchen Momenten war er von Körpern umgeben. Und wenn er eine Frau sah, die ihn interessierte, konnte er sich zu ihr treiben und sich an ihre Seite drücken lassen. So ging er rein und wieder raus aus den Bars, immer allein. Und am Ende landete er oft in einem Nachtclub, wo er sich zu den riesigen Boxen durchkämpfte und sich neben die Basslautsprecher stellte, die größer waren als er selbst, und dann ließ er sich vom Klang durchbohren. Die Musik fuhr ihm in die Knochen, es schmerzte im ganzen Skelett, und wenn er anschließend auf die Straße hinaustorkelte, hörte und spürte er nichts mehr, sah nur noch die verzerrten Gesichter der Menschen, die ihm in der Stockholmer Nacht entgegenkamen, und empfand eine diffuse Erleichterung; vielleicht war es ihm diesmal gelungen, sich selbst abzuschütteln.
Deshalb war es für ihn so unerwartet, dass er ihr vorschlug, noch etwas trinken zu gehen. Er hatte sofort gespürt, dass sie etwas Besonderes war, und je mehr die Fahrt sich dem Ende genähert hatte, desto größer war seine Angst geworden. Angst, sie könnte verschwinden und für immer fort sein. Er wollte sie. Er stellte sie sich gehäutet vor, und auch ohne Haut wollte er sie. Sie gingen durch den Hauptbahnhof und kamen auf die Vasagatan. Es war feucht draußen, nasse Straßen, ein Regenschauer musste über die Stadt hinweggezogen sein, doch es war immer noch warm. Sie betraten eine Bar, in der auf einem stumm geschalteten Fernseher Sport lief, und setzten sich an einen Fenstertisch. Er bestellte zwei Steaks, doch sie rührte ihres nicht an. Sie trank Bier und knabberte Nüsse, hamsterte fünf, sechs in der Hand und steckte sie sich nacheinander in den Mund.
Sie fragte, was er arbeite, und er sagte, er sei Makler, und da kicherte sie und sagte: »Du siehst gar nicht aus wie ein Makler.«
»Was machst du?«, fragte er daraufhin.
»Ich bin Bibliothekarin.«
Da hatte er laut losgelacht, voller Selbstvertrauen, das er eigentlich nicht hatte.
»Bibliothekarin«, sagte er. »Du siehst aber auch nicht aus wie eine Bibliothekarin.«
Sie zuckte die Achseln.
»Ich liebe Bücher.«
»Was ist der schönste Satz, den du je gelesen hast?«, fragte er.
»Manchmal …« Sie hielt inne und überlegte, bemüht, korrekt zu zitieren. »Manchmal merke ich, wie meine Knochen unter der Last all meiner ungelebten Leben ächzen.«
»Oh«, sagte er, »das klingt ganz schön traurig.«
»Ja.« Sie lachte. »Es zieht mich immer runter, wenn ich daran denke, was alles nicht passiert.«
Sie zog eine Zigarette heraus, rauchte sie halb und drückte sie dann im Aschenbecher aus, als hätte sie plötzlich keine Lust mehr und beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und dann zündete sie sich gleich eine neue an. Und wenn sie etwas Wichtiges erzählte, legte sie ihm die Hand auf den Arm, als wäre das ganz natürlich. Immerzu wollte er ihr noch näher kommen, die Tischplatte drückte ihm in den Bauch. Sie schnitt sorgfältig den Buchstaben O aus ihrem Steak aus, O wie Oskar, hob den Fleischbuchstaben mit Daumen und Zeigefinger hoch und reichte ihn ihm. Er wusste nicht, was das bedeutete.
Ums Handgelenk trug sie ein kleines Holzmedaillon, das während ihres Gesprächs immer wieder über den Tisch schleifte, und er griff danach und betrachtete es. Auf einer Seite war ihr Name eingraviert, auf der anderen Seite stand »Papa«.
»Hübsch«, sagte er.
»Ach, das.« Sie wirkte fast verlegen.
»Verstehst du dich gut mit deinem Vater?«
»Das kann man so nicht sagen. Unser Verhältnis war schon immer etwas merkwürdig. Es fällt ihm nicht leicht, Gefühle zu zeigen. Er hat mir zum Beispiel nie gesagt, dass er mich liebt.«
»Hast du ihm denn gesagt, dass du ihn liebst?«
»Einmal, als ich klein war. Und weißt du, was er da geantwortet hat? Nichts. Er hat einfach geschwiegen.«
Sie blickte auf die Tischplatte, ein trauriges Lächeln auf den Lippen.
»Was würde passieren, wenn du ihn anrufst und ihm sagst, dass du ihn liebst?«, fragte Oskar.
Sie lachte, schüttelte den Kopf und schaute aus dem Fenster. Und er, leicht angetrunken, nahm sein Handy. Er hatte gerade seinen ersten Auftrag als Makler bekommen, und gleich am ersten Arbeitstag hatten sie ihm ein eigenes Handy gegeben, niemand in seinem Bekanntenkreis hatte eins. Er legte es vor ihr auf den Tisch.
»Ruf ihn an«, sagte er. »Ruf ihn an und sag ihm, dass du ihn liebst.«
»Er wird denken, ich will ihn verarschen.«
»Ruf ihn an!«
Zum ersten Mal entdeckte er etwas anderes in ihrem Blick. Bisher war sie ihm absolut selbstsicher vorgekommen. Vom ersten Moment an und auch, als die Polizisten an ihr zerrten, hatte er den Eindruck gehabt, nichts könne ihr etwas anhaben. Jetzt aber hatte sie etwas fast Mädchenhaftes, wie sie so auf die Tischplatte starrte, und dann drehte sie sich um und versuchte, die Aufmerksamkeit des Barmanns auf sich zu ziehen, sie wollte noch etwas zu trinken bestellen.
»Du rufst ihn jetzt an!«, sagte er laut.