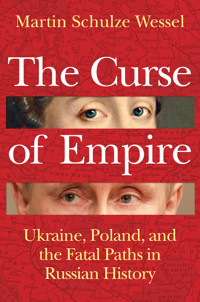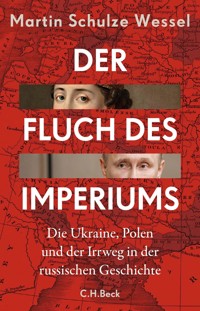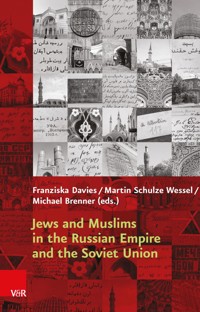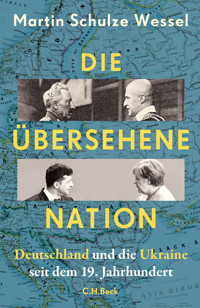
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass Deutschland wegen der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs eine historische Verantwortung gegenüber Russland besitzt, wird nur selten in Zweifel gezogen. Dass dasselbe mehr noch für die Ukraine gilt, ist dagegen sehr viel weniger im öffentlichen Bewusstsein verankert. Martin Schulze Wessel legt die erste Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen vor und ruft in Erinnerung, wie eng die deutsche und die ukrainische Geschichte im 20. Jahrhundert miteinander verflochten sind. In seinem eindrücklich geschriebenen Buch zeigt er, wie historische Erfahrungen und Wahrnehmungen bis heute fortwirken, und fragt, was das für unser heutiges Verhältnis zur Ukraine bedeutet. Im Ersten Weltkrieg verbanden sich die kolonialen Pläne der Deutschen für Osteuropa mit den Bestrebungen der ukrainischen Nationalbewegung. So wurde die Gründung eines ukrainischen Nationalstaats 1918 durch die deutsche Besatzung des Landes möglich. Auch deshalb suchte Stepan Bandera im Zweiten Weltkrieg die Allianz mit NS-Deutschland, doch Hitlers koloniales Projekt unterschied sich fundamental von dem des kaiserlichen Deutschlands. Die Ukraine wurde zum Zentrum des deutschen Vernichtungskrieges. Nach 1945 verschwand die Ukraine im deutschen Bewusstsein wieder in der Sowjetunion, und auch nach 1991 blieb sie eine vielfach übersehene Nation – mit fatalen Folgen für die deutsche Reaktion auf den russischen Angriffskrieg seit 2014. Wer sich die deutsch-ukrainische Geschichte vergegenwärtigt, wie es Martin Schulze Wessel tut, dem wird es schwerer fallen, gegenüber dem Schicksal des Landes gleichgültig zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Martin Schulze Wessel
DIE ÜBERSEHENE NATION
Deutschland und die Ukraineseit dem 19. Jahrhundert
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
Hruševskyj und Hoetzsch: Die Vorgeschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen
Koloss auf tönernen Füßen? Der neue Blick auf das Zarenreich und die Ukraine
Krieg und Staatsgründung
Skoropadskyj und die deutsche Besatzung
Das Hetmanat als koloniales Projekt?
KAPITEL 2: Die Zeit zwischen den Kriegen
Pogrome
Rapallo
Wirtschaft und Tourismus
Emigration
Ukrainischer Nationalismus
Der große Hunger
Die
OUN
und Deutschland
KAPITEL 3: Deutschland und die Ukraine im Zweiten Weltkrieg
Angriff auf die Sowjetunion
Deutscher Vormarsch in der Ukraine
Die Shoa in der Ukraine
Der Holocaust und die Ukrainer
Hilfe für Juden
Die Deutschen in der Ukraine: Raumplanung, rassische Hierarchie und Besatzungsherrschaft
Kriegsgefangene
Zwangsarbeit
Militärische Kooperation und Widerstand
KAPITEL 4: Die Jahre des Kalten Krieges
Displaced Persons
Die ukrainische Nation in der Emigration
Die
DDR
und die Fahne von Kriwoj Rog
Eduard Winters Kulturkampf
Die Kampagne gegen Theodor Oberländer
Die Ermordung Banderas
Kontakte zwischen Deutschen und Ukrainern
Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß
KAPITEL 5: Die deutsche und die ukrainische Frage nach 1989
Kohls Kalkül
Die prekäre Sicherheitslage der unabhängigen Ukraine
Das Budapester Memorandum
Die Orangene Revolution im Herbst 2004
Der
NATO
-Gipfel in Bukarest 2008
Nord Stream
KAPITEL 6: Deutschland und die Ukraine seit 2013
Der Euromajdan
Keine Zeitenwende
Zeitenwende?
Ukrainische Stimmen
Schluss
Karten
Hinweise zur Schreibweise und Dank
Anmerkungen
Einleitung
1. Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
2. Die Zeit zwischen den Kriegen
3. Deutschland und die Ukraine im Zweiten Weltkrieg
4. Die Jahre des Kalten Krieges
5. Die deutsche und die ukrainische Frage nach 1989
6. Deutschland und die Ukraine seit 2013
Schluss
Ausgewählte Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
Deutschland und die Ukraine gehören, territorial und im Hinblick auf die Bevölkerungszahl gesehen, zu den größten Ländern Europas, und ihre Hauptstädte liegen nur wenige Flugstunden voneinander entfernt. Doch bestanden zwischen ihnen lange Zeit keine intensiven und kontinuierlichen Beziehungen. Zwar kann man einzelne Kontakte weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. So fanden der Aufstieg und der Fall des frühneuzeitlichen ukrainischen Hetmanats ein erstaunlich großes Interesse in den deutschen Territorien, doch daraus entstand keine andauernde Verbindung.[1] Im 18. Jahrhundert interessierten sich deutsche Forscher für die Geographie der Ukraine, aber im 19. Jahrhundert erhielt die entstehende ukrainische Nationalliteratur und -kultur vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in Deutschland. Die Ukraine wurde zu einer übersehenen Nation.
Sie blieb eine Blindstelle in der deutschen Wahrnehmung bis in die jüngste Vergangenheit. Noch 2014, als Russland die Krim annektierte, gab es in der deutschen Öffentlichkeit einflussreiche Stimmen, die die Nationalstaatlichkeit der Ukraine in Frage stellten. Die Kenntnis des Landes beschränkt sich immer noch auf Expertenkreise. Seit der Invasion Russlands von 2022 haben die deutsch-ukrainischen Beziehungen allerdings für beide Länder einen neuen Stellenwert bekommen. Denn Russlands Angriff zielt nicht nur – was gravierend genug ist – auf die Annexion ukrainischer Gebiete, sondern auch, wie Putin selbst deutlich gemacht hat, darauf, die Ukraine als souveränen Nationalstaat zu vernichten. Darüber hinaus richtet sich der russische Angriff auf die bestehende Ordnung Europas, denn Russland führt auch einen hybriden Krieg gegen andere europäische Staaten, nicht zuletzt gegen Deutschland. Wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine gewönne, hätte dies – darin sind sich die Sicherheitsexperten weithin einig – gravierende Auswirkungen für alle Nachbarstaaten und die NATO insgesamt. Die Ukraine verteidigt die deutsche Sicherheit. Umgekehrt hängt für die Ukraine viel von der Unterstützung durch Deutschland ab.
Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind also für beide Seiten existenziell geworden. In dieser Situation ist Nicht-Wissen über die Ukraine mehr als nur ein kulturelles Versäumnis, es ist politisch brisant. Daher ist es wichtig, die deutsch-ukrainischen Beziehungen historisch zu verstehen und sich Klarheit zu verschaffen über ihre bislang kaum wahrgenommene und schon gar nicht bewältigte Vergangenheit. Wenn auch in den letzten Jahren einige Darstellungen der Ukraine auf dem deutschen Buchmarkt erschienen sind, so steht die Auseinandersetzung mit den deutsch-ukrainischen Beziehungen doch noch weitgehend am Anfang. Nur durch deren Studium kann ein Bewusstsein für die eingeschliffenen Verzerrungen in der deutschen Wahrnehmung der Ukraine geweckt werden und damit die Fähigkeit zu einem vertieften Dialog entstehen. In der Vergangenheit ist die ukrainische Geschichte in Deutschland aus ganz verschiedenen Gründen ignoriert und verdrängt worden. Das teils achtlose, teils geflissentliche Übersehen der Ukraine gehört selbst zur Geschichte Deutschlands und der Ukraine seit dem 19. Jahrhundert. Wer diese Geschichte verstehen will, muss auch nach den Ursachen fragen, weshalb die Ukraine in der deutschen Öffentlichkeit so lange ignoriert werden konnte.
Dass die Entstehung einer ukrainischen Nation im 19. Jahrhundert nicht mit einem wachsenden Interesse von deutscher Seite einherging, hat zum Teil offensichtliche Gründe: Für die europäischen Nationalkulturen war es kennzeichnend, dass sie ihre Identität aus der Abgrenzung von anderen Nationen gewannen. Jede Nation hatte ihren «signifikanten Anderen». Die Eigenschaften, die sich eine Nation selbst zuschrieb, leiteten sich unmittelbar aus der Negation der dem Anderen zugeschriebenen Charakteristika ab. Für die Deutschen war etwa Frankreich das «Vaterland der Feinde» (Michael Jeismann), «deutsche Kultur» wurde im 19. und 20. Jahrhundert über eine verächtlich gemachte «französische Zivilisation» erhoben.[2] Eine andere Negativfolie des deutschen Selbstbilds gab Polen ab. Auch für die Ukraine war Polen der «signifikante Andere», außerdem entwarfen die Protagonisten der ukrainischen Nationalbewegung ihre Idee von der Ukraine in Abgrenzung zu Russland. Deutschland spielte für die ukrainische Nation keine entsprechende Rolle, und dies galt auch umgekehrt. Dass weder die Ukraine noch Deutschland ihre nationale Identität in Abgrenzung vom anderen ausbildeten, schuf eine relativ unkomplizierte Ausgangslage für die Beziehungen. Ohne direkten Bezug zueinander waren Deutschland und die Ukraine in den mentalen Beziehungsgeflechten der europäischen Nationalismen allerdings weiter voneinander entfernt als geographisch.
Ein anderer Faktor kam hinzu: Zwischen Deutschland und Russland entstand seit dem 18. Jahrhundert eine spezielle Beziehung, die ebenfalls eine Bedeutung für die nationale Identität hatte, sich aber vom weit verbreiteten Muster der negativen Identifikation unterschied. Russland wurde für Teile der deutschen Öffentlichkeit das «Vaterland der Freunde», das heißt ein Land, mit dem konservative Milieus sich durch Bündnistraditionen, monarchischen Legitimismus und die Ablehnung der französischen Revolutionsideen verbunden sahen. Russland war für bestimmte Staatseliten und gesellschaftliche Gruppen in gewisser Hinsicht die Ausdehnung des eigenen Selbst: für die preußische Monarchie ein ressourcenstarker Verbündeter, an dessen Seite sie ihren eigenen machtpolitischen Aufstieg bis zur Reichseinigung von 1870/71 betrieb, für die deutschen Technik- und Wirtschaftseliten ein Land mit scheinbar unbegrenzten Entwicklungsmöglichkeiten, für konservative Denker schien Russland den Ausweg aus der Krise Europas zu eröffnen: «Die auf römisches Fundament gebauten Säulen kommen ins Wanken, der slawisch-germanische Aufbau schreitet voran», wie Thomas Mann im Dezember 1921 schrieb.[3] Zugleich wurde das bolschewistische Russland für deutsche Kommunisten zum Vaterland der Werktätigen. Zwar gab es in Deutschland auch russophobe Stimmungen, und im Ersten und Zweiten Weltkrieg standen die beiden Länder sich als Feinde gegenüber. Das zum Teil romantische, zum Teil interessengeleitete deutsche Russlandbild hatte dennoch über die Zäsuren hinweg Bestand. Dies war eine der Ursachen dafür, dass die Ukraine in Deutschland wenig oder verzerrt wahrgenommen wurde. Denn Deutschland machte sich den russischen imperialen Blick auf die Ukraine zu eigen, der diese als integralen Bestandteil Russlands und als ein Land ohne eigene Geschichte sah. Diese Wahrnehmungsmuster überdauerten den Ersten sowie den Zweiten Weltkrieg und blieben bis in die jüngste Vergangenheit wirksam. Darin lag eine Paradoxie: Auch als die westdeutsche Gesellschaft sich seit den 1960er Jahren schon von ihren eigenen kolonialen Traditionen im östlichen Europa, etwa in Bezug auf Polen, losgesagt hatte, hielt sie noch an der kolonialen Sichtweise Russlands auf die Ukraine fest. Selbst nach der völkerrechtlich fest verankerten Unabhängigkeitserklärung Kyjivs von 1991 stand die Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine in der Sichtweise vieler deutsche Politiker unter einem scheinbar legitimen russischen Vorbehalt. Man kann von einem sekundären Kolonialismus sprechen, von einem deutschen Blick auf die Ukraine durch die Linse Großrusslands.
Die Tatsache, dass die Wahrnehmung der Ukraine durch Deutschland von den speziellen deutsch-russischen Beziehungen geprägt ist, zieht sich seit dem 19. Jahrhundert wie ein roter Faden durch die Geschichte der wechselseitigen Beziehungen. Diese wurden allerdings im 20. Jahrhundert durch drei Kriege geprägt, in denen die speziellen Beziehungen zwischen Berlin und Sankt Petersburg beziehungsweise Moskau zerbrochen waren: Im Ersten Weltkrieg unterstützte das deutsche Kaiserreich die Gründung eines ukrainischen Staats mit dem Ziel, das Zarenreich aus Mitteleuropa zurückzudrängen. So beförderte der Konflikt zwischen dem deutschen und dem russischen Imperium den kurzlebigen Versuch, den ersten modernen ukrainischen Nationalstaat zu schaffen. Doch betrieb Deutschland in der Ukraine ein sehr instrumentelles state-building. Zu keinem Zeitpunkt war der neue Staat mehr als eine Marionette des Kaiserreichs. Deutschland beutete die Ukraine aus, vor allem mit dem Ziel, die Nahrungskrise im Reich zu überwinden.
1941 überzog Deutschland die Sowjetunion mit einem Vernichtungskrieg, in dem die Ukraine neben Belarus im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung die größten Verluste erlitt. Auch wenn das deutsche Ziel erneut die Gewinnung von ukrainischen Ressourcen war, hatte der Krieg doch einen anderen Charakter als der des kaiserlichen Deutschlands, denn er zielte darauf ab, ein rassistisch begründetes deutsches Kolonialreich im Osten Europas zu schaffen. Typisch imperiale Handlungsmuster, etwa die Strategie, loyale ukrainische Eliten an der Herrschaft zu beteiligen, spielten im Rassenkrieg keine maßgebliche Rolle mehr. Sie bildeten nur noch den Stoff für die Gedankenspiele zweitrangiger Akteure in deutschen Ministerien und in der Wehrmacht.
Gegenwärtig prägt erneut ein Krieg die deutsch-ukrainischen Beziehungen, allerdings ist Russland der Angreifer, während Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Geleitet von einer neoimperialen Ideologie, will der Kreml die Ukraine als unabhängigen Nationalstaat vernichten. Der Krieg ist in zweifacher Hinsicht asymmetrisch: in Bezug auf die Machtressourcen, über die Russland und die Ukraine verfügen, und ebenso in der Kriegsführung. Russland verletzt mit seinen täglichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung permanent das Völkerrecht, die Ukraine beachtet es weitestgehend in ihrem Verteidigungskrieg. Wenn sie jenseits der eigenen Grenzen operiert, greift sie in aller Regel militärische, nicht zivile Ziele an. Ganz im Gegensatz zu Russland foltert die Ukraine Kriegsgefangene nicht und betreibt auch keine ethnischen Säuberungen. Die Verpflichtung auf diese regelbasierte Ordnung verbindet die Ukraine und Deutschland. Der neoimperiale Machtanspruch Russlands hingegen richtet sich gegen diese Ordnung.
Zwischen den drei Kriegen, die für die deutsch-ukrainischen Beziehungen auf ganz unterschiedliche Weise prägend waren und sind, lagen Friedensperioden, die jeweils im Schatten der vorangegangenen Kriege standen. Das Scheitern der ukrainischen Staatsbildung unter deutscher Oberherrschaft am Ende des Ersten Weltkriegs bahnte in Kyjiv den Weg der Bolschewiki an die Macht und löste eine ukrainische Emigration nach Deutschland aus. Das Desaster von 1918 hatte für das politische Denken in der Ukraine eine ähnliche Wirkung wie der verlorene Weltkrieg für die Weimarer Republik. Deutsche und ukrainische Nationalisten leiteten aus der Deutung der Niederlage neue rechtsgerichtete Ideologien ab. Auch der Zweite Weltkrieg prägte die Zeit danach. Er brachte das Phänomen der Displaced Persons (DP) hervor und löste eine erneute ukrainische Emigration nach Deutschland aus. Die beiden deutschen Staaten setzten sich auf unterschiedliche Weise mit dem Erbe des Krieges auseinander: Westdeutschland durch die späte und kontroverse Aufarbeitung der in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen, die DDR durch einen Bruch mit den alten NS-Eliten und durch die Konstruktion von gemeinsamen Revolutionsmythen und offizieller Völkerfreundschaft.
Die Kriege wirkten nach ihrem Ende fort, speziell auch die Erinnerung daran, dass die deutsche Kriegsführung sich mit Ukrainern gegen das (sowjet-)russische Herrschaftszentrum verbunden hatte. Im Ersten Weltkrieg hatte es eine offizielle Kooperation zwischen Deutschland und der Ukraine gegen Russland gegeben, die in einem Spitzentreffen zwischen Wilhelm II. und Hetman Skoropadskyj im September 1918 sichtbar wurde. Im Zweiten Weltkrieg war die Lage widersprüchlich: Deutschland überfiel die Ukraine als Teil der Sowjetunion, und als Teil der Roten Armee besiegten nicht zuletzt ukrainische Soldaten NS-Deutschland. Daneben gab es jedoch auch in diesem Krieg eine Zusammenarbeit Deutschlands mit einzelnen ukrainischen Gruppen und Personen, ob sie nun zur Kooperation gegen Moskau bereit waren oder dazu gezwungen wurden. Nicht die wichtigste, aber die symbolträchtigste Figur der Kollaboration war Stepan Bandera, der an der Seite Berlins gegen Moskau – gewissermaßen Skoropadskyjs Vorbild unter veränderten Bedingungen folgend – eine unabhängige Ukraine gründen wollte. Allerdings fand Bandera, als er kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion die ukrainische Unabhängigkeit ausrufen ließ, keine Unterstützung durch NS-Deutschland, sondern wurde inhaftiert.
Skoropadskyj und Bandera verkörperten nach dem Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieg den gescheiterten Versuch eines ukrainisch-deutschen Zusammengehens gegen das (sowjet-)russische Imperium. So verschieden ihre Rollen im Krieg waren, so wurden beide doch in ihrer jeweiligen Nachkriegszeit zu, wenn auch umstrittenen, Symbolfiguren. Im Falle Skoropadskyjs erstreckte sich die Wirkung kaum über die ukrainische Emigration hinaus. Banderas Name hingegen wurde in beiden deutschen Staaten mit starken Bedeutungen verknüpft. Die DDR übernahm die sowjetische Interpretation, dass Bandera mit NS-Deutschland gleichzusetzen sei, die Propaganda dämonisierte den Anführer der ukrainischen Nationalisten und diskreditierte damit jegliche nationalen Tendenzen in der Ukraine. Wer als Ukrainer im Verdacht stand, nationale Ziele zu verfolgen, wurde als «Banderovec» (Bandera-Anhänger) verleumdet. Auch Teile des liberalen und linken Spektrums in der westdeutschen Öffentlichkeit identifizierten ukrainische nationale Bestrebungen mit Bandera und dem Faschismus. In den Diskussionen, die unter solchen Vorzeichen geführt wurden, geriet die Ukraine vollends in den toten Winkel. Als in der Zeit der Entspannungspolitik die Beziehungen zwischen Bonn und Moskau enger wurden, begann in Deutschland, zögernd zunächst, die Beschäftigung mit den Verbrechen auf ukrainischem Boden. Trotzdem wurde die Ukraine meist nicht als kulturelle, historische Einheit wahrgenommen, ja sie schien geradezu mit einem Tabu belegt zu sein. Man rechnete den Sieg über NS-Deutschland vor allem Russland zu und wollte auch nur den Anschein von Revisionismus vermeiden. Die Ukraine als Nation wahrzunehmen und ihr eigenes Recht anzuerkennen schien in die Irrwege der deutschen Politik zurückzuführen, wie sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrieben worden war. Es vertrug sich nicht mit den Zielen der deutschen Entspannungspolitik. Die Ukraine als integralen Bestandteil Russland zu sehen war die deutsche Form der Wiedergutmachung gegenüber Moskau. So verbanden sich die Absichten der Entspannungspolitik mit einer geflissentlichen Ignoranz gegenüber der Ukraine. Dies trug dazu bei, dass die deutsche Politik zu bestimmten Mustern der traditionellen Russlandpolitik zurückkehrte.
Die Tragödie der deutschen Ukrainepolitik spielte sich nicht nur auf der Ebene der hohen Politik ab. Millionen deutsche Soldaten kämpften im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, während zweieinhalb Millionen ukrainische Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter ins Reich kamen. Heute dürfte ein erheblicher Teil der Deutschen Vorfahren haben, die am Krieg oder an der Praxis der Zwangsarbeit beteiligt waren. Dies gilt auch für mich. Meine Großeltern väterlicherseits besaßen in der Bauernschaft Wessel im südlichen Münsterland einen Hof, dem 1941 ein ukrainisches Ehepaar, Vasil Kosticov und Vira Kosticova, als Arbeiter zugewiesen wurde. Zugleich wurden zwei Brüder meines Vaters eingezogen und kämpften an der Ostfront, beide fielen 1944 in der Ukraine beziehungsweise in Belarus. Meine Großeltern hatten keinen Anteil am Aufstieg des NS-Regimes, sie waren beide Anhänger der katholischen Zentrumspartei, nicht braun, sondern schwarz in unterschiedlichen Schattierungen: meine Großmutter tiefreligiös, mein Großvater Bismarck-Bewunderer und Verächter von Wilhelm II. Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs eingezogen, hatte er nicht in den vorderen Linien, sondern im Nachschub gedient. Aus dem Krieg kam er nicht mit einem Fronterlebnis, sondern eher an Schwejk gemahnenden Einsichten zurück. Im Theater seien die besten Plätze vorne, im Kino und im Krieg aber hinten. Während er große Gesellschaften in einem gepflegten Plattdeutsch unterhalten konnte, war sie introvertiert, dabei als ausgebildete Lehrerin eine moderne, belesene und ausgesprochen karitative Frau. Kein Almosensuchender kam vergeblich auf den Hof. Man könnte noch viel Sympathisches über beide berichten und kommt doch nicht um die nüchterne Feststellung herum, dass sich auf dem Hof im Kleinen die Ausbeutungs- und Kriegspolitik NS-Deutschlands abbildete. Denn die Ukrainer ersetzten die Arbeitskraft der Söhne, die im Osten kämpften.
Die Geschichte ist auch insofern typisch, als sie fast vergessen wurde. Ich lebte auf dem Hof bis zu meinem siebten Lebensjahr, danach verbrachte ich noch die Schulferien dort. Von den Zwangsarbeitern auf dem Hof erfuhr ich durch zwei Erzählungen. Die eine handelt vom Kriegsende, als DPs – freigelassene Kriegsgefangene und ehemalige Zwangsarbeiter – oftmals Vergeltung an ihren früheren Herren übten. Eine Gruppe von fremden Zwangsarbeitern, die in den Hof meiner Großeltern eindrangen, seien von den Zwangsarbeitern dort abgewiesen worden. Sie hätten den Hof verteidigt, weil sie gut behandelt worden seien. Die Geschichte steht immerhin nicht im Widerspruch zur lokalgeschichtlichen Forschung, in der die Höfe, auf denen Racheakte verübt wurden, genannt werden, der Hof meiner Großeltern ist nicht dabei.[4] Aber es ist eine schöne und deshalb nicht unbedingt verlässliche Familienlegende. Die zweite Erzählung ist auf den ersten Blick viel unglaubwürdiger, doch ich halte sie für wahr. Von Vira Kosticova wurde ihr strahlendes Äußeres und ihre Furchtlosigkeit berichtet: Vom ersten Tag an habe sie erklärt, dass Hitler den Krieg verlieren werde. Das äußerte sie schon 1941, lange vor Stalingrad, und wiederholte es in den folgenden Jahren mehrfach. Bemerkenswerter als die Tatsache, dass diese Prophezeiung eintraf, war der Mut dieser Zwangsarbeiterin. Der Wehrmacht die Niederlage vorauszusagen konnte gerade für sie schlimmste Folgen haben. Mich hat diese Geschichte als Kind beschäftigt. Erzählungen von persönlichem Mut kannte ich sonst nur aus Sagen und Märchen, dies aber war eine reale Begebenheit, die sich auf unserem Hof abgespielt hatte.
Die Überlieferung beider Geschichten ist allerdings dünn: Sie wurden mir von Gertrud Scholz, der Haushälterin meiner Großeltern, erzählt, die erst nach 1945 als Vertriebene aus der heute zu Polen gehörenden schlesischen Grafschaft Glatz nach Wessel kam. Sie konnte die ukrainische Familie nicht persönlich kennengelernt haben, bezog also ihre Kenntnisse von meinen Großeltern. Dass sie die Geschichte von Vira Kosticova wiederholt erzählte, mag mit einer gewissen Ähnlichkeit der Schicksale zusammenhängen: So unterschiedlich die Hintergründe waren, beide, die ukrainische Zwangsarbeiterin und die deutsche Vertriebene, waren durch den Krieg gewaltsam in den Westen Deutschlands gezwungen worden. Die westdeutsche Landwirtschaft, auch der Hof meiner Großeltern, hat davon zweimal profitiert.
Trotzdem führt von Vira Kosticova keine direkte Linie zu meinem Ukraine-Interesse und zu diesem Buch. Als Oberstufenschüler schrieb ich an einer Geschichte der Judenverfolgung in unserer Schulstadt mit, aber es fiel mir nicht ein, mich mit dem familiär näherliegenden Thema der Zwangsarbeit zu beschäftigen. Paradoxerweise kam ich zur ukrainischen Geschichte erst durch meinen Studienaufenthalt in Moskau 1984/85. Dort war ich am Puškin-Institut eingeschrieben, einem Lehrinstitut, in dem Slawistinnen und Slawisten vorwiegend aus den sozialistischen Ländern studierten, um Russisch zu lernen. In der kleinen westdeutschen Klasse gab es neben dem Sprachunterricht Lektionen in Marxismus/Leninismus, als «Landeskunde» getarnt, aber auch eine ausgezeichnete Vorlesung zur Sprachgeschichte Russlands, gehalten von dem Dozenten Arkadij Archipov, einem Linguisten aus dem weiteren Umfeld Jurij Lotmans. Er betreute meine Abschlussarbeit zu einem für die russozentrische Ausrichtung des Instituts höchst ungewöhnlichen Thema: Ich schrieb über den in Kyjiv ausgebildeten Dichter Simjaon Polacki (1629–1680), der aus der Ukraine einen westlichen Literaturstil und theologisches Denken an den Zarenhof brachte.
Dazu kam ein persönlicher Kontakt, den ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte. Vormittags fand am Institut die Lehre statt, nachmittags konnten wir unserer Wege gehen. Ich lernte durch die Vermittlung einer Münchener Dozentin ein älteres Ehepaar, Lev Nikolaevič Lebedinskij und seine Frau Marija Jurevna, kennen und besuchte die beiden jede Woche in ihrer Wohnung in einem der stalinistischen Wohnhäuser westlich der Moskva. Die privilegierte Wohnlage verdankten sie dem Umstand, dass Lev Nikolaevič schon vierzehnjährig als berittener Melder im Bürgerkrieg auf der Seite der Roten gekämpft hatte. Obwohl er schon lange kein Bolševik mehr war, vergaß ihn die Partei nicht, und so blieb er über viele Jahrzehnte hinweg Empfänger besonderer Essenszuteilungen. Auch ich profitierte bei den wöchentlichen Mittagessen am Tisch der Lebedinskijs davon. Lev Nikolaevič war ein bekannter Musikwissenschaftler und Freund Dmitrij Šostakovičs. 1985 veröffentlichte er seine Erinnerungen an den Komponisten in der Zeitschrift «Novyj Mir». Marija Jurevna, eine feinsinnige Frau, hatte als Literaturübersetzerin aus dem Französischen gearbeitet. Die Temperamente waren zwischen ihnen genauso verteilt wie zwischen meinen Großeltern. Als ich den Lebedinskijs von meiner Absicht erzählte, über Simjaon Polacki eine Arbeit zu schreiben, nahm mich Marija Jurevna beiseite und offenbarte mir, dass sie Ukrainerin sei. Sie sprach ausführlich von der Geschichte ihres Landes, von der Gedankenwelt des frühneuzeitlichen Kyjivs, von der ukrainischen Literatur des 19. Jahrhunderts, von den Sprachverboten, die das Zarenreich in den 1870er Jahren gegen das Ukrainische verhängte, und schließlich auch von der großen Hungersnot in der Ukraine in den frühen 1930er Jahren, dem Holodomor, der durch Stalins rücksichtslose Modernisierung ausgelöst und willentlich verschärft worden war. Für mich, immerhin Geschichtsstudent im vierten Semester, eröffnete sich eine neue Sichtweise. Vom Holodomor hörte ich zum ersten Mal nicht in einem deutschen Hörsaal, sondern in einem stalinistischen Wohnhaus in Moskau.
Aus Russland kam ich mit dem Simjaon Polacki-Projekt und der Erinnerung an das denkwürdige Gespräch mit Marija Jurevna zurück. Meine Absicht, zu den frühneuzeitlichen Verflechtungen zwischen der Ukraine und Russland meine Abschlussarbeit zu schreiben, realisierte ich nicht, als der einzige dafür kompetente Betreuer an der Freien Universität langfristig erkrankte. Ich wechselte zur russisch-polnischen Beziehungsgeschichte, immerhin auch mit einem postimperialen Ansatz. Die Erinnerung an das Gespräch mit Marija Jurevna begleitete mich länger als das liegengebliebene Forschungsprojekt. Es war eine Motivation für meine Ukrainestudien, vor allem nach dem Beginn des russisch-ukrainischen Kriegs 2014.
KAPITEL 1
Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
Hruševskyj und Hoetzsch: Die Vorgeschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen
Am Abend des 10. Oktober 1906 fand im galizischen Lemberg (Lviv) eine denkwürdige Begegnung statt: Der deutsche Historiker Otto Hoetzsch besuchte seinen ukrainischen Kollegen Mychajlo Hruševskyj. Es war kein Treffen zwischen Gleichen. Bereits ein Jahr zuvor hatte Hoetzsch, damals dreißigjährig und gerade erst in Berlin habilitiert, mit einer tiefen Verbeugung an seinen Kollegen geschrieben: «Verzeihen Sie, dass ich, obwohl ich Ihnen persönlich nicht bekannt bin, um ein Treffen mit Ihnen bitte.» Er gab an, sich «unter der Leitung von Professor Schiemann» mit russischer und polnischer Geschichte zu beschäftigen.[1] Hruševskyj war zehn Jahre älter und verfügte mit dem Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte in Lviv über eine einflussreiche Stellung. Mehr noch, er hatte bereits eine wahrhaft kopernikanische Wende in seinem Fach angestoßen: 1898 hatte er den ersten Band seiner monumentalen «Geschichte der Ukraine-Rus» veröffentlicht, und sechs Jahre später erklärte er die Grundidee des Gesamtwerkes in einem Aufsatz über «Das übliche Schema der (russischen) Geschichte und die Suche nach einer rationalen Struktur der Geschichte der Ostslawen». Der Artikel, publiziert in einer Reihe der Russischen Akademie der Wissenschaften, schlug hohe Wellen, denn es ging hier nicht um die Korrektur von einzelnen Fakten. Hruševskyj stellte die Meistererzählung der russischen Geschichtsschreibung selbst in Frage, die von allen namhaften Historikern Russlands, ob liberal oder konservativ, geteilt wurde. Dem russischen Narrativ zufolge war das Zarenreich der legitime und der einzige Nachfolger der mittelalterlichen Reichsbildung der Kyjiver Rus. Von ihr führte eine direkte Linie über das Moskauer Fürstentum der Frühneuzeit bis in das Petersburger Imperium des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Kontinuitätsbehauptung griff Hruševskyj an und damit die historische Legitimität der russischen Staatsidee. Er beanspruchte das Erbe der Kyjiver Rus für die Ukraine und fand Belege dafür, dass sich die ukrainische Geschichte demographisch, sozial, wirtschaftlich und politisch von Anfang an von der russischen unterschied. Hruševskyjs Studien lösten sofort einen russisch-ukrainischen Historikerstreit aus, dessen Wirkung bis in die Gegenwart reicht.
Noch Putins Essay «Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern» vom Juli 2021 ist ein später politischer Widerhall auf Hruševskyjs Werk. Von Anfang an seien Russen und Ukrainer ein einziges Volk, ist die Kernaussage von Putins Text. Jede Abweichung von dieser Einheit – etwa die Annäherung der westlichen Ukraine an kirchliche und politische Traditionen des Westens seit dem 17. Jahrhundert oder die Annäherung Kyjivs an westliche Bündnissysteme heute – ächtet er als Abweichung von diesem Ursprungsmythos. Putins Essay lässt sich lesen als eine Ankündigung der russischen Invasion, die er im Februar 2022 befahl.[2]
Welche Sprengkraft in der Geschichtsrevision Hruševskyjs steckte, war in seiner Zeit noch nicht erkennbar. Für die deutsche Geschichtswissenschaft war die neue ukrainische Geschichtswissenschaft, die durch Hruševskyj und in seinem Umfeld entstand, zunächst schwer zugänglich. Deutsche Slawisten beherrschten in der Regel nicht das Ukrainische. Die nötige Übersetzungsarbeit leisteten polnische Spezialisten. Vor allem Alexander Brückner (1856–1939), der seit 1892 in Berlin eine Professur für Slawische Sprache und Literatur innehatte, machte durch Rezensionen auf die wissenschaftliche Produktion der Ukraine aufmerksam. Im Frühjahr 1906 erschien in Leipzig eine deutsche Ausgabe des ersten Bandes von Hruševskyjs Werk mit dem Titel «Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes». Die Übersetzung war dilettantisch – schon der Titel machte aus der Geschichte des Landes Ukraine fälschlich eine ethnische Geschichte der Ukrainer – und enthielt viele österreichische Ausdrücke, die in der deutschen Wissenschaftskommunikation nicht geläufig waren, wie in Rezensionen beklagt wurde. Trotz dieser Mängel eröffnete sie einen deutsch-ukrainischen Dialog.
Auch Otto Hoetzsch nahm daran teil. Er verfasste 1906, im Jahr seines Besuchs bei Hruševskyj, eine ausführliche Besprechung des Buchs. Für ihn war das Werk Hruševskyjs eine Entdeckung, die er mit der historisch interessierten Öffentlichkeit Deutschlands teilen wollte. Voller Lob betonte er, wie wichtig es sei, es für westliche Leser zugänglich zu machen, die die verschiedenen Völker des östlichen Europas immer nur mit den Imperien in Verbindung brächten. Den «tiefgreifenden Unterschied zwischen dem Großrussentum […] und dem Kleinrussentum» habe die Geschichtsschreibung bislang nicht ausreichend gewürdigt. Sinngemäß beklagte er, dass die Ukraine nur als Teil des Russischen Reichs wahrgenommen und so in ihrer Eigenart übersehen werde – trotz des großen zivilisatorischen Beitrags der Ukrainer. Er hob auch die Kraft der ukrainischen Nationalbewegung hervor, die sich trotz der Verfolgungen im Zarenreich behauptet hatte. Heute würden ukrainische Historiker wie Hruševskyj die ruhmreiche Geschichte ihres Volkes aus der Vergessenheit befreien, nationale Geschichtsschreibung gehe Hand in Hand mit nationalem Erwachen der Ukrainer. Der Rezensent schloss mit der Bemerkung: «Ich kann mich nur freuen, dass diese wertvolle und harte Arbeit jetzt für die deutsche Welt zugänglich ist.»[3] Das Urteil wurde von anderen deutschen Gelehrten geteilt. Der Bonner Slawist Leopold Karl Götz schrieb für die «Deutsche Literaturzeitung» in Berlin eine kurze, prägnante Rezension über Hruševskyjs Werk: Seine Vision habe das unter europäischen Lesern weitverbreitete Stereotyp von der osteuropäischen Geschichte als einem «monokulturellen und monoethnischen Raum» zerstört.[4]
1906 war das Jahr, als es den deutschen Slawisten und Osteuropahistorikern zum ersten Mal wie Schuppen von den Augen fiel: Zwischen Russen und Ukrainern bestand eine Differenz. Ungeachtet der politischen Zugehörigkeit zum Zarenreich gab es in der Ukraine ein Bewusstsein für eigene historische und kulturelle Traditionen. Die Ukrainer bildeten eine Nation. Ganz ähnliche Entdeckungen machten deutsche Osteuropahistorikerinnen und -historiker nach 2014 erneut: Während Einzelne noch auf der Einheit von Russen und Ukrainern insistierten, schrieb Karl Schlögel seine «Ukrainischen Lektionen», ein Eingeständnis eigener Wahrnehmungsversäumnisse und zugleich ein Buch, das die ukrainische Geschichte für einen weiten Leserkreis erschloss. Und obwohl andere Historiker, etwa Andreas Kappeler und Hans-Joachim Torke, schon lange vorher in einem kontinuierlichen Dialog mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine standen, kann man sagen, dass es den Moment des Erstaunens über eine lange übersehene Kultur im Osten Europas nur zweimal gab: zum ersten Mal, als Hruševskyj die ukrainische Geschichte als Nationalgeschichte für die ukrainische und europäische Öffentlichkeit erschloss, und nach 2014 nochmals, nach einer Phase, in der man in Deutschland und anderen west- und mitteleuropäischen Ländern diese Geschichte wieder weithin vergessen hatte.
Hoetzsch und andere deutsche Rezensenten bekundeten Sympathie für die Verbindung von nationaler Bewegung und wissenschaftlichem Interesse der Ukrainer, ohne selbst in den Streit einzugreifen, ob Ukrainer oder Russen das größere Recht hatten, ihre Nationalgeschichte auf die mittelalterliche Kyjiver Rus zurückzuführen.[5] Der deutsche Historiker war vor allem wissenschaftsorganisatorisch interessiert und wollte in der Ukraine ein Netzwerk von kollegialen Kontakten aufbauen. Dafür bat er Hruševskyj um Unterstützung. Das Ziel war die Gründung einer deutschsprachigen Zeitschrift, die die verschiedenen nationalen Stimmen des östlichen Europa der westlichen Öffentlichkeit bekannt machen sollte, um einen Reflexionsraum für die nichtstaatlichen Völker zwischen den Deutschen und den Russen zu schaffen. Daran gab es auch von ukrainischer Seite ein Interesse. Hruševskyj war sich der Bedeutung der westlichen Öffentlichkeit für die Entwicklung der ukrainischen Nationalbewegung sehr wohl bewusst und unterstützte das Projekt einer Zeitschrift, deren erste Hefte 1910 erschienen.[6] Aber er hegte gegenüber dem Projekt auch Bedenken: Wie konnte verhindert werden, dass die deutsche Zeitschrift voreingenommen und von oben herab auf die ukrainische Nationalbewegung schaute? Wie war zu gewährleisten, dass das neue Organ die Ukraine als «organisches und unabhängiges Phänomen» darstellte? Hruševskyj erläuterte gegenüber dem deutschen Kollegen seine Sorgen. Viel Verständnis scheint er bei diesem nicht gefunden zu haben. In einer Tagebuchnotiz vom 23. September 1906 schrieb er über die Begegnung: «Vor dem Abend traf ich mich mit Hoetzsch. Er machte als Person mit seiner besonderen preußischen Denkweise nicht viel Eindruck. Sein Interesse an der Ukraine scheint ihm auch nicht sehr wichtig zu sein, aber [...] pro foro externo.»[7]
Dass Hruševskyj den jüngeren deutschen Kollegen mit Preußen assoziierte, ist denkwürdig. Denn Hoetzsch war Sachse. 1876 in Leipzig geboren, wuchs er in einer Handwerkerfamilie auf, besuchte die humanistische Thomasschule, war Freiwilliger in der sächsischen Armee und studierte in Leipzig und München. Er wurde 1900 mit einer Dissertation zur sächsischen Landesgeschichte promoviert. Zum Zeitpunkt der Begegnung mit Hruševskyj hatte für ihn allerdings eine neue Lebensphase begonnen, in der Preußen in den Mittelpunkt seines Lebens und seiner wissenschaftlichen Arbeit rückte. 1906 habilitierte er sich bei Otto Hintze in Geschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Im selben Jahr begann er an der Königlichen Akademie zu Posen zu unterrichten und ab 1911 lehrte er an der Preußischen Kriegsakademie in Berlin. Im mehrheitlich polnischen Posen eignete er sich eine engagiert deutschnationale Weltanschauung an. Die Provinz Posen, die durch die Teilungen Polens an Preußen gefallen war, bildete seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Schauplatz erbitterter deutsch-polnischer Nationalitätenkämpfe, die sich seit der Jahrhundertwende immer deutlicher zuungunsten der Deutschen entwickelten. Angesichts der prekären Situation der deutschen Volksgruppe agitierte Hoetzsch für die gezielte «Einsiedlung» Hunderttausender deutscher Bauern in das polnische Siedlungsgebiet – eine «neue große Ostwärtsbewegung in der deutschen inneren Volksgeschichte».[8] Über den Weltkrieg hinaus blieb die negative Sicht auf Polen für den deutschen Historiker bis in die 1920er Jahre eine intellektuelle und emotionale Konstante.
Die polnische Nationalbewegung als Konkurrenten der eigenen Nation zu betrachten, darin lagen der deutsche und der ukrainische Historiker allerdings grundsätzlich nicht weit auseinander. Was Hoetzsch aber zutiefst von Hruševskyj unterschied, war die Orientierung an Russland. In derselben Zeit, als Hoetzsch sich für den antipolnischen Nationalitätenkampf engagierte, entwickelte er ein Interesse an der Geschichte der russisch-preußischen Beziehungen, wobei Russland offenbar für ihn die mächtepolitische Stabilität im östlichen Europa garantierte, auf Kosten des geteilten Polen. So bereitete Hoetzsch eine große Edition der politischen und privaten Schriften des Diplomaten Peter von Meyendorff (1796–1863) vor, der in den 1840er Jahren die russischen Interessen am preußischen Hof vertrat und zu einer Symbolfigur des russisch-preußischen Zusammengehens gegen die nationalen Bestrebungen Polens geworden war.[9] Das machte ihn für Hoetzsch interessant, der um 1906 Antipolonismus verbunden mit einer politischen Orientierung an Russland als Grundeinstellung vertrat und jedenfalls in dieser Hinsicht die Staatsräson der Hohenzollernmonarchie repräsentierte. Hruševskyj hatte das offenbar erkannt, wenn er von Hoetzschs «preußischer Denkweise» sprach.
Die Begegnung von Hoetzsch und Hruševskyj war emblematisch für das deutsch-ukrainische Verhältnis, ein Verhältnis fast ohne Vorgeschichte. Nur wenige deutsche Intellektuelle interessierten sich in der Zeit des Kaiserreichs für die Ukraine, die für sie ein fremdes Land war. Umgekehrt war Deutschland in der Ukraine ein Begriff, viele Ukrainer hatten an deutschen Universitäten studiert. Aber die Beziehungen mit Russland, Polen und der Habsburgermonarchie waren enger.[10] Fremdheit als Rahmenbedingung bestimmte das deutsch-ukrainische Verhältnis. Auch wenn sie überwunden werden sollte, was Hoetzsch mit seinem Besuch bei Hruševskyj bezweckte, blieb sie bestehen und öffnete den Raum für Missverständnisse und Enttäuschungen. Hruševskyjs Tagebucheintrag zeigt, dass er sich mit nicht weniger zufriedengeben wollte als mit einem wirklichen Interesse an der Ukraine, vielleicht wünschte er auch eine Parteinahme des deutschen Kollegen im ukrainisch-russischen Geschichtsstreit. Stellten die freundlichen Rezensionen, die Hoetzsch und andere deutsche Gelehrte zu Hruševskyjs Buch verfassten, vielleicht nur wohlwollende Lippenbekenntnisse dar? Der Lauf der Zeit bestätigte im Falle von Otto Hoetzsch diesen Verdacht: Der deutsche Kollege mit «preußischer Denkweise» interessierte sich für die Ukraine, aber das Verhältnis zum russischen Zarenreich behielt Priorität. Auch über 1914 hinaus, als sich Deutschland und Russland im Weltkrieg als Feinde bekämpften, hielt Hoetzsch an seiner russophil grundierten imperialen Orientierung fest und profilierte sich als Fürsprecher einer Russlandpolitik, die auch im Weltkrieg stets die Möglichkeit einer Wiederannäherung zwischen Berlin und Petersburg im Auge behielt. Sein Russland-Buch, 1912 in erster und 1917 in zweiter Auflage veröffentlicht, bot eine Einführung in die Innen- und Außenpolitik des Zarenreichs vor Kriegsbeginn, die von der bedrohten Stabilität der imperialen Ordnung handelte und wenig mit seinen ukrainophilen Sympathien aus früheren Jahren zu tun hatte. Bei allem Interesse an wissenschaftlichem Austausch, das Hruševskyj und Hoetzsch teilten, war es diese preußische Tradition, die sie trennte.
Die österreichische Perspektive auf die Ukraine war ganz anders beschaffen. Die Ukraine war für Wien keine «foreign affair». Dreieinhalb Millionen Ukrainer lebten im cisleithanischen Teil der Monarchie, eine halbe Million im transleithanischen. Ihre Belange bildeten einen Teil der habsburgischen Innenpolitik. Im Kronland Galizien, das die Habsburgermonarchie durch die Teilungen Polens erworben hatte, stellten die Ukrainer etwa die Hälfte der Bevölkerung, sie bewohnten den östlichen Teil des Kronlands mit Lviv als Zentrum, die Polen vor allem den westlichen Teil mit Krakau. Deutsche, Polen, Ukrainer und andere Nationalitäten standen in der Habsburgermonarchie in einem Verhältnis zueinander, das durch das imperiale Gehäuse der Monarchie definiert war. Das Zentrum in Wien tarierte seine Beziehungen zu den Kronländern durch ein komplexes Geflecht von Loyalitätsbeziehungen aus, das durch Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Ethnien weiter kompliziert wurde.[11] Im Falle von Galizien hatte es Wien mit einer selbstbewussten polnischen Elite zu tun, deren Ehrgeiz auf eine Ungarn vergleichbare Stellung in der Monarchie zielte. Die Ukrainer bildeten innerhalb des Kronlands eine relativ junge Nationalbewegung. Wien war sich deren Loyalität nicht sicher. Denn neben den Ukrainern, die sich zur Habsburgermonarchie bekannten – den sogenannten Jungruthenen –, gab es auch Gruppierungen, die ihren Zusammenhang mit der russischen Kultur betonten, die sogenannten Altruthenen. Diese fühlten sich zum Teil politisch der Habsburgermonarchie zugehörig, teilweise waren sie aber auch politisch russophil und lehnten das österreichische Kaiserhaus ab. Die habsburgische Politik, maßgeblich bestimmt durch deutsch-österreichische Beamte und Politiker, verfolgte einen Kurs, der den komplizierten Verhältnissen Genüge tat: Sie versuchte, die Ukrainer an sich zu binden, indem sie deren kulturelle und religiöse Aktivitäten tolerierte. Die Freiräume, die Wien den Ukrainern gewährte, hatten in dem komplexen Loyalitätsgeflecht der Monarchie aber auch negative Rückwirkungen: Die Polen Galiziens fühlten sich von der aufstrebenden ukrainischen Nationalbewegung herausgefordert und verteidigten ihren Status im habsburgischen Föderalismus gegen sie. Aus der Sicht des Petersburger Imperiums bildeten die Freiheiten, die die Ukrainer direkt an seiner Grenze genossen, eine Gefahr. Hier entstand, so die Befürchtung, ein Schaufenster für die Überlegenheit der zivilen Kultur der Habsburgermonarchie und vielleicht ein Herd der Feindschaft gegen Russland.
Die russische Wahrnehmung, dass Galizien aufgrund seiner entwickelten Zivilgesellschaft auf die Verhältnisse im Zarenreich einwirken könnte, entspricht einer gegenwärtig virulenten Konstellation. Heute stellt aus russischer Sicht die gesamte Ukraine – nicht nur Galizien – eine Gefahr der Ansteckung Russlands durch eine überlegene zivile Kultur, demokratische Freiheiten und relativen Wohlstand dar. In beiden Fällen trug wohl die Furcht vor einem Übergreifen von attraktiven Prinzipien und Lebensformen zu den russischen Annexionsabsichten gegenüber Galizien beziehungsweise der Ukraine bei, wenn dies auch nicht offen erklärt wurde.
Das Verhältnis zwischen der Habsburgermonarchie und ihren Ukrainern war überaus komplex, es brachte für die Ukrainer neben den gewährten Freiheiten auch Enttäuschungen mit sich, wenn die Wiener Zentrale aus Gründen der Staatsräson den polnischen Bestrebungen zulasten der Ukrainer nachgab. Doch es war eine enge Beziehung. Die imperialen Loyalitätsbeziehungen schufen zwar keine gleichen Verhältnisse zwischen dem deutsch-österreichischen Zentrum und der ukrainischen Peripherie. Immerhin beruhten sie aber auf intensiven Kenntnissen auf verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ebenen.
Für das Deutsche Reich hingegen bildete die Ukraine allenfalls einen Faktor in der Außenpolitik. Selbst dies war nur punktuell der Fall – nämlich immer dann, wenn es in der langen Geschichte der preußisch- beziehungsweise deutsch-russischen Bündnispolitik zu Störungen kam. Dafür gibt es einige historische Beispiele: Zu einem russisch-preußischen Gegensatz kam es 1791, als die preußische Regierung befürchtete, dass Russland durch seine Expansion am Schwarzen Meer und an der Ostsee das europäische Gleichgewicht zu seinen Gunsten verschieben könnte. Als man in Berlin einen Krieg gegen Russland nicht mehr ausschloss, empfing der preußische Minister Ewald Friedrich von Hertzberg (1725–1795) einen Entsandten aus der Ukraine, einen Grafen Kapnist, zu einer geheimen Audienz. Der Entsandte stellte die Entrechtung des ukrainischen Adels durch die imperiale zentralistische Politik der russischen Zarin Katharina II. und ihres Favoriten Fürst Potemkin dar. Er bat den preußischen Minister um Unterstützung für die ukrainischen Autonomiebestrebungen im Falle eines russisch-preußischen Kriegs. Hertzberg lehnte das nicht ausdrücklich ab, versprach aber nichts. Wenn es zum Krieg mit Russland komme, sei es an der Ukraine, das Nötige zu tun, um die Unterstützung Preußens zu erlangen. Doch blieb die Unterredung eine Episode, denn die Spannungen zwischen Preußen und Russland wurden bald überwunden – durch die zweite Teilung Polens 1792. Die Berliner Politik war an der Beseitigung von Staaten in Ostmitteleuropa interessiert, nicht an der Schaffung neuer.[12]
Auch im 19. Jahrhundert interessierte sich die preußische Politik nur dann für die Ukrainer, wenn die Beziehungen zu Russland vorübergehend brüchig erschienen. Dies war im Krimkrieg der Fall, als Russland mit den Westmächten und dem Osmanischen Reich um die Vorherrschaft im Schwarzen Meer kämpfte. In dem Krieg ging es um Geopolitik, aber auch um die Vorherrschaft von Ideologien, denn er wurde in den europäischen Medien als Widerstreit zwischen westlichen Prinzipien und den Geltungsansprüchen des russischen autokratischen Imperiums geführt. Die deutschen Mächte Preußen und Österreich blieben im Krimkrieg neutral, aber in der demokratischen Öffentlichkeit Süd- und Mitteldeutschlands wuchs – wie in London und Paris – die Empörung über das russische Imperium, den «Koloss auf tönernen Füßen». In Presse- und Flugschriften-Kampagnen forderte man von Preußen, seine Neutralität aufzugeben und in den Krieg einzutreten, um «das Zarenreich so vollständig als möglich in die Grenzen der russischen Nationalität zurückzuweisen». Russland sollte seine Randgebiete einschließlich «des größten Theils der Länder am Schwarzen Meer und den ganzen Kaukasus räumen».[13] Hier tauchte die Ukraine als eine, wenn auch unbestimmte, territoriale Vorstellung auf. Dem anonymen Autor der Kampfschrift war bewusst, dass die Schwarzmeerküste nicht ethnisch russisch besiedelt war, über einen Namen für das Land und seine Bewohner verfügte er aber nicht. Vereinzelt fanden solche Vorstellungen Eingang in die Politik. Der preußische Gesandte in London, Christian von Bunsen (1791–1860), verfasste im März 1854 eine Denkschrift, in der er den Kriegseintritt Preußens an der Seite der Westmächte verlangte, um das Zarenreich «auf seine natürlichen Grenzen in Europa zurückzuweisen». Russland sollten Cherson und Taurien sowie die Krim entrissen werden. Von Bunsen sprach von Polen, das «als Grenzhüter gegen Moskau» wiederhergestellt werden sollte, aber für die ukrainischen Gebiete des Zarenreichs hatte auch er keinen Begriff.[14] Seine antirussische Politik fand in der preußischen Regierung keinen Rückhalt, von Bunsen wurde in den Ruhestand versetzt.
Allianzpolitik mit Russland zu betreiben, allenfalls neutral zu bleiben, sich aber auf keinen Fall auf einen Krieg mit Russland einzulassen, entsprach ganz der Linie Otto von Bismarcks, der als preußischer Botschafter in Petersburg tätig war, bevor er preußischer Ministerpräsident und später deutscher Reichskanzler wurde. Bismarcks Bündnispolitik hatte ein Pendant in seiner Sichtweise auf die Ukraine, die für ihn entsprechend der russischen Sprachregelung «Kleinrussland» war. Von einer «Theilung zwischen Groß- und Klein-Russen» hielt er nichts.[15] Die traditionelle, auf das 18. Jahrhundert zurückgehende Tradition der Russlandpolitik stand der Wahrnehmung der Ukraine im Wege. Zwar wurde die Russlandbindung der deutschen Politik unter den Nachfolgern Bismarcks schwächer. Der von Bismarck initiierte und 1887 abgeschlossene Rückversicherungsvertrag mit Russland nahm die Tradition der speziellen deutsch-russischen Beziehungen noch einmal auf, doch konnte er die Annäherung zwischen Russland und Frankreich und deren Allianz im Ersten Weltkrieg nicht verhindern.
Auch die kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und der Ukraine waren schwach entwickelt. Während es im 18. Jahrhundert ein Interesse deutscher Gelehrter an der Ukraine als Natur- und Kulturraum gegeben hatte, blieb die ukrainische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts mit ihren Aufklärungsgesellschaften und ihrer Literatur in Deutschland weithin unbemerkt.[16] Hier verfolgte man die großen Umbrüche im Zarenreich wie den Dekabristenaufstand, die großen Reformen der 1860er Jahre und die revolutionäre Bewegung in den 1870er Jahren. Dass alle diese Umwälzungen eine Triebfeder in der Ukraine hatten, entging dem deutschen Publikum aber weitgehend. Auch wo es einen Bezug zu Deutschland gab, wie bei der Aufhebung des deutschen Magdeburger Stadtrechts in ukrainischen Städten 1831 durch die zarische Regierung, blieb eine Reaktion der deutschen Öffentlichkeit aus.[17] Die ukrainische Literatur, die im 19. Jahrhundert eine Reihe großer Dichter und Schriftsteller hervorbrachte, fand in Deutschland nur ein punktuelles Interesse. Am ehesten galt das noch für den Nationaldichter Taras Ševčenko (1814–1861), der von mehreren deutschen Schriftstellern rezipiert wurde. Eine Vermittlerrolle spielte der Schriftsteller, Journalist und Politiker Ivan Franko (1856–1916), der die deutschsprachige Welt regelmäßig über die Ukraine informierte.[18] Neben diesen beiden wurden nur wenige andere Ukrainer ins Deutsche übersetzt, etwa die bukowinische Dichterin und Feministin Olha Kobyljanska (1863–1942) und der galizische Prosaschriftsteller Vasyl Stefanyk (1871–1936).
Die Gründe für das wenig ausgeprägte Interesse sind mannigfaltig. In allen Fällen hing es mit der hohen Affinität zwischen deutscher und russischer Kultur zusammen, die der Wahrnehmung der Ukraine entgegenstand. Die «russische Idee», so wie sie von den Slawophilen der 1840er Jahre und dann von Fedor Dostojevskij in seinem «Politischen Tagebuch» formuliert wurde, war von der deutschen Romantik beeinflusst und fand einen großen Widerhall, als das konservative Gedankengut durch Übersetzungen nach Deutschland reimportiert wurde. Der gemeinsame Nenner war der Widerspruch gegen den Universalismus des Westens. So wurden die Russen in der Wahrnehmung vieler konservativ gesinnter Deutscher als «Nachbarn» wahrgenommen, als ob es zwischen den beiden Völkern nicht auch Polen, Belarussen und Ukrainer gegeben hätte. Paradoxerweise erschienen Deutschland und Russland aus der Sicht vieler deutscher Beobachter gerade im Ersten Weltkrieg als Schicksalsgefährten. «Welche Verwandtschaft in dem Verhältnis der beiden nationalen Seelen zu ‹Europa›, zum ‹Westen›, zur ‹Zivilisation›, zur Politik, zur Demokratie!», rief Thomas Mann in seinen «Betrachtungen eines Unpolitischen» aus und folgerte: «Nein, wenn Seelisches, Geistiges überhaupt als Grundlage machtpolitischer Bündnisse dienen soll und kann, so gehören Russland und Deutschland zusammen: ihre Verständigung für jetzt, ihre Verbindung für die Zukunft ist seit dem Beginn des Krieges der Wunsch und der Traum meines Herzens.»[19]
Koloss auf tönernen Füßen? Der neue Blick auf das Zarenreich und die Ukraine
Wenn auch die «russische Idee» in Deutschland bis in den Krieg hinein wirksam war, drängte doch eine alternative Wahrnehmung Russlands nach vorn. Russland wurde in den Jahrzehnten vor dem Weltkrieg von einem kleinen, aber einflussreichen Teil der deutschen Öffentlichkeit als Gegner, ja als Feind gesehen. Sozialdarwinistische Vorstellungen griffen um sich, die keinen langfristigen Bündnistraditionen trauten, sondern nur noch in Kategorien von Sieg oder Niederlage dachten. Jetzt verbreiteten sich Ideen, wie sie im Krimkrieg erstmals aufgeschienen waren: Jedes Mittel erschien probat, das Zarenreich in die Knie zu zwingen, auch das Anstiften von Revolutionen durch die sogenannten Fremdvölker des Reiches. Damit waren die nicht-russischen Ethnien Russlands gemeint, also grundsätzlich auch die Ukraine, die zum Aufstand gegen den «Koloss auf tönernen Füßen» angestachelt werden sollten. Dieses Konzept propagierten viele baltendeutsche Emigranten, die das Zarenreich unter dem Druck der Russifizierungspolitik der 1870er und 1880er Jahre verlassen und ein extrem negatives Russlandbild nach Deutschland mitgebracht hatten.[20] Mit publizistischen Mitteln und durch persönliche Kontakte zu preußischen Beamten und Militärs gelang es ihnen, den Russlanddiskurs der deutschen Eliten zu beeinflussen. Vordenker dieser Richtung war der Historiker Theodor Schiemann (1847–1921), der 1887 aus dem Baltikum nach Berlin übersiedelte und 1892 die neu eingerichtete außerordentliche Professur für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Universität erhielt. Zusammen mit dem ganz anders gesinnten Otto Hoetzsch bildete Schiemann die erste Generation der Osteuropahistoriker. Während Hoetzsch die Tradition der preußisch-deutschen Russlandbindung repräsentierte, stand Schiemann für den Bruch mit dem Zarenreich im Geist des neuen russisch-deutschen Antagonismus. Der baltendeutsche Historiker übte Einfluss aus als Herausgeber der neuen «Zeitschrift für osteuropäische Geschichte», vor allem aber durch seine politischen Kanäle zum Beispiel ins Auswärtige Amt und zum Reichskanzler Bernhard von Bülow (1849–1929). Bülow hatte schon als Botschaftsrat in Petersburg in den 1880er Jahren eine Linie vertreten, die von der traditionellen Russlandorientierung nichts mehr wissen wollte und das Zarenreich als gefährlichsten Gegner Deutschlands einstufte. An seinen Freund Friedrich August von Holstein (1837–1909), Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt und ebenfalls Gegner der Bismarck’schen Russlandpolitik, schrieb Bülow einen Brief, der aus einer fundamentalen Russland-Feindschaft heraus ein funktionales Interesse an ukrainischen Territorien erkennen ließ: «Wenn wir mit Rußland kämpfen, so dürfen wir nicht Frieden schließen, ohne dasselbe nicht für mindestens eine Generation unfähig zum Angriff auf uns gemacht zu haben. Wir müssen eventuell dem Russen so viel Blut abzapfen, daß derselbe […] 25 Jahre außerstande ist, auf den Beinen zu stehen. Wir müßten die wirtschaftlichen Hilfsquellen für lange hinaus durch Verwüstung seiner Schwarzerd-Gouvernements, Bombardierung seiner Küstenstädte, möglichste Zerstörung seiner Industrie und seines Handels zuschütten. Wir müssen endlich Rußland von jenen beiden Meeren, der Ostsee und dem Pontus Euxinus, abdrängen, auf denen seine Weltstellung beruht.»[21]
Dass ukrainische Gebiete im politischen Diskurs Deutschlands überhaupt genannt wurden, entsprang nur der geopolitisch motivierten Russland-Feindschaft des Autors. Selbst Bülow hatte aber für die Ukraine keinen anderen Namen als «Schwarzerd-Gouvernements». Bismarck bezeichnete den Erguss Bülows als «exzentrische Konjekturen, die man nicht zu Papier bringen sollte».[22]
Neben Schiemann gab es weitere Baltendeutsche wie den Mediävisten Josef Haller und den Publizisten Paul Rohrbach, die publizistisch gegen Russland trommelten. Die Wahrnehmung des russischen Imperiums als «Koloss auf tönernen Füßen» war hier weit verbreitet, auch der Plan, das Zarenreich «aufzubrechen», um nicht-russische Ethnien zu befreien. Aber solche Phantasien waren zunächst nicht auf die Befreiung der Ukraine gerichtet, sondern auf die Annexion der baltischen Provinzen. Paul Rohrbach bereiste vor dem Weltkrieg das Zarenreich. Ihm wird in der Literatur immer wieder eine Vorreiterrolle für eine deutsche Geopolitik zugeschrieben, die die Ukraine als Schlüssel für die «Aufbrechung» Russlands sah. «Wenn Rußland noch fünfzig Jahre in Ruhe bleibt, kann es vielleicht sein, dass die ukrainische Frage einschläft, trotzdem die ukrainischen Patrioten sich bemühen, sie wach zu machen.» Wenn aber in einem künftigen Krieg von deutscher Seite die ukrainische Bewegung losgebunden werde, «dann, ja dann könnte Rußland zertrümmert werden. Wer Kijew hat, kann Rußland zwingen.» Dieses Motto, das Rohrbach in einem Reisebericht von 1897 formuliert haben wollte, könnte über der Ukrainepolitik Deutschlands im Ersten Weltkrieg stehen.[23] Doch hat Rohrbach diese Sätze erst im Nachhinein – erst während des Weltkriegs – in den Reisebericht eingefügt, um als Visionär einer freien Ukraine dazustehen. Tatsächlich interessierte sich auch er wie die anderen Baltendeutschen vor dem Krieg in erster Linie für die Ostseeregion, ferner für Polen und den Kaukasus, nicht für die Ukraine.[24]
Diese Denkbilder des «gouvernementalen Imperialismus» (Fritz Fischer) bekamen Unterstützung von unerwarteter Seite: Mit ihrem «Radau- und Rassenimperialismus» versuchten auch die Alldeutschen einen Bruch in der deutschen Außenpolitik zu erzwingen. Vor dem Ersten Weltkrieg existierte in der deutschen Politik und der Publizistik dennoch keine Vorstellung davon, welche Rolle die Ukraine in Zukunft spielen könnte. Das galt auch für die Sozialdemokraten, die aus ganz anderen Gründen als die Alldeutschen ein negatives Russlandbild hatten. Sie erinnerten das Zarenreich als «Gendarm Europas», der sich im 19. Jahrhundert immer wieder mit gleichgesinnten Monarchien in Europa gegen revolutionäre Bestrebungen zusammengetan hatte. Eine ausgeprägte Solidarität mit der ukrainischen Nationalbewegung gab es aber bei den Sozialdemokraten nicht. Im gesamten politischen Spektrum des Kaiserreichs formulierte keine Partei eine «ukrainische Frage», die nach einer Lösung verlangte. Zwar war die traditionelle preußisch-deutsche Russlandorientierung in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg umkämpft, aber selbst jene kleine einflussreiche Gruppe baltendeutscher Historiker und Publizisten, die von einer Zurückdrängung des Zarenreichs in Europa träumte, dachte dabei nicht an die Ukraine. Deshalb gab es beim Kriegsausbruch keine ausgearbeiteten Vorstellungen davon, was mit der Ukraine geschehen könnte, wenn Deutschland den Krieg gewinnen würde.[25]
Während die Mittelmächte für den Kriegsschauplatz im Westen genaue Ziele hatten, blieben die Ideen für das östliche Europa im Unbestimmten. Nur für Polen gab es Pläne: Der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg sah es als formal gleichberechtigtes Mitglied in einem künftigen «mitteleuropäischen Wirtschaftsverband».[26] Die Ukraine spielte in den offiziellen deutschen Plänen keine vergleichbare Rolle. Sie war noch 1914 für die deutsche Politik eine terra incognita, auch wenn sie gelegentlich als potentieller Pufferstaat gegen Russland genannt wurde.