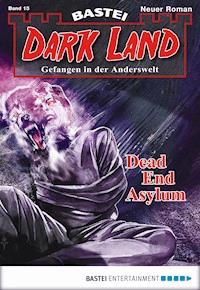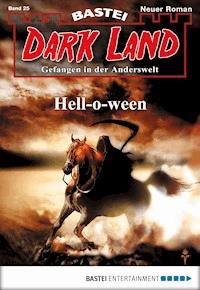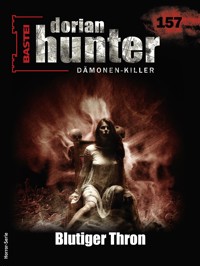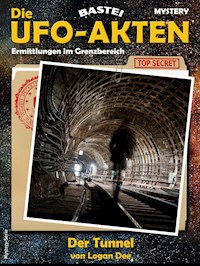
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die UFO-AKTEN
- Sprache: Deutsch
New York - eine der größten Metropolen der Welt.
Leuchtreklamen zieren die Wolkenkratzer, die Straßen sind voll mit Autos, und überall wimmelt es nur so von Menschen.
Doch es gibt auch ein Reich unter der Stadt, von dem nur wenige wissen. Ein Reich der Stille, der ewigen Nacht. Ein Obdach der Verlorenen.
Die Tunnel. Stillgelegte U-Bahnschächte und Abwasserkanäle, in denen Menschen ihr Leben fristen, die von der Welt da oben verstoßen wurden und in der Abgeschiedenheit nun ihren Frieden suchen. Menschen ... und Kreaturen!
Seit zehn Jahren lebt Clapton nun dort. Eines Tages stößt er auf ein Graffito. Menschen werden darauf von merkwürdigen biomechanischen Wesen bedroht. Ein schreckliches Motiv! Aber was noch viel erschreckender ist: Einer der Menschen auf diesem Graffito ist er selbst!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Tunnel
UFO-Archiv
Vorschau
Impressum
Logan Dee
Der Tunnel
Seit zehn Jahren lebt Clapton nun in der New Yorker Unterwelt und kennt sich wie kein anderer in diesem Labyrinth aus stillgelegten U-Bahnschächten und Abwasserkanälen aus.
Mittlerweile fühlt er sich hier unten sogar richtig geborgen, und ihn überkommt nur noch selten der Wunsch, an die Oberfläche zurückzukehren. Manchmal ist es natürlich unumgänglich, um sich Nahrung oder neue Decken zu beschaffen. Doch stets versucht er, diese Aufenthalte dann möglichst kurz zu gestalten.
Das ändert sich, als Clapton in den Tunneln auf ein Graffito stößt, auf dem Menschen von biomechanischen Wesen attackiert werden. Plötzlich ist alles anders. Das Bild erinnert ihn nämlich an etwas Schreckliches, das er längst verdrängt zu haben glaubte...
Man war dort oben nie sicher, in einem unachtsamen Moment nicht ein Messer in den Rücken oder zumindest einen Tritt in die Rippen zu bekommen. Heutzutage gab es dort oben Gangs, die selbst jemanden wie ihn nicht in Ruhe ließen. Früher hätte man einen Bettler in Frieden gelassen oder ihm sogar ein paar Cents hingeworfen. Heute töteten sie dort oben aus purer Lust.
Nein, er fühlte sich hier unten viel geborgener. Es war friedlich hier. Und wenn er eines Tages sterben würde, dann würde es ein natürlicher, friedlicher Tod sein. Er spürte, dass dieser Tag nicht mehr allzu fern war.
Wenigstens hatte er bis vor ein paar Tagen so gedacht.
Dann war er auf ein Graffito gestoßen. Hier unten in den Schächten gab es mehr Graffiti als oben auf den Straßen. Und mehr Graffitikünstler. Zumeist erzählten die Bilder von einem besseren Leben und einer heileren Welt.
Aber das Graffito, auf das er gestoßen war, war anders gewesen. Es hatte ihn an etwas erinnert, das er tatsächlich längst verdrängt zu haben glaubte.
Das Graffito erinnerte ihn an die Bilder seines Freundes Steinway. Auch Steinway hatte damals, vor seinem Tod, diese merkwürdigen biomechanischen Wesen an die Wände gesprüht. Aber Steinway war tot, und jetzt tauchte ein Graffito auf, das seinen so ähnlich war. Es musste nicht wirklich etwas zu bedeuten haben. Ebenso gut konnte irgendein Künstler Steinways Stil von damals kopiert haben ...
Der Künstler besaß unzweifelhaft Talent: Der Schrecken auf den Gesichtern der Menschen, die von den biomechanischen Wesen bedroht wurden, war so lebensecht dargestellt, dass man glaubte, im nächsten Moment ihre Schreie zu hören. Aber was noch viel erschreckender war:
Er selbst war auf diesem Graffito abgebildet! Und er kannte auch die anderen Personen! Es war eine Tunnelszene, und einige der Leute waren ihm vertraut. Sie lebten wie er hier unten. Wer immer dieses Graffito gesprüht hatte, er musste sich auskennen.
Die Menschen, die er darauf abgebildet hatte, waren in Gefahr. Er war in Gefahr! Das spürte er. Seine Instinkte waren in all den Jahren geschärft worden. Auf sie konnte er sich mehr verlassen als auf sein Gehör oder seine Augen. Und jetzt meldete sein Instinkt GEFAHR.
Er war zurück in seine Behausung gelaufen, eine fünfzehn Quadratmeter große Nische, die er seit zehn Jahren bewohnte und an deren Wänden alle möglichen Rohrleitungen verliefen. Er wusste nicht, was es für Rohre waren. Ab und zu hörte er ein Gluckern in ihnen, manchmal ein Zischen. Aber es hatte ihn auch nie interessiert.
Seine Nische war fast komfortabel eingerichtet. Es befand sich sogar eine richtige Matratze darin. In all den Jahren hatte er sich nach und nach alles vom Sperrmüll besorgt und hier heruntergeschafft.
Schon vor Jahren hatte er Fallen angelegt. Damals war es öfters vorgekommen, dass Jugendbanden von oben hier unten rumgestöbert und Jagd auf die Tunnelmenschen gemacht hatten. Es war wohl eine Art Sport gewesen, und nach einiger Zeit war man dieser Freizeitbeschäftigung anscheinend wieder überdrüssig geworden. Jedenfalls war es immer seltener vorgekommen, dass sich jemand von oben hier herunter traute.
Aus jener Zeit stammten jedenfalls die Fallen. Sie waren nicht aktiviert, aber das holte er nun nach. Er kannte Techniken, die ihm auch hier unten das Leben sicherten.
Eine davon nannte er den »Weg der Fallen«. Wer immer sich seiner Behausung nun heimlich näherte, würde sich wundern. Eine erste Falle würde den Eindringling nur erschrecken, ihm symbolisieren: Halt! Bis hierher und nicht weiter! Wenn er dennoch weiterging, würde eine zweite Falle zuschnappen. Ließ er sich auch davon nicht abhalten ... Ab der dritten Falle begann es wirklich ernst zu werden. Und die letzte wäre tödlich.
Beruhigt war er in jener Nacht eingeschlafen. Dennoch verfolgte ihn das schreckliche Graffito bis in seine Träume. Aber was noch schlimmer war, das waren die Stimmen, die sich in seinem Kopf einnisteten.
Und die er nie wieder loswurde.
»Alle guten Präsidenten waren am Anfang ihrer Karriere gute Senatoren.«
Ronald Reagan
Maine, genauer Aufenthaltsort geheim17. September 2021, 21:47 Uhr
»Ein Rendezvous mit einem Senator habe ich mir immer irgendwie anders vorgestellt«, sagte Judy Davenport.
»Du meinst mit Kerzenschein und einer Einladung zum Dinner?«, grinste Cliff Conroy.
»Nein, ich meine, nicht in einer so gottverlassenen Gegend wie dieser hier.«
Sie fuhren seit zwei Stunden. Die Dämmerung war allmählich in Dunkelheit übergegangen und die Felder in immer dichter werdende Wälder. Die letzten richtigen Häuser hatten sie vor einer Stunde hinter sich gelassen. Seitdem waren sie nur auf einige Hochsitze und Jagdhütten gestoßen. In diesem Teil Maines schien kaum eine Menschenseele zu hausen. Nirgendwo ein Anzeichen dafür, dass sie noch auf dem richtigen Weg waren.
»Eine Nacht in den Wäldern von Maine«, sagte Cliff. »Das wäre doch auch mal was. Wir könnten ein Zelt aufschlagen und durch die Baumwipfel den Sternenhimmel betrachten.«
»Nur den Sternenhimmel? Oder noch mehr?«
Cliff ging nicht weiter auf diese Andeutung ein, dass da oben etwas anderes sein könnte als nur die Sterne und der zunehmende Mond, und auch Judy schwieg, als ihnen beiden der Ernst ihres Ausflugs wieder bewusstwurde.
Der Weg wurde zunehmend holpriger und schmaler, und Cliff hatte alle Mühe, den großen Winnebago-Campingwagen sicher in der Spur zu halten.
»Vielleicht hätten wir doch vorhin an der Abzweigung links fahren müssen«, gab Judy zu bedenken.
»Die Einsicht, wenn sie denn richtig ist, kommt leider zu spät«, erwiderte Cliff. »Ich kann hier nirgends wenden.«
Äste und Zweige strichen wie Gespensterhände über die Windschutzscheibe. Der Weg war so schmal geworden, dass höchstens noch eine Zeitung zwischen den Winnebago und die links und rechts aufragenden Bäumen gepasst hätte. Aus dem Radio erklang Neil Youngs »Song X«: Hey ho away we go – we're on the road to never ...
»Irgendwie passend«, bemerkte Judy.
»Immerhin besser als Highway to Hell«, entgegnete Cliff sarkastisch.
»Ich würde jetzt mehr für Island in the Sun plädieren.«
Die Flachserei, mit der sie beide die Atmosphäre ein wenig aufzulockern versuchten, wollte nicht recht wirken. Es war, als würde sie jeder neue Meter hinein in diesen Wald sie stimmungsmäßig weiter nach unten ziehen. Aber es hatte nicht wirklich etwas mit dem Wald zu tun, sondern mit dem, was sie erwartete ...
Der Song im Radio wurde von einem störenden Knistern überdeckt. Judy drückte den Sendersuchlauf, was zur Folge hatte, dass plötzlich nur noch Knistern zu hören war.
»Seltsam«, sagte sie. »Als ob hier irgendein Störsender in der Nähe wäre ...«
Cliff warf ihr einen skeptischen Seitenblick zu. Judy versuchte es per manueller Einstellung, aber nach wie vor waren nur ein Rauschen und Knistern zu hören.
»Ich glaube, ich höre etwas«, sagte sie plötzlich.
»Ich nicht.«
»Das Rauschen ist zu laut.« Sie presste ein Ohr gegen den Lautsprecher. »Ich höre eine Stimme.«
Cliff sah sie noch skeptischer an. Was sonst sollte aus dem Radio kommen? Er konzentrierte sich wieder auf den Weg vor ihnen und fluchte. »Es hat keinen Zweck. Wenn wir weiterfahren, bleiben wir womöglich ganz stecken.« Er brachte den schweren Winnebago zum Stehen.
»Jetzt kann man es besser verstehen«, sagte Judy. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Du meinst die Stimme? Wahrscheinlich ein Nachrichtensprecher«, mutmaßte Cliff. Noch immer war er mit seinen Gedanken eher bei dem Problem, ob sie weiterfahren sollten oder nicht.
»Kein Nachrichtensprecher«, erwiderte Judy, und dann hörte es auch Cliff. Aus dem Rauschen und Knistern bahnte sich deutlich eine Stimme den Weg an die Oberfläche der Wahrnehmung.
»Er sagt, dass wir weiterfahren sollen«, flüsterte Judy, die noch immer ihr Ohr an den Lautsprecher gepresst hielt. »Dass wir auf dem richtigen Weg sind ...«
Dann war die Stimme plötzlich ganz deutlich zu hören, und was sie sagte, klang wie ein eindeutiger Befehl:
»Fahren Sie weiter geradeaus. Nach einer Meile werden Sie auf einen Wegweiser stoßen. Ende.« Damit schien die Durchsage beendet. Auch das Rauschen und die atmosphärischen Störungen verstummten, und es war wieder Musik zu hören.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Judy.
Cliff zuckte mit den Achseln. »Offensichtlich ein kleiner Trick, um uns zu beeindrucken, schätze ich.«
Er war sich immer noch nicht sicher, ob sich hinter diesem Treffen nicht eine Falle verbarg.
Es war im Grunde ein Witz! Eine DVD, die den »GhostRider«-Akten beilag und die sie erst auf »Buzz'« Anweisung in Cliffs Computer hatten einlegen dürfen, hatte lediglich den Namen und die Telefonnummer eines US-Senators beinhaltet.
Okay, es mochte ein Fingerzeig gewesen sein, aber ebenso gut war eine weitere Finte möglich. »Buzz« hatte sich bei den Vorgängen in Uncton jedenfalls nicht als sehr hilfreich erwiesen – nachdem er sie mit der UFO-Akte in dieses Schlamassel erst hineingeritten hatte.
Allerdings war die Telefonnummer in Washington D.C. echt gewesen. Zwar hatte sich der Senator nicht direkt gemeldet – damit hatte Cliff auch nicht wirklich gerechnet –, aber jemand aus seinem Vertrautenkreis hatte ihnen diesen gottverlassenen Ort als Treffpunkt genannt.
»Vielleicht will man uns auch nur ermutigen, nicht aufzugeben«, spekulierte Judy. Sie dachte generell positiver als ihr Partner. Insofern waren sie ein Gespann, das sich auch in dieser Hinsicht optimal ergänzte. Überhaupt hätte man Judy Davenport und Cliff Conroy auf den ersten Blick für ein gut harmonierendes Paar halten können – allein vom Aussehen her:
Cliff war Mitte 30 und 1,82 Meter groß, schlank und drahtig. Seine Figur, sein dunkelbraunes Haar und vor allem seine grauen Augen mochten auf viele Frauen sehr attraktiv wirken. Selbst seine vor langer Zeit gebrochene Nase passte in dieses Gesicht und gab ihm eine interessante, individuelle Note.
Judy war Anfang 30 und reichte Cliff bis zur gebrochenen Nase. Sie war 1,69 Meter groß und von schlankem Wuchs, hatte fast schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Man sah ihr die arabischen Vorfahren deutlich an. Vielleicht war es das, was die meisten Männer besonders an ihr reizte.
»Ich werde mit dem Motorrad weiterfahren und auskundschaften, ob der Weg überhaupt irgendwohin führt«, entschied Cliff.
»Ich komme mit«, sagte Judy spontan. »Kommt nicht in Frage, mich hier allein zurückzulassen!«
»Aber ...«
»Keine Widerrede!«
Cliff seufzte. In diesem Fall lohnte es sich kaum, einen Streit zu beginnen. Bevor sie ausstiegen, verstaute er die »GhostRider«-Akten samt der DVD in dem kleinen Safe im Boden des Kleiderschranks, in dem auch seine .357 Magnum untergebracht war. Für einen Moment überlegte er sich, den Revolver mitzunehmen, dann entschied er sich aber dagegen.
Außer der Strecke, die von den Scheinwerfern aus der Dunkelheit gerissen wurde, herrschte draußen stockfinstere Nacht. Der dunkle, endlose Wald rings um sie herum erinnerte Cliff an eine Mauer, die langsam näher rückte und sie irgendwann unweigerlich erdrücken musste. Sie waren die einzigen Menschen weit und breit ...
Judy schlug die Arme um sich, als friere sie. Bei den hier herrschenden Temperaturen – um die 10 Grad Celsius – nur zu verständlich, aber es war wohl mehr ein innerlicher Schauder, der sie frösteln ließ. Im Inneren des Wagens war sie sich sicherer vorgekommen. Es war zwar eine scheinbare Sicherheit gewesen, aber immerhin ...
Hier draußen fühlte sie sich, als würde man sie beobachten.
Sie trat dicht an Cliff heran.
»Ich hoffe, wir machen keinen Fehler«, flüsterte sie. Natürlich hatten sie darüber diskutiert, ob sie der ominösen Einladung folgen sollten oder nicht. Aber »Buzz« hatte bislang kein falsches Spiel mit ihnen getrieben. Und im Grunde hatten sie keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen.
Wie »Buzz« gesagt hatte: Sie saßen in einem fahrenden Zug, und es war längst zu spät, auszusteigen. Die NSA war auf ihrer Spur, auch wenn sie ihren Spürhund Jeremy McKay zwischenzeitlich abgehängt hatten – oder dies zumindest hofften.
Cliff schüttelte den Kopf. »Wir müssen Campbell vertrauen – eine andere Chance haben wir nicht. Aber vielleicht hat noch jemand von unserem Treffen Wind bekommen. Ich habe ein ungutes Gefühl.«
Sie lauschten in die Nacht hinein, aber außer den natürlichen Geräuschen des nächtlichen Waldes und seiner Bewohner war nichts zu hören.
Cliff trat zum Heck des Winnebagos, wo die Kawasaki befestigt war. Ursprünglich war sie zum Vergnügen gedacht gewesen, aber auch in einer Situation wie dieser konnte sich das geländegängige Motorrad bewähren.
Cliff löste die Befestigungen, während Judy aus dem Wageninneren die Helme holte und die Sicherheitsverriegelung des Winnebagos betätigte.
Innerhalb von zwei Minuten waren sie startbereit. Judy nahm hinter Cliff Platz, obwohl sie die Maschine selbst hätte fahren können. Sie hielt sich nicht an ihm fest, sondern am Bügel des Sitzes.
Cliff startete. Aufröhrend setzte sich die Kawasaki in Bewegung. Trotz der guten Federung war es eine Fahrt wie auf einem Rodeo-Bullen.
Bereits nach wenigen Metern konnte man nicht mehr von einem Weg sprechen. Es war ein nur mit Mühe der Wildnis entrissener Pfad, holprig und voller tückischer Löcher. Äste und Zweige schlugen gegen die Visiere ihrer Helme. Ein im Weg liegender Stein ließ die Kawasaki fast einen halben Meter in die Luft hüpfen, sodass Judy ihre ursprüngliche Zurückhaltung aufgab und beide Arme um Cliffs Taille schlang.
»Geht es nicht noch ein bisschen schneller?«, schrie sie ironisch, aber Cliff antwortete nicht. Er musste seine gesamte Konzentration aufbringen, um nicht vom Weg abzukommen. Außerdem war es müßig, Judy erklären zu wollen, dass sie auf dieser Strecke und bei diesem Tempo die Löcher und Unebenheiten sicherer überfuhren, als wenn er sich im Schneckentempo vorgetastet hätte.
Der Pfad wurde noch schmaler, und schließlich standen sie vor einem undurchdringlichen Gebüsch, das jedes Weiterkommen unmöglich machte.
»So viel zum Thema ›Botschaften aus dem Radio‹!«, knurrte Cliff.
Da sah er plötzlich das Signal. Es war ein rotes, blinkendes Licht irgendwo im Gehölz des Waldes.
»Wir müssen zu Fuß weiter«, sagte Cliff. Er schaltete den Motor der Kawasaki aus und stieg ab.
Langsam gingen sie auf den Lichtschein zu und bahnten sich den Weg durch dichtes Buschwerk.
Plötzlich hörten sie einen Ruf aus Richtung des Lichts.
»Hierher!«
Irgendwie war es beruhigend, in dieser Einsamkeit eine menschliche Stimme zu hören; ganz gleich, wem sie gehören mochte. Sekunden später hatten Cliff und Judy den Mann erreicht. Er stand auf einer kleinen Lichtung und hielt das rote Signallicht von sich gestreckt. Es malte gespenstische Schemen in sein bärtiges Gesicht.
»Miss Davenport? Mr. Conroy?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
»Wer sind Sie?«, fragte Judy.
»Keine Fragen. Nicht jetzt. Folgen Sie mir einfach.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte der Mann sich um, leuchtete mit einer starken Taschenlampe den Boden ab und folgte dann einem Trampelpfad, der zwischen den hohen Bäumen hindurchführte. Cliff und Judy folgten ihm schweigend.
Im Widerschein der Lampe gelang es Cliff, ihren Wegbegleiter genauer zu betrachten. Er trug eine legere Kleidung, unter der sich Muskelpakete abzeichneten. Außerdem war er offensichtlich bewaffnet; Cliff konnte deutlich eine Ausbeulung unter seiner Jacke in Höhe der linken Achsel ausmachen. Der Haarschnitt des Mannes war militärisch kurz, sein Bart kurz und sauber ausrasiert.
Nach ein paar Schritten öffnete sich der Pfad unvermittelt zu einer zweiten Lichtung, an deren Rand sich eine vom Mond beschienene Jagdhütte befand. Hinter den Fensterscheiben brannte Licht.
Der Mann mit der legeren Kleidung hielt auf die Hütte zu, während sich das mulmige Gefühl in Cliffs Bauch verstärkte. Alles hier schien perfekt inszeniert zu sein. Er kam sich vor wie eine Marionette, an deren Fäden man beliebig ziehen konnte. Hilflos.
Dieser Eindruck verstärkte sich, als zwei weitere Männer aus dem Schatten des Gebäudes traten. Sie waren vom gleichen Kaliber wie der Mann, der sie hierhergeführt hatte. Es waren wahrhaftige Leibwächtertypen, mit denen im Falle einer Auseinandersetzung nicht zu spaßen sein würde.
»Parole?«, klang eine dunkle Stimme auf – zusammen mit dem Klacken, das entsteht, wenn man einen Revolverhahn spannt.
Ihr Wegbegleiter blieb stehen. »Nightwatch.«
»Okay.«
Die beiden Muskelmänner gaben den Weg frei.
In der Blockhütte hatte man offensichtlich ihr Kommen registriert. Die Tür schwang auf, und ein weiterer Leibwächter ließ sie passieren.
Im ersten Moment schlossen Cliff und Judy geblendet die Augen. Im Inneren der Jagdhütte herrschte eine fast gleißende Helligkeit.
»Willkommen in meiner bescheidenen Hütte!«, sagte eine Stimme. Cliff schätzte den Mann, dem sie gehörte, auf Ende vierzig. Er trug das graumelierte Haar sauber gescheitelt und ein strahlendes Lächeln zur Schau. Seine Zähne waren eine Spur zu weiß und sein Gesicht eine Spur zu braun, um natürlich zu wirken. Sein Holzfällerhemd und seine Jeans konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um teure, wohlkalkulierte Designerkleidung handelte.
Unter anderen Umständen hätte dieser Mann vielleicht sogar natürlich oder sympathisch gewirkt. Im gleißenden Licht der Blockhütte kam Cliff alles an ihm dennoch seltsam unecht vor.