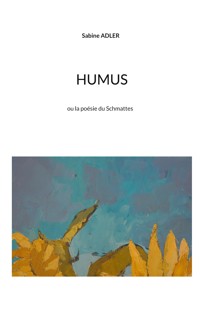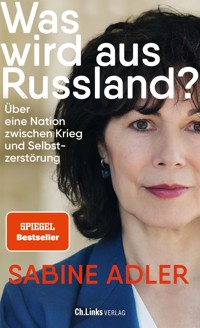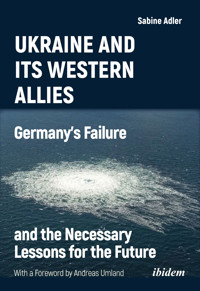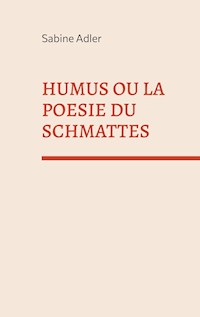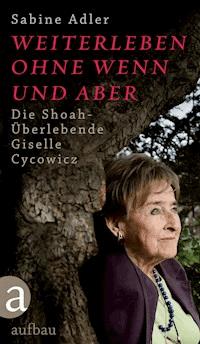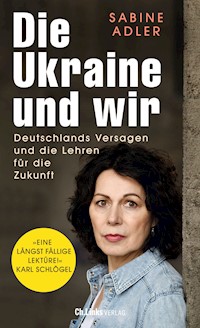
14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Selten treffen langjährige Kenntnis vor Ort und Vertrautheit mit der Geschichte des Schauplatzes so sehr aufeinander wie in Sabine Adlers Ukraine-Buch. Besonders für das deutsche Publikum eine längst fällige Lektüre!« Karl Schlögel.
Der Krieg in der Ukraine stellt das politische und wirtschaftliche Handeln Deutschlands auf den Prüfstand. Jahrzehntelang wurde über den zweitgrößten Staat Europas hinweggeschaut und Russland hofiert. Mit fatalen Folgen. Deutschland hat versagt, konstatiert die Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Ihre Analyse nimmt nicht nur die Ukraine und den aktuellen Krieg in den Blick, sondern vor allem Deutschlands Rolle – wirtschaftlich, politisch, medial – in Bezug auf das von Russland überfallene Land. Als langjährige und hellsichtige Beobachterin zieht sie eine kritische Bilanz: politische Versäumnisse, Lobbyismus, Doppelmoral und ein verlogener Pazifismus waren über weite Strecken bestimmend. Zeit, daraus zu lernen und einen radikalen Kurswechsel einzuleiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sabine Adler
Die Ukraine und wir
Sabine Adler
Die Ukraine und wir
Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Aufbau Digital,
veröffentlicht in der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
Die Originalausgabe erschien 2022 im Ch. Links Verlag, einer Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG.
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,
Foto © Natascha Zivadinovic
ISBN 978-3-96289-180-0
eISBN 978-3-8412-3104-8
Inhalt
Vorwort
Das Trauerspiel
Tschetschenien als Blaupause für die Ukraine
Putin, Schröder, Warnig – ziemlich clevere Freunde
Merkels Nein zu Kiews NATO-Mitgliedschaft
Die Ukraine – ein Juwel in Putins Zarenkrone
Das Krim-Referendum – eine Abstimmung unter russischer Besatzung
Von Sanktionen und Sanktiönchen
Faschisten, Patrioten und Pazifisten
Bahr, Eppler, Schmidt und Schröder – das Quartett der eitlen Alten
Deutsche Geschäfte im Sinne des Kremls
Russlandtag und Klimastiftung
Gefährlicher Hobbyhistoriker – Putin erklärt die Einheit von Russen und Ukrainern
Leerstellen – Stalins Terror und der unbekannte Holocaust
Einseitige Rücksichtnahme aufgrund selektiver Erinnerung
Mehr als nur Kunstraub – der Beutezug der Nazis durch die Ukraine
Merkels kalter Abschied, der zähe Start von Bundeskanzler Scholz und ein versenkter Joker
Die Zeitenwende-Rede
Und in Zukunft?
Quellen
Dank
Die Autorin
Vorwort
Den Krieg in der Ukraine hat niemand vorhergesehen, zumindest nicht in dem Ausmaß, nicht in der Brutalität. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin erneut Truppen in das westliche Nachbarland einmarschieren lassen würde, war jedoch anzunehmen. Immer mehr russische Soldaten wurden zu Manövern an die Grenze geschickt und danach entgegen internationaler Verpflichtungen nicht wieder abgezogen. Moskau gab sich nicht einmal die Mühe, so zu tun, als ob.
Am 24. Februar 2022 begann die russische Invasion in die Ukraine als Überfall von drei Seiten.
Die USA hatten die Öffentlichkeit Monate im Voraus detailliert gewarnt. Die Bundesregierung versuchte nach Kräften, gemeinsam mit der Europäischen Union und den USA Wladimir Putin von seinem immer aggressiver werdenden Kurs gegenüber der Ukraine und der NATO abzubringen. Aber auf die unmittelbare Not der Ukraine und auf die Bitte, ihr sofort zu helfen, reagierte Deutschland spät und anhaltend zögerlich.
Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Was haben wir übersehen? Welche Fehler wurden in Deutschland und in der Europäischen Union gemacht? Diese Fragen werden seit Beginn des Krieges in der Öffentlichkeit heftig diskutiert und stehen im Zentrum dieses Buchs. Für die Beantwortung reicht es nicht, nur auf die aktuelle Situation zu schauen. Dafür muss auch in die Geschichte zurückgeblickt werden. Nicht nur bis 2014, als Putin die Krim okkupiert und den Krieg in der Ostukraine angeheizt hat, nicht nur bis 2013, als die Ukraine das EU-Assoziierungsabkommen nicht unterzeichnete, oder bis 2008, als der Ukraine und Georgien der NATO-Beitritt verwehrt wurde. Und selbst über 2005 hinaus, das Jahr, in dem der Gerade-noch-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Wladimir Putin das erste Nord-Stream-Projekt auf den Weg gebracht hat, muss Rückschau gehalten werden: bis zu den Tschetschenienkriegen, bis zum Zerfall der Sowjetunion, von der eben nicht nur Russland übriggeblieben ist, und selbstverständlich bis zum Zweiten Weltkrieg, aus dem sich Deutschlands Verantwortung für die Ukraine in ganz besonderer Weise ergibt. Sie ist bis heute nicht vollumfänglich wahrgenommen worden.
Die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre habe ich als Korrespondentin sowohl von Russland als auch von der Ukraine sowie von Berlin aus beobachtet. Dieser regelmäßige Perspektivwechsel zwischen Deutschland und Osteuropa hat meine Wahrnehmung unseres Verhältnisses zu der bedrängten Ukraine geprägt. Auch davon wird in diesem Buch die Rede sein.
Sabine Adler, Berlin im Juni 2022
Das Trauerspiel
… beginnt mit einem Witz, bei dem einem das Lachen im Hals steckenbleibt. Fast ein Jahr lang wird die Welt Zeuge eines gigantischen russischen Truppenaufmarsches entlang der ukrainischen Grenze. Im Januar 2022 stehen dort mindestens 130 000 bis an die Zähne bewaffnete Soldaten. Angesichts dieser Bedrohung wird die Bitte der Ukrainer um deutsche Waffen lauter und dringlicher. Am 19. Januar fragt die Regierung in Kiew erneut nach und wird präzise: Kann Deutschland mit Helmen und Schutzwesten helfen? Später erweitert der ukrainische Botschafter in Berlin Andrij Melnyk die Liste um Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme. In der Hauptstadt stellt man sich taub.
Die Ohren stehen schon seit 2014 auf Durchzug. Nur bei Einzelnen, sehr wenigen, kommen die Hilferufe an. Robert Habeck zeigt sich offen. Im Mai 2021 – noch vor dem Bundestagswahlkampf – war er an der Front in der Ostukraine. Dort nimmt der grüne Realo nicht nur den Krieg, der seit sieben Jahren nicht enden will, in Augenschein, sondern hört auch die Nöte der ukrainischen Bevölkerung an der Demarkationslinie zu den Separatistengebieten. Noch auf der Reise macht er sich stark für die Menschen, die um Unterstützung für ihre Verteidigung gegen die prorussischen Besatzer bitten. »Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, kann man meiner Ansicht nach der Ukraine schwer verwehren«, sagte er dem Deutschlandfunk. »Die Ukraine fühlt sich sicherheitspolitisch alleingelassen, und sie ist alleingelassen.«
In Deutschland wird er dafür mit Schimpf und Schande empfangen. Die damals CDU-geführte Bundesregierung verweist auf den Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Eine politische Linie, die auch Habecks Co-Vorsitzende bei den Grünen vertritt. Anders als der Ex-Parteichef Jürgen Trittin distanziert sich Annalena Baerbock zwar nicht offen, aber doch vernehmlich genug von Habeck: »Das steht auch in unserem Programm, und das sehen wir als Parteivorsitzende beide so.« Habeck lenkt der Kanzlerkandidatin Baerbock zuliebe ein.
Im Unterschied zu dem Grünen plagen den damaligen SPD-Fraktionsvize Sören Bartol keine Zweifel. Anders als Habeck hat er die Ukraine noch nie besucht, genauso wenig wie die allermeisten Bundestagsabgeordneten, nicht vor und nicht nach der Annexion der Krim, nicht während der Kämpfe im Osten, nicht seit Russlands Einmarsch. Bei Habeck sehe man, wohin solch eine Reise führe: »Habeck besucht die Ukraine und schon kündigt er den Konsens auf. Das ist naiv.« Deutschland sei gut beraten, auf Diplomatie zu setzen.
Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD warnt am 21. April 2022 in der Berliner Zeitung ebenfalls vor Ukraine-Reisen. Nicht, weil dort Krieg herrscht und es zu gefährlich wäre, sondern weil Anton Hofreiter (Bündnis 90 / Die Grünen), Agnes-Marie Strack-Zimmermann (FDP) und Michael Roth (SPD) voller Emotionen und mit Forderungen in Richtung Bundesregierung zurückgekommen seien, was nun wirklich nicht hilfreich sei. Strack-Zimmermann, die als weitaus fähigere Verteidigungsministerin gilt, als es Müllers Parteifreundin Christine Lambrecht ist, redet daraufhin im Tagesspiegel Klartext: »Gerne biete ich dem Neu-Sicherheitsexperten Michael Müller an, Emotionen zu entwickeln, um zu verstehen, dass ein brutaler Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nichts ist, was uns kaltlassen kann.«
Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen empört Habecks Empathie mit den Ukrainern, die seit sieben Jahren die Okkupanten im Osten ihres Landes, wenn schon nicht verdrängen, so doch an einem weiteren Vormarsch hindern wollen. »Wer von Russlandhass verblendet die ultrarechten Milizen in der Ukraine ignoriert und behauptet, das Land verteidige die Sicherheit Europas und müsse daher aufgerüstet werden, ist eine reale Gefahr für die Sicherheit in Deutschland und Europa.« Nicht von Russland, sondern von Habeck, Strack-Zimmermann, Roth, Hofreiter, kurz von jenen, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen den Aggressor helfen wollen, geht für Die Linke die eigentliche Sicherheitsgefahr aus. Dagdelen ist nicht die Einzige, die es lieber sähe, wenn sich die Ukrainer Putin opferten, in der Hoffnung, dass sein Appetit dann gestillt wäre. Sie verkaufen das als Friedenslösung und verweisen zudem auf Deutschlands historische Verantwortung. Daria Kaleniuk kann es nicht mehr hören. Die junge Ukrainerin, die das Kiewer Anti-Corruption Action Center leitet, bringt es auf die Palme, dass sich Deutschland wegen seiner Täterrolle im Zweiten Weltkrieg bei der militärischen Zusammenarbeit zurückhält, sie findet, dass das »eine der dümmsten Aussagen ist, die je gemacht wurden«. Auf Twitter fragt sie bereits im Januar 2022: »Deutschlands Geschichte hat schon einmal Millionen Ukrainer ums Leben gebracht, und jetzt sollen wegen Deutschlands Geschichte weitere sterben?«
Im Auswärtigen Amt liegt derweil Kiews Liste mit den benötigten Waffen, Helmen und Schutzwesten, doch das Ministerium schweigt. Schließlich setzt die Verteidigungsministerin ein »ganz deutliches Signal«. Christine Lambrecht verkündet am 26. Januar, dass die Ukraine 5.000 Helme bekommt. Präsident Selenskyj traut seinen Ohren nicht, ringt um Fassung. Vitali Klitschko poltert los: »Ein absoluter Witz!« Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt spricht aus, was man nicht nur in Kiew denkt: »Was will Deutschland als Nächstes zur Unterstützung schicken? Kopfkissen?«
Während in Deutschland weiter über Waffenhilfe diskutiert wird, tauchen kontinuierlich mehr bewaffnete russische Soldaten an der ukrainischen Grenze auf. Inzwischen wird das Land von drei Seiten bedroht. Von Osten, wo sich die russischen Truppen nach Manövern und entgegen mehrfacher Ankündigung nie wirklich zurückgezogen haben. Von Süden, wo die Halbinsel Krim seit der russischen Annexion 2014 zu einem Militärstützpunkt hochgerüstet wurde. Und selbst im Norden steht russisches Militär, in einem fremden Land, in Belarus. Dort hält sich der Wahlbetrüger Alexander Lukaschenko nur noch mit Hilfe von Wladimir Putin an der Macht, dem er im Gegenzug sein Land als Aufmarschgebiet zu Füßen gelegt hat. Rund 200 Kilometer bis Kiew sind ein Katzensprung. Die Motoren laufen schon, zunächst für ein belarussisch-russisches Manöver. Parallel beginnen am 4. Februar in Peking die Olympischen Winterspiele. Putin verspricht Xi Jingping, sie nicht mit einem Krieg zu überschatten. Auch bei den Spielen in Sotschi 2014 schickte er seine »grünen Männchen« – Spezialkräfte der russischen Streitkräfte in grünen Uniformen ohne Hoheitszeichen – erst einen Tag nach der Abschlussfeier auf die Krim. Der Countdown läuft.
Polen, Lettland, Litauen und Estland liefern zu diesem Zeitpunkt längst Waffen in das bedrohte Land. Tallin hätte sogar schon im Dezember 2021 damit angefangen. Die Balten wollten der Ukraine neun Haubitzen schenken. Aber weil die aus NVA-Beständen stammen, mussten die Esten erst Berlin um Erlaubnis bitten, denn das deutsche Rüstungsrecht schreibt eine Endverbleibserklärung vor. Wer Waffen in Deutschland kauft und dann weitergibt, muss sagen, an wen, und dafür die Genehmigung abwarten. Berlins Beamte lassen sich Zeit. Mitte Februar 2022, als die drei baltischen Regierungschefs den neuen Kanzler Olaf Scholz in Berlin besuchen, bekommt die estnische Kollegin Kaja Kallas immer noch keine Antwort, ob sie die alten, sehr einfach konstruierten Geschütze nun nach Kiew schicken darf oder nicht. 218 Stück hatte die Bundesrepublik 1992 an Finnland verkauft, 42 der Haubitzen übernahmen 2009 die Esten, die nun exakt neun davon weitergeben wollen. Möglichst schnell. Die neue Bundesregierung steht auf der Bremse und agiert wie die alte in der Coronakrise: vor allem bürokratisch. Von Führung keine Spur.
Deutschland wird zur internationalen Lachnummer, erst die Helme, dann die Haubitzen. Das ukrainische Haus droht in Flammen aufzugehen, doch Deutschland reicht die Wasserflasche, statt die Feuerwehr zu holen. Die Ampelkoalition macht sich mit einem verhängnisvollen Fehlstart in der Welt bekannt, zu dem anfangs auch Annalena Baerbock beiträgt. Am 7. Februar erklärt die Außenministerin bei ihrem Besuch in Kiew einmal mehr, dass es aus Deutschland keine Waffenlieferungen geben werde. Sie grenzt sich damit erneut von Robert Habeck ab. Eine massive Aufrüstung der Ukraine durch Berlin würde die russische Seite als Provokation deuten und Krieg wahrscheinlicher machen. Eine militärische Hilfe könne auch die Rolle Deutschlands als Vermittler beschädigen. Was jedoch kaum noch möglich ist, denn die Reputation auf der Weltbühne ist bereits nachhaltig ramponiert. Der deutsche Autoritätsverlust bedeutet weit mehr als nur ein Imageproblem. Der Auftritt als internationaler Schlichter, den sich Berlin nicht zuletzt wegen des angeblich so guten Drahts zu Moskau wünscht, ist zu Ende, bevor er überhaupt richtig begonnen hat. Später – der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile schon fast zwei Monate – kommt es noch schlimmer.
Frank-Walter Steinmeier wird ausgeladen, als er sich Mitte April spontan einer Reise des polnischen Amtskollegen Andrzej Duda von Warschau aus in die ukrainische Hauptstadt anschließen möchte. Das deutsche Staatsoberhaupt ist zu diesem Zeitpunkt in Kiew ein unerwünschter Gast. Ein Skandal, ein Affront. Hatte sich der Bundespräsident nach dem Überfall Russlands doch eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt und später eigene Fehler in der Russlandpolitik eingeräumt. Bei den Deutschen scheint er damit durchzukommen. Obwohl Bundespräsidenten schon aus sehr viel nichtigeren Anlässen das Schloss Bellevue räumen mussten. Die Ukrainer machen es Steinmeier nicht so leicht. Für sie ist er das Gesicht der deutschen Appeasement-Politik mit Moskau schlechthin. Zudem hat sich kein Politiker so dauerhaft und unbeirrt für die Energieabhängigkeit von Russland eingesetzt, gegen alle Warnungen. Steinmeier ist nun angezählt.
Auf Kanzler Olaf Scholz wartet Wolodymyr Selenskyj indes. Vor lauter Rücksichtnahme auf die Russland-Versteher in seiner Partei lässt der Sozialdemokrat aber wertvolle Zeit verstreichen, die die Ukraine nicht hat. Scholz versucht sich erst einmal in Krisendiplomatie und reist Mitte Februar nach Moskau an Putins weißen Tisch. Über die sechs Meter lange Marmorplatte hinweg kann er sich mit dem russischen Präsidenten nur über ein Headset verständigen. Seit der Covid-Pandemie begibt sich Wladimir Putin höchst ungern unter Menschen und wenn er es tut, hält er übertrieben große Distanz. Die russische Jugend nennt ihn deswegen den »Opa im Bunker«. Weder der französische Präsident Emmanuel Macron, der schon vor Scholz im Kreml war, noch der israelische Premier Naftali Bennet, der nach ihm kommen wird, dringen zu Putin durch. Der Deutsche auch deshalb nicht, weil er drei Worte in Moskau nicht in den Mund nimmt: Nord – Stream – Zwei. Ein rechtzeitiges Aus für die zweite Gaspipeline von Russland nach Deutschland hätte den Herrscher im Kreml vielleicht aufhorchen lassen. Aber es kam nicht. Nicht nach der Krim-Annexion, nicht zu Beginn des Krieges in der Ostukraine, nicht nach dem Abschuss des Passagierflugzeuges MH 17, nicht nach der Nowitschok-Vergiftung von Alexej Nawalny. Kein noch so ungeheuerliches Vergehen war für Bundeskanzlerin Angela Merkel Anlass genug, die Reißleine zu ziehen, und ihr Nachfolger hält bislang fest an diesem Kurs.
Putins Antennen bleiben deshalb weiter auf Senden statt auf Empfang geschaltet. Er folgt nur einer Agenda, nämlich seiner. Die in rascher Folge wechselnden Gesprächspartner lässt er teilhaben an seinen Erkenntnissen aus einer Vielzahl von Geschichtsbüchern über das zaristische Russland und die kommunistische Sowjetunion, die er während der Corona-Selbstisolation gelesen hat. Beiden Imperien, die es in der einen wie anderen Ausdehnung nicht mehr gibt, trauert er nicht nur nach, er will Russland schon seit geraumer Zeit nach ihrem Vorbild restaurieren. Ohne die Ukraine ist das unmöglich. Das Nachbarland wird Putins Obsession, vor allem, als er 2013 seinen wichtigsten Mann in Kiew verliert: Viktor Janukowitsch, den Moskau treu ergebenen Präsidenten.
Von Deutschland wird die Ukraine, obwohl sie das zweitgrößte Land Europas ist, jahrelang übersehen. Erst als der Krieg an die EU-Grenze heranrückt, als Millionen ukrainischer Frauen und Kinder nach Polen, Deutschland und in andere EU-Länder fliehen, während ihre Männer die Heimat verteidigen, wird die Ukraine endlich wahrgenommen. Anders als die Politik verstehen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland umgehend, dass sie helfen müssen. Sie werden mit einer enormen Einsatzbereitschaft aktiv. Viele holen Kriegsflüchtlinge direkt an der ukrainisch-polnischen Grenze ab, bringen sie in ihren PKWs in Unterkünfte oder helfen auf Bahnhöfen, den Ankommenden die Orientierung zu erleichtern. Die Menschen spenden so viel Geld wie nie zuvor. Selten haben Wahlvolk und Politik so unterschiedlich auf eine neue Herausforderung reagiert. Die einen tun, was sie können, die anderen könnten mehr tun.
Tschetschenien als Blaupause für die Ukraine
Wenn es eine Weltmeisterschaft der Putin-Versteher gäbe, kämen die Sieger ziemlich oft aus Deutschland. Manchmal würde das Rennen vielleicht etwas knapper ausgehen, weil Victor Orbán aus Ungarn, Aleksandar Vučić aus Serbien oder Recep Tayyip Erdoğan aus der Türkei aufgeholt haben. Aber im Jahr 2001 und danach noch etliche Male hätte als Gewinner ganz klar Gerhard Schröder oben auf dem Treppchen gestanden. Schröder war und ist unangefochten, weil kein anderer ausländischer Regierungschef Wladimir Putin seinen Freund nennen kann. Jedoch, so eine Freundschaft will auch erarbeitet sein.
2001 hat Schröder den russischen Präsidenten nicht einfach nur nach Berlin eingeladen wie im Jahr zuvor, diesmal soll der Gast aus Moskau im Bundestag sprechen. Als Putin am 25. September an das Rednerpult tritt, ist er 48 Jahre alt und hat die längste Zeit seines Lebens im KGB verbracht. Er sieht anders aus als heute, deutlich schmaler, fast schmächtig. Zwei Wochen vor seiner Reise nach Berlin haben islamistische Terroristen die USA angegriffen und Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers von New York sowie in das Pentagon in Washington gelenkt und wohl ein viertes über Pennsylvania abstürzen lassen. Als erstes ausländisches Staatsoberhaupt hat Putin mit seinem US-Amtskollegen George Bush telefoniert und ihm die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus angeboten. Eine beeindruckende Geste, die in den unterkühlten russisch-amerikanischen Beziehungen eine Wende einzuleiten scheint. Putin steht jetzt an vorderster Front mit den USA, an der Seite von Präsident Bush, um gemeinsam gegen den Terrorismus zu kämpfen. Eine Front, die nach seiner Darstellung auch längst durch den Nordkaukasus, durch Tschetschenien, verläuft, wo Russland mit aller Härte Krieg gegen Islamisten führt. Nach der Solidaritätserklärung gegenüber den USA verstummt die Kritik aus den westlichen Hauptstädten an den zahlreichen Menschenrechtsverletzungen Russlands in diesem Kampf.
Die Rede im Bundestag beginnt der Russe in seiner Muttersprache, wechselt aber gleich ins Deutsche. Nun können alle hören, wie gut er die Sprache des Landes beherrscht, in dem er jahrelang gelebt hat. Er spricht vom Ende des Kalten Krieges, wofür er stehende Ovationen bekommt. Einzig die CDU-Vorsitzende Angela Merkel raunt ihrem Sitznachbarn im Bundestag zu: »Wir haben es der Stasi zu verdanken, dass er Deutsch kann.«
Während die Berliner Politiker Putin begeistert applaudieren, kämpfen seine Truppen gegen die Bevölkerung in Tschetschenien. Der Redner hat den Krieg erwähnt: Er sei die Antwort auf den Versuch, im Kaukasus ein Kalifat zu gründen. Doch die Methoden, den Islamisten das Handwerk zu legen, sind seit zwei Jahren extrem fragwürdig. Moskaus Soldaten verüben Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Männer, deren Hände mit Stacheldraht gefesselt sind, werden in tschetschenischen Massengräbern gefunden, so wie 2022 in Butscha bei Kiew. In Grosny wird 1999 eine Geburtsklinik beschossen, dabei sterben 27 Mütter und Neugeborene, in Mariupol wiederholt sich ein ähnlicher Angriff 2022. Wer sich im Oktober 1999 noch in der tschetschenischen Hauptstadt aufhält, wird als Terrorist betrachtet. 20 Jahre später werden Ukrainer von Putin als Neonazis oder Faschisten bezeichnet. Den Tschetschenienkrieg im Jahr 2001 als Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu verkaufen, ist Putins ganz eigene Wahrheit. Er schafft es, dass die Verbrechen an der Zivilbevölkerung aus der Tagespolitik verschwinden.
Tschetschenien könnte eine Blaupause für die Ukraine sein: Erst wird eine Region in Schutt und Asche gelegt, dann die Zivilbevölkerung durch Massaker weiter dezimiert und massiv eingeschüchtert und schließlich per Gewaltherrschaft unter Moskaus Knute gezwungen. Nach der kleinen Kaukasus-Republik hat sich Putin jetzt mit der Ukraine ein ungleich anspruchsvolleres Ziel gestellt, aber dem Mann im Kreml ist der Bezug zur Realität längst abhandengekommen. Er wird nicht freiwillig an den Verhandlungstisch zurückkehren, sondern nur, wenn eine Niederlage droht, seine Rechnung nicht aufgeht.
Für Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Russland 1999 noch für die Gewalt in Tschetschenien kritisierte, ist sie 2001 längst kein Thema mehr. Schon ein halbes Jahr vor dem 11. September hat er mit Wladimir Putin den Petersburger Dialog ins Leben gerufen. Die beiden stehen sich nah, das gleiche Macho-Gehabe, die ähnliche Herkunft aus armer Familie. Das angeblich zivilgesellschaftliche Forum wird mit den deutsch-russischen Regierungskonsultationen verknüpft. Die Anwesenheit von Kanzler – später Kanzlerin – und russischem Präsidenten gilt den Organisatoren als maximale Aufwertung des Dialogs. Doch die Medien stören dabei, von Anfang an. Bereits bei der Gründungsveranstaltung im April 2001 in der Universität von Sankt Petersburg herrscht Peter Boenisch, Ex-Regierungssprecher von Helmut Kohl und nun Vorsitzender des Lenkungsausschusses, deutsche Journalistinnen und Journalisten an, dass man solche wie sie hier nicht brauchen würde. Die Berichterstattung mit ihren Negativschlagzeilen über den Krieg im Kaukasus würde nur die Stimmung verderben. Eine Kampfansage von oberster – deutscher! – Stelle. Von Stund an gelten sowohl Reporterinnen und Reporter wie auch NGOs, die ähnlich brüsk empfangen werden, als Störenfriede.
Die Wirtschaftsvertreter betrachten den Petersburger Dialog eher als einen Honoratiorenklub denn als Plattform für zivilgesellschaftlichen Austausch, als die das Gremium der Öffentlichkeit verkauft werden soll. Wer sich sein Interesse an Russland nicht mit Sponsorengeldern bezahlen lässt, wem es tatsächlich um einen offenen Meinungsaustausch geht, hat in den Augen derer den eigentlichen Zweck nicht verstanden und ist hier fehl am Platz. Da die deutsche Wirtschaft den Verein teilweise finanziert, gehört er ihr. So lautet, salopp gesagt, das Motto. Eine Visitenkarte als Mitglied des Petersburger Dialogs öffnet bei Moskauer Unternehmen viele Türen. Und natürlich will sich niemand dabei beobachten lassen, wie flugs Demokratie- und Freiheitsverständnis unter den Tisch fallen, wenn man Kontakte machen kann. Klar, dass Menschenrechtler und Medien da im Weg sind. Entsprechend feindselig werden sie behandelt. Die russische Seite macht es sich noch einfacher, sie lädt anfangs fast keine, später überhaupt keine Kremlkritiker mehr ein.
Wladimir Putin ist zu diesem Zeitpunkt seit knapp einem Jahr Präsident der Russischen Föderation. Vorher war er für ein paar Monate Ministerpräsident, ein Amt, das Präsident Boris Jelzin ihm im August 1999 anträgt, weil niemand sonst den maroden russischen Staat mehr führen will. Jelzin zieht von 1994 bis 1996 in den ersten Tschetschenienkrieg. Den zweiten Krieg in der Kaukasusrepublik bekommt Putin zum neuen Posten gratis dazu. Er ist, trotz Vergangenheit als Sicherheitsratschef und Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB, völlig unbekannt im eigenen Land. Russland befindet sich in einer Rubelkrise, der Ölpreis ist so niedrig, dass sich die Förderung als teurer als der Verkauf der Brennstoffe erweist. Im Kaukasus herrscht trotz des ersten Krieges noch immer keine Ruhe. Ganz im Gegenteil. Schon wieder wird gekämpft. Dieses Mal wollen ausländische Islamisten mit Tschetschenen und Dagestanern einen Islamischen Staat errichten. Alle infrage kommenden Politiker hatten nur abgewinkt, als Jelzin ihnen den Posten antrug. Putin griff zu. Für den scheidenden Präsidenten ist er vor allem deshalb der Richtige, weil er ohne viel Federlesens bereit ist, Jelzin eine lebenslange Immunität vor Strafverfolgung zuzusichern.
»Who is Mr. Putin?«, fragt 1999 alle Welt. Doch bald kennt man die Antwort. Anfang September explodieren in Moskau, Buinaksk und Wolgodonsk Wohnhäuser. Es sind Attentate, bei denen über 300 Menschen sterben, und die die russischen Sicherheitsbehörden tschetschenischen Terroristen zuschreiben. Ein Vorwurf, der nie gerichtlich belegt wird. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass der russische Geheimdienst die Häuser in die Luft gesprengt hat, um einen neuen Vorwand für einen weiteren Tschetschenienkrieg zu bekommen. Duma-Abgeordnete und Journalisten, die diese Spur verfolgen, werden getötet. Der Ex-Agent Putin setzt sich in Szene. Russen und Russinnen sollen verstehen, dass er der Gegenentwurf ist zu dem amtierenden Staatsoberhaupt mit seinen Herz- und Alkoholproblemen. Um Stärke und Entschlossenheit zu demonstrieren, stößt Putin am 23. September 1999 in einer Fernsehansprache an die Nation eine Drohung aus: »Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen. Ob wir sie nun in Flughäfen oder – entschuldigen Sie – in Toiletten zu fassen kriegen. Dann werden wir sie eben dort kaltmachen!« So mancher Zuschauer wird den eiskalten Blick aus dem vor Wut verzerrten Gesicht des Premiers nicht mehr vergessen und erkennt ihn bei den späteren Hassreden gegen die Ukraine wieder.
Die Ukrainer erleben gegenwärtig die gleiche Unbarmherzigkeit Putins wie zuvor die Tschetschenen, die noch dazu Bürgerinnen und Bürger seines eigenen Landes sind. An Tschetschenien hatten sich schon die Zaren die Zähne ausgebissen. Mit Gewalt zwingt der Ex-KGB-Spion das kleine aufmüpfige Volk im Kaukasus in die Knie. Erst nach zehn Jahren wird die »Antiterroroperation« beendet. Geführt wird sie von Alexander Dwornikow. Auf diesen für seine Brutalität bekannten General verlässt sich Putin später auch in Syrien und in der Ukraine. Vieles hinsichtlich der Kriegsführung wiederholt sich. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny wird völlig zerbombt, wie 2015 das syrische Aleppo und 2022 Mariupol, wo tschetschenische Spezialkräfte zum Einsatz kommen.
Es sind »Kadyrowzy«, Truppen von Ramsan Kadyrow, dem Putin die Kontrolle der abgestraften Rebellenrepublik anvertraut hat. Kadyrow genießt im Kreml Narrenfreiheit, er ist Putins Mann fürs Grobe. Er lässt Journalistinnen und Politiker erschießen, so wie 2006 Anna Politkowskaja, 2009 Natalja Estemirowa und 2015 Boris Nemzow. Abtrünnige Tschetschenen werden in Österreich und auch in Deutschland hingerichtet. Selimchan Changoschwili wird 2019 beim sogenannten Tiergartenmord in Berlin erschossen. Ermittlungen im In- und Ausland führen direkt oder indirekt nach Tschetschenien und damit zum Oberhaupt der russischen Teilrepublik, so im Fall des Mords an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow, den beiden Journalistinnen und weiteren Kollegen der unabhängigen Zeitung Nowaja Gaseta oder dem Opfer im Berliner Tiergarten.
Auf das Konto des Präsidenten gehen aber auch noch ganz andere Gesetzesverletzungen. Doch ganz gleich, was sich Kadyrow zuschulden kommen lässt – Russlands Strafbehörden, die gegen die freie Presse oder die Opposition mit größter Härte vorgehen, schauen bei dem 1976 im tschetschenischen Zentoroi geborenen Statthalter weg. Die in der Ukraine zu Recht beklagte Korruption treibt in Tschetschenien wildeste Blüten. Ein Palast auf einem Grundstück von der Größe zweier Fußballfelder mitten im Zentrum von Grosny, Kosten umgerechnet mehr als vier Millionen Euro, gehört Fatima Chasujewa. Die 30-Jährige besitzt in anderen Städten noch weitere Wohnungen. Ihr offizielles Gehalt in der Präsidialadministration, wo sie arbeitet, beträgt keine 900 Euro. Wie die Bürokraft Besitzerin eines Palastes werden konnte, hat Maria Scholobowa herausgefunden. Sie ist Journalistin in der russischen investigativen Recherchegruppe »Projekt« und deckte 2021 einen großen Immobilien- und Korruptionsskandal um Kadyrow auf, mit dem Ergebnis, dass ihr Internet-Portal geschlossen wurde und sie ins Ausland fliehen musste.
Maria Scholobowas Rechercheteam hat getan, was Pflicht der Steuerbehörde und des Grundbuchamts gewesen wäre: zu ermitteln, ob mit diesem Palast alles seine Richtigkeit hat. Die Journalistin fragte nach und fand heraus: Kadyrow hat eine zweite Ehefrau, Fatima Chasujewa, parallel zu seiner ersten, und lebt mit ihr ganz offen zusammen. Russische Gesetze gelten auch für die Teilrepublik Tschetschenien, Polygamie ist verboten. Ramsan Kadyrow kümmert das nicht. Vielmehr hält er Vorträge darüber, wie mehrere Ehefrauen gleichzeitig behandelt werden müssen: gleich gut gekleidet, mit gleich wertvollen Häusern, beschenkt mit Pelzen und Autos. Der gläubige Muslim Kadyrow hat in Tschetschenien ein strenges traditionelles Regime eingeführt, es gelten die Gesetze der Blutrache, Frauen haben Kopftücher zu tragen. Medni Kadyrowa, die er zuerst geheiratet hat, gehorcht ihm. Ihre Religion erlaube dem Mann, so Kadyrowa, noch drei weitere Frauen zu ehelichen. Wenn er das möchte, sei sie einverstanden. Auch Medni Kadyrowa besitzt eine Reihe wertvoller Immobilien. Da die Ehen mit den zweiten, dritten oder vierten Frauen nur vor dem Imam, aber nicht auf dem Standesamt geschlossen werden, ist rechtlich vermeintlich alles in Ordnung. Fast jedenfalls, denn mit Hilfe der beiden Ehefrauen, ob in registrierter Ehe oder nicht, soll Kadyrow angeblich einen Teil seines Reichtums verschleiern. Er beläuft sich allein bei Immobilien auf 800 Millionen Rubel, knapp neun Millionen Euro. Das Oberhaupt der 1,5 Millionen Einwohner großen Teilrepublik verdiente im Jahr 2020 rund vier Millionen Euro. Im Jahr zuvor nur 1,6 Millionen Euro und 2018 sogar nur 80 000 Euro. Wie diese großen Schwankungen entstehen, erfahren die Bürger nicht. Ein Fahrzeug besitzt der Autonarr, als der er sich häufig zur Schau stellt, nach seinen Angaben nicht. Kein einziger Wagen des imposanten Fuhrparks, in dem seit Beginn seiner politischen Karriere Sportwagen der teuersten Marken wie Bugatti, Ferrari oder Mercedes-Benz stehen, ist demnach sein eigener. Das russische Nachrichtenportal lenta.ru addierte die dort versammelten Pferdestärken und kam auf über 3.800 PS, wobei dafür angeblich nur die Luxusmodelle gezählt wurden. Ebenso wenig tauchen die über 100 Pferde seines Rennstalls bei den offiziellen Angaben seines Besitzes auf. Sie gewinnen von 2014 bis 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland fast eine Million Euro an Preisgeldern. Der Generalsekretär von Transparency Russland Ilja Schumanow wies in diesem Zusammenhang vorsichtig darauf hin, dass man sehr wohl Geld bei Pferderennen verdienen könne, aber das müsse dann auch versteuert werden.
Ramsan Kadyrow wird im Alter von 29 Jahren zunächst Ministerpräsident, dann mit 30 Präsident Tschetscheniens. Er folgt seinem Vater Achmed im Amt. Dieser kam bei einem Attentat ums Leben. Der Sohn fühlt sich als uneingeschränkter Herrscher in seinem Reich und darüber hinaus. Er gibt gern mit seinen Besitztümern an, was für die Steuerprüfer eigentlich von Interesse sein sollte und zugleich Fragen nach ihrer Finanzierung aufwerfen müsste. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow tut die Diskrepanz zwischen Kadyrows Einkommen und dessen Reichtum kurzerhand ab, wie der Bericht der Recherchegruppe »Projekt« belegt: »Recherchen sind das eine, die Deklarationen das andere. Alle Oberhäupter der Regionen füllen Deklarationen aus, die dann kontrolliert werden. Die Daten, die von staatlichen Antikorruptionseinheiten überprüft werden, sind viel zuverlässiger als die der Medien.«
Unabhängige Journalistinnen und Journalisten wie Maria Scholobowa von »Projekt« leben in Russland gefährlich, deshalb arbeiten viele vom Ausland aus. Die vielfach prämierte Autorin ist mit ihrer Nachforschung zu Kadyrow ein hohes Risiko eingegangen. Denn russische Behörden interessieren sich oft nicht für die, die Gesetze verletzen, sondern für diejenigen, die das aufdecken. Was nie so augenfällig war wie bei der Vorgehensweise gegen den Antikorruptionsaktivisten Alexej Nawalny. Für Kadyrow bleiben derartige Veröffentlichungen bislang folgenlos. Er ist unantastbar. Wenn geheime Foltergefängnisse und außergerichtliche Tötungen bei den Strafverfolgungsbehörden schon nicht auf Resonanz stoßen, geschieht das bei seiner illegalen Bereicherung erst recht nicht.
Die tschetschenische Regierung orchestriert Massenverhaftungen, Verschleppungen, Misshandlungen von Personen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Veronika Lapina vom LGBT-Netzwerk hat versucht, Ermittlungen anzustoßen. »Aber Russland hat entweder nicht die Kapazität oder nicht den Willen, sich damit zu befassen«, konstatiert sie. Seit 2017 wurden 235 Personen von tschetschenischen Sicherheitskräften willkürlich verhaftet, ins Gefängnis gesperrt und gefoltert, so viele haben sich jedenfalls an das in Sankt Petersburg ansässige Netzwerk gewendet. Betroffen sind größtenteils homo- oder bisexuelle Männer, deren Lebensweise nicht zum Geschlechterverständnis von Ramsan Kadyrow passt. Russische Strafverfolgungsbehörden nehmen sich dieser Verbrechen nicht an. Der Grund dafür ist eine Abmachung, zeigt sich die Menschenrechtsanwältin aus Sankt Petersburg überzeugt: Kadyrow sorgt dafür, terroristische und separatistische Umtriebe zu ersticken, und als Gegenleistung erhält er volle Handlungsfreiheit in Tschetschenien. Präsident Putin breitet seine Hände schützend über Ramsan Kadyrow.
Russland konnte Krieg in der Ostukraine führen, in Syrien, Georgien oder Tschetschenien – für die Deutschen war alles weit weg, zu speziell, nicht wichtig genug für eine kontinuierliche und intensive Beschäftigung. Diejenigen, die auf die Verbrechen hingewiesen haben, Konsequenzen forderten, nervten nur. Russland sei eben anders, zu groß, nicht demokratiefähig, lauteten die Erklärungen der Russland-Versteher, die nicht merkten, wie viel Überheblichkeit in ihren Worten mitschwang. Vor allem aber geht es ums Geschäft.
Der Ukraine keine Waffen zu liefern, hieße nicht, das Sterben schneller zu beenden, wie manche Pazifisten überzeugt sind, sondern es würde bedeuten, dass Putin ein weiteres Terror-Regime errichten kann – und zwar auf ukrainischem Territorium.
Putin, Schröder, Warnig – ziemlich clevere Freunde
Trotz des 1999 beginnenden zweiten Tschetschenienkrieges geht der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht etwa auf Abstand zum Kreml, sondern nähert sich ihm immer mehr an.
Zehn Tage vor der Bundestagswahl 2005, von der abzusehen ist, dass ihr Ausgang knapp werden wird, zurren Schröder und sein inzwischen langjähriger Freund Wladimir Putin einen Deal fest. Sie bringen ein Geschäft unter Dach und Fach für den Fall, dass der Sozialdemokrat die Wahl verliert. In Schröders und Putins Anwesenheit unterschreiben am 8. September Vertreter der russischen Gazprom, der deutschen BASF-Tochter Wintershall und E.ON einen Vertrag, der die Verlegung einer Gasleitung auf dem Meeresboden der Ostsee von Wyborg nach Lubmin zum Ziel hat. Das deutsch-russische Abkommen besiegelt die Schaffung der Betreibergesellschaft Nord Stream. Geschäftsführer wird Matthias Warnig. Die Idee zu einer solchen 1.224 Kilometer langen Pipeline stammt aus dem Jahr 1997 von dem russischen Gasförderer Gazprom und dem finnischen Öl- und Gasunternehmen Neste. Jetzt will Putin sie in die Realität umsetzen.
Am 9. Dezember 2005 erreicht den inzwischen ehemaligen Kanzler auf seinem Handy ein Anruf aus dem Kreml. Putin macht ihm zu später Stunde das Angebot, den Vorsitz des Aktionärsausschusses von Nord Stream zu übernehmen. Schröder findet das ein bisschen früh, keine drei Wochen nach dem Ausscheiden aus der Politik. Da er jedoch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er in seinem neuen Leben hauptsächlich Geld verdienen will, stimmt Schröder trotzdem zu. Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten, denn es ist das eine, sich als Politiker für die Energiesicherheit seines Landes einzusetzen, aber etwas anderes, von einem milliardenschweren Investitionsprojekt, das er gerade noch als Kanzler angeschoben hat, persönlich zu profitieren. Doch so schnell bläst Schröder nichts um. Er war immer stolz auf seine Freundschaft zu dem russischen Präsidenten, dessen engste Verbündete für die neue Pipeline nun zwei Deutsche sind. Das Duo Schröder – Warnig stellt für Putin die Idealbesetzung dar. Der Sozialdemokrat hat eine ansehnliche Karriere als niedersächsischer Ministerpräsident und Bundeskanzler hinter sich und ist für Putins Geschmack genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Politik ausgestiegen. Und er bringt die nötige Chuzpe mit. Nur wenige Tage vor seinem Rücktritt hat der scheidende Kanzler noch eine Darlehensbürgschaft der Bundesregierung von über einer Milliarde Euro für Nord Stream eingetütet. Was im Berliner Politikbetrieb, der mitten in Koalitionsgesprächen steckt, vollkommen untergeht. Erst als das Finanzministerium den Wirtschaftsausschuss des Bundestages ein halbes Jahr später schriftlich informiert, platzt die Bombe. Den SPD-Genossen, die mit den beiden Unionsparteien eine Große Koalition eingegangen sind, ist die Milliardenbürgschaft oberpeinlich. Doch da ist der Altkanzler längst über alle Berge. Frank-Walter Steinmeier muss sich zum ersten Mal als Schröders wichtigster Mann in der neuen Bundesregierung bewähren und möglichst geräuschlos Scherben zusammenfegen. Aber darin hat der Chefdiplomat nach zwölf Jahren an Schröders Seite Übung.
Der Ex-Kanzler braucht neue Erfolgserlebnisse. Der Beratervertrag für den Schweizer Verlag Ringier, den er nur wenige Tage nach seinem Abgang als Regierungschef unterschreibt, ist ein ganz netter Anfang, aber es muss mehr her. Mit seinen 61 Jahren sprüht er noch vor Tatkraft, außerdem hat er beste Kontakte zu den Staats- und Regierungschefs der EU. Die will er am Laufen halten. Wenn er anruft, muss er sich schließlich nicht erst vorstellen. Ideale Voraussetzungen für Nord Stream. Vor allem die Ostsee-Anrainerstaaten werden jetzt gebraucht, denn sie sollen die Genehmigung für die Gasröhren auf ihrem Abschnitt des Meeresgrunds erteilen. Da man für ein von Russland initiiertes Projekt bei Polen, Litauen, Lettland und Estland von vornherein auf Granit beißen wird, hat man die Route für die Pipeline gleich anders festgelegt. Gefragt werden müssen Finnland, Schweden und Dänemark. Es trifft sich gut, dass deren Regierungschefs gerade aus der internationalen sozialdemokratischen Parteienfamilie stammen. Für Schröder eine lösbare Aufgabe.
Matthias Warnig, der Mann, der als künftiger Geschäftsführer von Nord Stream am 8. September unterschrieben hat, ist schon jetzt ein Schwergewicht in der russischen Wirtschaft. In welchem Maße er das Vertrauen des Präsidenten genießt, lässt sich an seinen Aufsichtsratsmandaten ablesen: beim weltgrößten Aluminium-Hersteller Rusal, den Banken Rossiya und VTB. Er sitzt im Vorstand der weltgrößten Firma für Ölleitungen Transneft und beim Ölproduzenten Rosneft. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender von Gazprom Schweiz. In viele der Unternehmen wird Schröder, der Genosse der Bosse, wie er schon zu seiner aktiven Zeit als Politiker genannt wurde, Warnig folgen.
Putin kennt den Ostdeutschen um einiges länger als den Niedersachsen, höchstwahrscheinlich schon seit seiner Zeit in Dresden von 1985 bis Januar 1990. Die dortige Stasi-Bezirksverwaltung lag nur einen Steinwurf von der KGB-Villa entfernt. Warnig hatte sich mit 18 Jahren als hauptamtlicher Mitarbeiter für die Staatssicherheit verpflichtet. 1975 wurde er als Agent in der Auslandsspionageabteilung Hauptverwaltung A ausgebildet und war später unter dem Decknamen »Arthur« Offizier im besonderen Einsatz in Düsseldorf. Eine seiner Hauptaufgaben bestand in der sogenannten Wirtschaftsaufklärung. Am 7. Oktober 1989, dem letzten Tag der Republik in der DDR, zeichnete ihn Stasi-Chef Erich Mielke mit der »Medaille für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee« in Gold aus. Ein Objekt seiner Überwachung soll die Dresdner Bank gewesen sein. Sie ist einer seiner späteren Arbeitgeber in Sankt Petersburg gewesen, wo sich Putins und Warnigs Wege wieder kreuzen. Erstaunlich ist, dass Warnig in der Stadt an der Newa mit dem Aufbau der Repräsentanz der Dresdner Bank beauftragt wird. Viele ehemalige DDR-Bürger und -Bürgerinnen mussten sich hinsichtlich einer Tätigkeit im Ministerium für Staatssicherheit überprüfen lassen, wenn sie in den öffentlichen Dienst oder in Spitzenpositionen der Wirtschaft eintreten wollten. Ausgerechnet bei Warnig drückten die Beteiligten, einschließlich der Dresdner Bank, offenbar alle Augen zu. Anscheinend hatte auch Gerhard Schröder keine Berührungsängste mit dem ehemaligen Stasi-Agenten, genauso wenig wie ihn die KGB-Vergangenheit von Putin störte. Vielleicht haben die beiden langgedienten Spione den Plan, Schröder für ihre Zwecke einzuwickeln, sogar gemeinsam ausgeheckt.
2005 beginnt das Trio seine kollegiale Zusammenarbeit, die bis heute andauert. Über alle Kritik hinweg. Schröder hat Gegenwind bislang immer ausgehalten, wenngleich dieser noch nie so stark war wie seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Scheinbar ficht es ihn immer noch nicht an, dass er inzwischen nicht nur seinen Ruf ruiniert und sein politisches Erbe verspielt hat, sondern als tragische Figur in einem verhängnisvollen Pakt mit dem Teufel wahrgenommen wird. Zwar verlässt er am 20. Mai 2022 den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft, als ihm das Europäische Parlament mit Sanktionen droht, doch immer noch verliert er kein kritisches Wort über den Kriegstreiber Putin persönlich. Sein Vermittlungsversuch in Moskau Mitte März 2022 soll der Welt zeigen, wie nützlich diese für viele unsägliche Freundschaft ist, auch wenn er im ersten Anlauf erfolglos war. Schröder ist überzeugt, noch gebraucht zu werden. Seinen Genossen würde er den allergrößten Gefallen tun, wenn er schon nicht Abbitte leisten kann, sich wenigsten aus der russischen Umarmung zu lösen. Er ist eine Bürde für die SPD und die Personifizierung ihrer Ostpolitik, die am Ende die Interessen aller osteuropäischen Partner außer die Russlands ignoriert hat.
So wenig wählerisch Schröder bei seinen Freunden ist, so wenig zimperlich ist er bei seinen Geschäftspartnern. Der neue Job bei Nord Stream verlangt, ab 2005 Hand in Hand mit Matthias Warnig zusammenzuarbeiten. Der Mann wird als herzlich und gesellig beschrieben. Er verfügt genau wie der Ex-Politiker über unbezahlbare Kontakte. Freilich ganz anderer Art. Die vielleicht dann von Nutzen sind, wenn der Bereitschaft zur Kooperation etwas nachgeholfen werden muss. Schröder und Warnig machen sich ans Werk. Der Schwede Göran Persson, der Finne Paavo Lipponen und der Däne Poul Nyrup Rasmussen müssen ins Boot geholt werden. Persson, der Premier in Stockholm, hat sich als überzeugter Klimaschützer international einen Namen gemacht. Dementsprechend hält er von einer zusätzlichen Gaspipeline nichts. Jedenfalls solange er Ministerpräsident ist. Nach der verlorenen Wahl bittet ihn Schröder am 7. Mai 2007 zum Mittagessen und ist offensichtlich mehr als überzeugend. Nur einen Tag später stellt sich Persson als Lobbyist für den Nord-Stream-Großkunden E.ON vor. Im Juli 2008 lädt Schröder den Finnen Paavo Lipponen zu einem Treffen nach Berlin ein. Man speist zu dritt, mit Warnig. Denn Finnland ist eher seine Baustelle. Die DDR unterhielt in dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land eine ungewöhnlich große Botschaft. Die ostdeutschen Diplomaten mussten wie ihre sowjetischen Kollegen, die ebenfalls zahlreich vertreten waren, möglichst viele Spione in der finnischen Politik