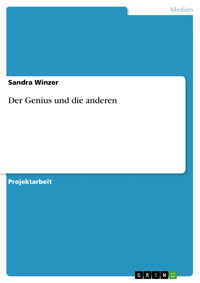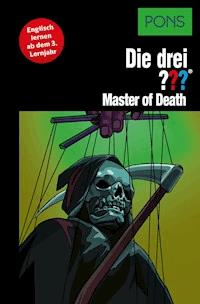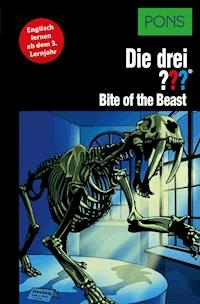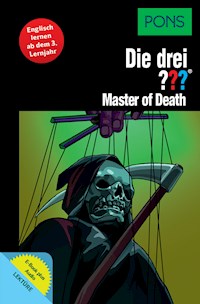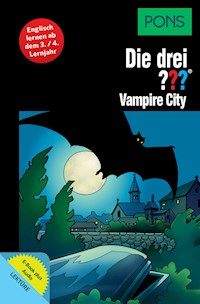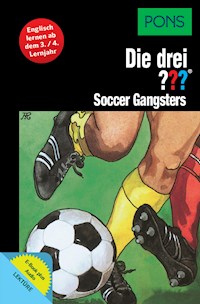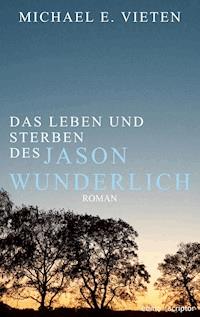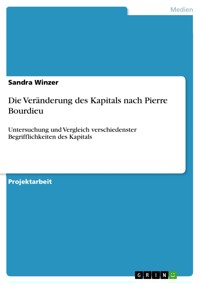
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Projektarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medienökonomie, -management, Note: 1,5, Bauhaus-Universität Weimar (Fakultät Medien), Veranstaltung: Theorie und Praxis der Medienwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung und Problemstellung In seiner Abhandlung über ‚Die verwandelte Klassengesellschaft‘ postulierte Michael Vester im Jahre 1994 einst, dass jede Forschung neben der Professionalität ihrer Untersuchungsweise vor allem an ihrer Fragestellung zu erkennen sei. Angelehnt an das Eingangszitat war das Ziel der vorliegenden Modularbeit die Untersuchung und der gleichzeitige Vergleich verschiedenster Begrifflichkeiten des Kapitals. Die traditionelle Vorgehensweise bei der Bemessung der Profitabilität einer Gesellschaft oder eines Unternehmens sowie dessen spezifischen Wachstumsmöglichkeiten beruht in der traditionellen Betrachtung auf ökonomischen und buchhalterischen Wertgrößen, wie Jahresüberschüssen, Dividendenzahlungen und Umsätzen. Sie sind zunächst mit dem Vorteil belegt, mit relativ einfachen Mitteln aus Jahresabschlussbilanzen (z.B.) erfasst werden zu können. Im Laufe der Untersuchungen wird sich herausstellen, dass Unternehmensbewertungen und jeweiliges Kapital nicht ausschließlich aus dieser Perspektive gedacht werden können. Vor allem in Kapitel 3 – 5 wird verdeutlicht, welche Ordnungsgrößen und Kapitalsorten ergänzt werden müssen, um den Wert einer Instititution messen zu können. Es besteht die Notwendigkeit, weitere Erklärungsmuster bezüglich des Kapitals auszumachen, um alle tatsächlich vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen zu erfassen. Die Arbeit leistet so die Erforschung einer Fragestellung entlang der Auffassungen Pierre Bourdieus, welche es schließlich zulassen, die untersuchten Kapitaltypen auf die Unternehmung und neue digitale Strukturen zu übertragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Modularbeit im Rahmen des Projektmoduls „Ökonomische Theorien“
„Zu eben der Zeit, als Bourdieu mit der Konzeption des sozialen und kulturellen
Kapitals beschäftigt war, spitzte sich in der theoretischen Ökonomie eine
Kontroverse darüber zu, was unter Kapital eigentlich zu verstehen (sei).“
Page 3
1. Einleitung und Problemstellung
Ipostulierte Michael
Vester im Jahre 1994 einst, dass jede Forschung neben der Professionalität ihrer Untersuchungsweise vor allem an ihrer Fragestellung zu erkennen sei. Angelehnt an das Eingangszitat war das Ziel der vorliegenden Modularbeit die Untersuchung und der gleichzeitige Vergleich verschiedenster Begrifflichkeiten des Kapitals. Die traditionelle Vorgehensweise bei der Bemessung der Profitabilität einer Gesellschaft oder eines Unternehmens sowie dessen spezifischen Wachstumsmöglichkeiten beruht in der traditionellen Betrachtung auf ökonomischen und buchhalterischen Wertgrößen, wie Jahresüberschüssen, Dividendenzahlungen und Umsätzen. Sie sind zunächst mit dem Vorteil belegt, mit relativ einfachen Mitteln aus Jahresabschlussbilanzen (z.B.) erfasst werden zu können. Im Laufe der Untersuchungen wird sich herausstellen, dass Unternehmensbewertungen und jeweiliges Kapital nicht ausschließlich aus dieser Perspektive gedacht werden können. Vor allem in Kapitel 3 5wird verdeutlicht, welche Ordnungsgrößen und Kapitalsorten ergänzt werden müssen, um den Wert einer Instititution messen zu können. Es besteht die Notwendigkeit, weitere Erklärungsmuster bezüglich des Kapitals auszumachen, um alle tatsächlich vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen zu erfassen. Die Arbeit leistet so die Erforschung einer Fragestellung entlang der Auffassungen Pierre Bourdieus, welche es schließlich zulassen, die untersuchten Kapitaltypen auf die Unternehmung und neue digitale Strukturen zu übertragen.
2. Der Kapitalbegriff
Innerhalb des hier stattfindenden Forschungsprozesses ist es zunächst elementar, das Kapital durch die Abstraktion von Begrifflichkeiten und Kategorien als solches begreifbar zu machen. Um das Wesen des Kapitals und dessen Aussage erfassen zu können, ist es dabei notwendig, sich mit den von Karl Marx geprägten Begrifflichkeiten von Ware, Wert, Geld, Mehrwert und Kapital (u.a.) auseinanderzusetzen. 1890verfasstes Werk und seine auf Produktionsverhältnisse konzentrierten angewandten Untersuchungsmethoden bilden bis heute einen Grundstein der Kapitaltheorie ab und kennzeichnen die ökonomische Formation der Gesellschaft wesentlich. Kennzeichnend ist die Entwicklung einer dialektisch-materialistischen Methodik, welche gleichzeitig eine Voraussetzung schafft, die kapitalistische Gesellschaft bis ins Innerste zu untersuchen.