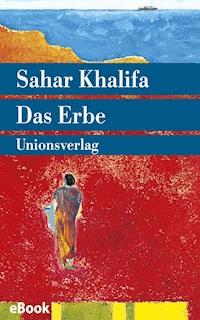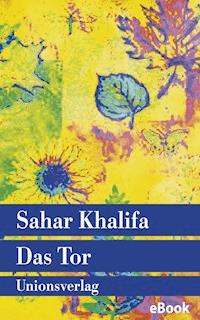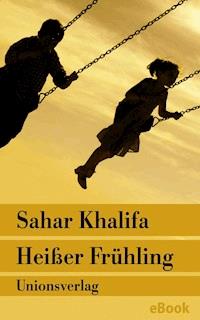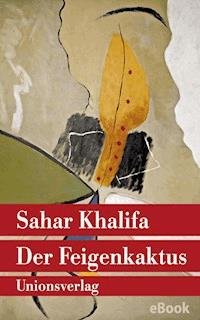8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der junge Lehrer Ibrahim der rätselhaften Mariam begegnet, beginnt unter den argwöhnischen Augen des Dorfes eine unmögliche Liebe. Er ist Muslim, sie Christin. Ihre unter dem christlichen Schleier versteckte Lebenslust verstört ihn. Misstrauen zersetzt ihn, als sie schwanger wird. Der Ausbruch des Krieges 1967 fällt wie ein Blitzschlag in eine ausweglose Situation. Erst nach Jahrzehnten des Exils kehrt Ibrahim in die palästinensischen Gebiete zurück und macht sich auf die Suche nach der verlorenen Mariam. Aber die Menschen, das Land und die Stadt seines Herzens haben sich zur Unkenntlichkeit verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als der junge Lehrer Ibrahim der rätselhaften Mariam begegnet, beginnt unter den argwöhnischen Augen des Dorfes eine unmögliche Liebe. Er ist Muslim, sie Christin. Der Ausbruch des Krieges 1967 fällt wie ein Blitzschlag in eine ausweglose Situation. Erst nach Jahrzehnten des Exils kehrt Ibrahim zurück – und findet ein verändertes Land vor.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sahar Khalifa (*1941) ging mit achtzehn Jahren eine traditionelle Ehe ein, die dreizehn Jahre dauerte. Nach der Scheidung widmete sie sich verstärkt dem Schreiben, studierte in den USA und arbeitete an der Universität Bir Zeit. In Nablus gründete sie ein palästinensisches Frauenzentrum.
Zur Webseite von Sahar Khalifa.
Regina Karachouli (*1941) ist promovierte Arabistin und Kulturwissenschaftlerin. Nach langjähriger Lehr- und Forschungstätigkeit am Orientalischen Institut in Leipzig ist sie freie Übersetzerin aus dem Arabischen.
Zur Webseite von Regina Karachouli.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sahar Khalifa
Die Verheißung
Roman
Aus dem Arabischen von Regina Karachouli
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Ṣūra wa-īqūna wa-ʿahd qadīm bei Dar al-Adab in Beirut.
Die Übersetzung aus dem Arabischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Sura wa iquna wa-’ahd qadim (2002)
© by Sahar Khalifa 2002
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Dale Windham/Getty
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30686-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 18:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE VERHEISSUNG
Ein BildEine IkoneEine alte VerheißungWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Sahar Khalifa
Über Regina Karachouli
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Sahar Khalifa
Zum Thema Palästina
Zum Thema Arabien
Zum Thema Frau
Zum Thema Asien
Ein Bild
Mariam war die liebste Erinnerung, das teuerste Andenken, das schönste Bild in mir. Sie teilte mein Exil, und wenn ich an sie dachte, zog es mich zurück nach Jerusalem. Dann spürte ich wieder die Ketten aus Karub und Nelken um meinen Hals, und mir hüpfte das Herz wie einem verliebten Zwanzigjährigen. Jene ferne Zeit ist mir so nah, ist Freundschaft und Liebe. Frei wie ein Sperling schwinge ich mich dann empor, mit Flügeln und Augen aus goldenen Spiegeln, um meine Welt zu entdecken und Jerusalems Kuppeln zu schauen.
Jetzt ist Jerusalem eine andere Stadt, ist Vergangenheit und Geschichte. Aber einst waren Mariam und Jerusalem eins. All das gehört dem Gestern an – Jerusalem, meine Erinnerungen, meine erste Liebe! Ich lebe im Heute und habe doch keine Gegenwart. Mariam und meine Geschichte sind verloren. Mein Dasein ist zerstört, meine erste Liebe ist dahin und mit ihr mein Enthusiasmus. Wie lange habe ich nach der Liebsten gesucht, nach Erinnerungen und einer Zukunft. Doch ich fand nichts als Vergangenheit – ein verblichenes Bild, den leisen Widerhall von Glocken über einem Klosterhof. Ist es wirklich Jerusalem? Und ist dort Mariam? Wohnt dort die Liebe, das Gedächtnis, die Sehnsucht? Ach, meine Seele ist angebunden. Wie ein Papierdrachen steht sie in der Luft, steigt weder auf, noch sinkt sie zu Boden. Die Geschichte meiner Liebe gleicht einem Drachen aus Papier. Alles hängt am Faden – meine Seele, meine Erinnerung, ich selbst.
Die Geschichte begann damit, dass ich vor einer Heirat flüchtete, die mein Onkel arrangiert hatte. Ich weigerte mich, suchte mir eine Anstellung in einem gottverlassenen Nest am Stadtrand von Jerusalem. Doch mich quälte das Gewissen. Ich mochte meinen Onkel, den Künstler, und gab mir die Schuld, dass er nun traurig und enttäuscht war. Er hatte so viel Hoffnung in den Jungen gesetzt, der mit offenem Mund bestaunte, was er zeichnete und malte, und hingegeben lauschte, wenn er die Laute spielte. Traurig sagte er dann: »Du hättest mein Sohn sein sollen, du bist ein Künstler.« Als Entschädigung für die Stumpfheit seiner eigenen Kinder wünschte er sich, dass ich seine Tochter heiratete. Sie hatte zartblaue Augen und war hübsch wie ein Porzellanpüppchen. Aber ich ergriff die Flucht vor meinem Onkel und seiner filigranen Tochter. Ich ließ meine gebrechliche Mutter und meine Schwester Sara allein in Jerusalem zurück, mietete mir ein düsteres Zimmer im Dorf und besuchte die Familie nur noch in den Schulferien und an Feiertagen.
Das Zimmer war groß, es nahm fast die ganze Wohnung ein. Das Gebäude stammte aus alter Zeit. Es war aus mächtigen Steinen errichtet und mit Naturstoffen, vor allem Mist, befestigt. Zement gab es damals nicht. Das Dach wölbte sich wie die Kuppel einer Moschee, und durch die kleinen Luken drang kaum Licht herein. Ich ließ Tag und Nacht die Lampe brennen, damit ich wenigstens ahnte, wohin ich meine Füße setzte. Die alten Steinbänke, Wasserbecken und Futtertröge für das Vieh, die Hühner und Truthähne hatte ich mit Brettern und Kissen abgedeckt und mir daraus Sitzgelegenheit, Regal und Schrank gebaut. In diesem Käfig lebte ich völlig zurückgezogen. Ich ging nicht einmal spazieren, bis der Frühling kam. Erst als die Welt sich allmählich erwärmte, der Boden grünte und die Knospen sprangen, durchstreifte ich das Dorf und erkundete die Berge und Täler der Umgebung. Von einem felsigen Hügel genoss ich den weiten Blick über die Strände von Netanya, Jaffa und Tel Aviv bis hin zum Horizont und träumte von einem Roman, in dem ich dieses Land und seine Geschichte beschreiben würde. Wie glücklich würde das meinen Onkel machen, immerhin hatte er mich in die Welt der Kunst eingeführt. Doch dann sah ich vor mir sein finsteres Gesicht und seine üble Laune, als ich die Heirat mit seiner beschränkten Tochter ablehnte. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und verkroch mich tagelang, bis der Trübsinn endlich verflog. Denn der Frühling lockte mit dem Duft der Gärten, und ich ging wieder hinaus, um auf den Feldwegen beim Gesang der Vögel zu träumen.
Eines Tages gelangte ich an die Südseite des Dorfes. Ich entdeckte einen Friedhof, der mir bisher nicht aufgefallen war. Die niedrigen Grabplatten waren mit Kreuzen geschmückt und trugen seltsame Namen: Michel, Anton, Antoinette, Simon … Plötzlich wurde mir bewusst, dass beim Läuten der sonntäglichen Kirchenglocken die Hälfte der Dorfbewohner verschwand und viele Läden geschlossen blieben. Ich bemerkte auch, dass es im Dorf eine zweite Schule gab, die weder staatlich noch karitativ war. Sie unterstand der Kirche. Der Geistliche trug einen Spitzbart und erinnerte eher an einen Künstler. Er sprach ein reines, fehlerloses Arabisch und predigte mit einem Reichtum an Worten, der mich beeindruckte. Er pries die Geschichte der Araber und die vorislamische Poesie und lehrte seine Schüler Lieder und Hymnen aus der Geschichte unseres Volkes. Ich lernte diese Hymnen von ihm, um sie danach meinen Schülern beizubringen. Auf diese Weise entdeckte ich, dass es innerhalb meiner Gesellschaft eine ganz eigene Gemeinschaft gab, fortschrittlich war sie und liebenswürdig. Wäre ich ungebunden, könnte ich mir gut vorstellen, in diesem Boden Wurzeln zu schlagen. Ich gewöhnte mir an, jeden Sonntag auf den Hügel zu steigen. Von dort blickte ich hinunter auf die Kirche und den Friedhof. Ich beobachtete die jungen Mädchen und Männer, die in ihren Sonntagskleidern fröhlich lachend zum Gottesdienst gingen. In einigem Abstand folgten die alten Frauen in schwarzen Gewändern und Schleiertüchern, bedächtig schwankend wie eine Entenschar mit vollen Kröpfen. Dann erklangen die Choräle, die Stimmen der Frauen mischten sich mit denen der Männer. Funkelnd perlten die Töne von den Dachziegeln der Kirche und strömten weithin über die Olivenbäume und Pinien bis zum fernen Horizont. Mir wurde so leicht ums Herz, so frei. Ich flog auf und davon mit den Vögeln, hoch über alle Wolken.
Ich weiß nicht mehr, wann und wieso ich mich in Mariam verliebte. Vielleicht war es zuerst nur eine Stimmung, die mich mit rätselhaftem Zauber überwältigte. Oder hatten die seltsamen Geschichten über Mariam meine Fantasie erregt? Ich verliebte mich Hals über Kopf, plötzlich war ich wie toll, außer Stande, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Ich war gleichzeitig zerstreut und bedrückt, sehnsuchtsvoll und melancholisch, und alles ohne logischen Grund. Dabei hatte ich sie nicht einmal aus der Nähe gesehen, hatte weder ihre Stimme gehört noch gar mit ihr gesprochen. Monatelang wusste sie überhaupt nichts von mir. Ach, diese Monate, dieser überquellende Frühling, diese Gedichte und Choräle und vor allem die Orgel! Vielleicht war sie an allem schuld. Oder waren es die zauberhaften Sonnenuntergänge auf dem Hügel, die Färbung des Himmels, der rote Abenddämmer? Wie ein schwarzer Schemen kam ihre Gestalt mit der Dunkelheit, wenn das Licht über der Welt und den verwitterten Gräbern verblasste. Wie ein Punkt glitt sie aus grauer Vorzeit über diesen Friedhof mit seinen römischen Säulenfragmenten und einem uralten Ölbaum aus der Epoche des Messias, in dessen Schatten einst Nureddin Zengi beim Feldzug zur Befreiung Jerusalems geruht haben soll. Vor meinem Auge verschwamm alles; die Welt wurde zum Paradies, zum Tempel der Mysterien! Auch Mariam gehörte zu diesem Traum, und genauso meine Gedichte, meine Legenden und die Erzählungen der Schriftsteller aus den Fünfzigerjahren.
Es begann an einem Sonntag. Ich saß wie immer auf dem Hügel, um die Kirchgänger zu beobachten. Nachdem sie durchs Dorf gezogen waren, sammelten sie sich im Hof und traten zum Gottesdienst in die Kirche. Erst tönte die Orgel, dann die kraftvolle Predigt des Priesters und ein getragener Choral. Ich wartete im Duft des Frühlings, im Schatten der Pinien, bis sie bei Sonnenuntergang wieder herauskamen. Eine Gestalt trennte sich von der Gruppe und ging allein zum Friedhof. Vor einem Grab blieb sie stehen. In meinen Augen war sie ein schwarzer Punkt, der sich vollkommen geräuschlos bewegte. Die Stimmen verhallten, gruppenweise verschwanden die Gläubigen, nur sie verharrte im roten Dämmerschein. Ich geriet in Panik, als stünde ich am Rande eines Abgrunds. War es eine Vorahnung? Lag es an der zauberhaften Stimmung, der melancholischen Einsamkeit oder jugendlichen Sehnsucht? Überbordete meine Fantasie? Sie weinte nicht. Sie las in einem kleinen Buch, und an ihrem Handgelenk baumelte ein feiner Rosenkranz. Ich erkannte das Kreuz, es war winzig wie ein Falter. Sie trug ein schwarzes Tuch aus gestickter Spitze. Eine Ziehtochter der Nonnen, dachte ich. Vielleicht eine Novizin, die ihr Gelübde noch nicht abgelegt hat und erst am Anfang des Weges steht. Ich wollte ihr den Weg abschneiden. Am liebsten wäre ich vom Hügel zu ihr hinabgesprungen, um sie zu trösten. Du bist ein Bild, ein Gedicht, ein Engel, würde ich ihr sagen, ja eine Liebesgeschichte, die es zu leben lohnt. Fliehen wir! Aber wohin, vor wem und wieso? Wer mochte sie sein? Was war ihre Geschichte? Wen hatte sie verloren? Hieß sie Salma? Fadwa? Nadschwa? Nein, ihr Name war Mariam. Nach langen Erkundigungen fand ich ihn heraus. Ich erfuhr auch, dass sie ihren kleinen Bruder Michaux beweinte und fast allein war, denn ihre älteren Geschwister lebten in Brasilien. Sie wohnte hier mit ihrer halb blinden Mutter und erhielt Unterstützung von ihren Brüdern und anderen Verwandten. Es war eine weit verzweigte Familie. Sie besaßen Ländereien bis an den Hügel – Olivenhaine, Weinberge und Plantagen voller Feigen-, Granatapfel- und Quittenbäume. Dort drüben, an der Seite des Hügels, stand ihr neues Haus, erbaut mit dem Geld des Exils. Die dicht bewachsenen Spaliere, der Wald aus Granatapfelbäumen und Pinien, eine Kuh, Hühner, der Weizenspeicher und die unbenutzte Ölpresse verliehen ihm ländliches Flair. Der Vater war vor langer Zeit ausgewandert, nachdem er seine Cousine geheiratet hatte. Sie bekamen Kinder, mehrere Knaben und ein einziges Mädchen. Nach dem Tod des Vaters führten die Söhne seine Geschäfte weiter. Als das Mädchen heranwuchs, beschloss man, sie mit der Mutter und dem kleinen Bruder ins Dorf zurückzuschicken. Der Rest der Familie blieb in São Paulo.
Woher ich diese Einzelheiten erfuhr? Beim Krämer und überall im Dorf. Was hatte man hier anderes zu tun, als auf dem Gehsteig vor dem Laden zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Man bestellte sich eine Wasserpfeife, ließ sie ein bisschen blubbern und sperrte seine Ohren auf. Da war einer gestorben, ein anderer kam wieder auf die Beine, dieser hatte geheiratet, jene wurde wegen der Töchter verstoßen, und diese erst, Gott bewahre! Wäre sie meine Schwester oder meine Tochter, ich würde sie einfach bei der Kehle packen und fest zudrücken. So sind die Regeln, so geht das in unserem Land!
Über Mariam hörte ich die merkwürdigsten Geschichten. Manche Leute sagten, sie sei heimgekehrt, um einen Verwandten aus dem Dorf zu heiraten. Andere behaupteten, sie wolle ins Kloster gehen und Nonne werden. Doch damit nicht genug. Es hieß, das Mädchen habe dringend Halt gebraucht, dort drüben wäre sie womöglich auf die schiefe Bahn geraten. Aber vielleicht sei sie ja wegen der Mutter zurückgekommen, denn die blinde alte Frau habe sich in der Fremde nicht zurechtgefunden. Kurzum, ihr Name begleitete mich, wo ich ging und stand. Ich spionierte ihr nach, postierte mich auf dem Hügel und starrte auf die Kirche und den Friedhof. Ich hatte mich in ein Phantom verliebt. Meine Fantasie gaukelte mir ein Bild voller Liebreiz und eine legendäre Liebesgeschichte vor. Je mehr ich über sie erfuhr, umso besser glaubte ich sie zu kennen. Damals wusste ich noch nicht, dass auch die Dorfbewohner eine blühende Fantasie besaßen. Jeder sah sie aus seinem Blickwinkel, und so widersprachen sich ihre Geschichten und Erklärungen. Aber meine Jugend, die Leere, unter der ich litt, mein beengtes Leben im Dorf – all das ließ mich nur zu gerne glauben, dass diese widersprüchlichen Aussagen ein Beweis für die reiche Persönlichkeit meiner Angebeteten seien, für dramatische Verwicklungen und Verwerfungen in ihrem Leben. Außerdem, diese dunkle Kleidung, das schwarze Tuch, der Rosenkranz, das Dröhnen der Orgel, die Kirche … Nein, nein, meine Liebe war von den himmlischen Mächten arrangiert, vom Schicksal gefügt! Ich las wieder Romane, ja ich verschlang sie und lebte in ihnen, bis ich in mir fühlte, was die Autoren beschrieben, was sie durchlitten, was sie in ihren Büchern erträumt hatten. In dieser Zeit, ich war gerade zwanzig, wusste ich noch nichts von der Kunst und vom Spiel mit Metaphern. Ich glaubte, jede Erzählung habe der Verfasser wirklich selbst erlebt oder wenigstens der Wirklichkeit nachgebildet, also war alles, was darin passierte, ein Abbild der Realität. So war mein Zustand, und ich verliebte mich bis zum Wahnsinn, obwohl ich ihr noch nie wirklich begegnet war. Sie ging nicht unter die Leute. Sie gehörte nicht dazu. Sie war nur ein Schatten, ein Bild.
Dann kam der Tag, an dem ich ihr zum ersten Mal begegnete und ihre Stimme vernahm. Ich sah sie ganz aus der Nähe, wenige Meter entfernt. Es war an einem Festtag. Der Priester hatte einige Gäste zum Mittagessen eingeladen, und sie war auch dabei.
Wir hatten bereits zu dritt oder viert am Tisch Platz genommen. An der Stirnseite saß der Priester, ihm gegenüber seine Frau Yvonne. »Fangen wir doch an«, sagte sie. »Die anderen kommen sicher nicht mehr.«
»Wollen wir nicht noch ein paar Minuten warten?«, fragte der Priester nachsichtig. Aber Yvonne entgegnete: »Wenn sie kommen wollten, wären sie längst da.« Wir begannen zu essen. Auch Wein stand auf dem Tisch. Zögernd bot der Hausherr mir ein Glas an. »Ja, gern«, sagte ich, »warum nicht.« Entschuldigend meinte er: »Ein wenig Wein erfreut des Menschen Herz.« Ich nickte: »So ist es«, und nahm einen großen Schluck.
Jemand sagte: »In der Wüste trank man früher Dattelwein, der haut einen um. Vom ersten Glas ist man berauscht. Bei der Gluthitze, oh, là, là!« Alle lachten, ich auch. Ich nahm noch einen Schluck und noch einen, mir wurde schwindlig. Es war zwar kein Dattelwein, und es wehte kein Wüstenhauch. Trotzdem begann die Welt sich zu drehen, denn ich hatte noch niemals Wein getrunken. Ich kannte ihn nur aus Filmen, in denen Farid Schauki mit einem anderen Hallodri anstieß, während eine kokette Tänzerin ihre Hüften schwang. Es waren die Filme der Fünfzigerjahre, in dieser Zeit bin ich aufgewachsen. Meine Eltern lebten ganz konservativ. Unser Haus lag eingesponnen in die Gässchen von Jerusalem rings um die Aksa-Moschee. In unsere vier Wände gelangte kein Wein. Wir wussten nichts darüber und legten auch keinen Wert darauf. Wir fürchteten ihn sogar, genauso wie Unzucht, Glücksspiel und Politik. Immerhin waren wir »ehrbare Leute«. Aber dann ließ mein Vater sich scheiden und heiratete wieder. Wir erfuhren, dass er sich betrinke, bis er sternhagelvoll war und einfach umsackte. So kam es uns zu Ohren, doch wir glaubten es nicht. Zumindest zweifelten wir, ob es stimmte. Schließlich hatten wir ja keine Ahnung, was nach der neuen Heirat mit ihm passiert war. Ändert sich der Mensch nicht mit den Umständen? Sieht man je eines Menschen innersten Kern? Jedenfalls hatte mein Vater früher keinen Tropfen angerührt, und ich bekam mein Lebtag keinen Alkohol zu Gesicht, außer im Kino, wenn etwa Istifan Rusti rief: »Komm, Christo, schenk nach!«
Die Klingel schellte, eine Tür wurde geöffnet. Wir hörten Geräusche. »Vielleicht ist sie es«, sagte der Priester. Yvonne brummte: »Zum Nachtisch!« Wir aßen weiter. Plötzlich sprang Yvonne auf, sie saß direkt neben der Tür, und rief: »Willkommen! Du bist spät dran. Es ist doch hoffentlich nichts passiert?« Als ich mich umwandte, erblickte ich sie, nur wenige Meter hinter mir. Das Blut stieg mir zu Kopfe, ich dachte, gleich falle ich um. Ich war wie vom Donner gerührt, mein Herzschlag setzte aus, dann schoss mir das Blut in alle Glieder, und die Welt ertrank in einer roten Flut. Mir war, als bebte die Erde. Für ein paar Sekunden trübten sich meine Augen, und ich sah und hörte nichts mehr. Als ich wieder zu mir kam, saß sie vor mir und entfaltete ihre Serviette. Ja, direkt vor mir, höchstens anderthalb Meter entfernt, auf Tischesbreite! War das zu fassen?
Sie schien so alt wie ich, vielleicht etwas jünger. Ihre Haut war weiß, milchweiß, und die Kleidung tiefschwarz. Ihr offenes Haar fiel herab bis auf die Schultern. Sie hatte ein ovales Gesicht, denn sie war schlank und feingliedrig. Ihre Lippen wölbten sich, durch die leicht vorstehenden Zähne wirkten sie voller. Aber das Wunderbarste waren ihre Augen – ein Flor aus dichten schwarzen Wimpern um strahlendes Weiß und geheimnisvolles Schwarz. Als sie mich ansah, verschlug es mir den Atem, und alles begann sich zu drehen. Es lag wohl ebenso am Wein wie an der Überraschung.
Der Priester scherzte: »Mariam will ins Kloster gehen. Wer hätte das gedacht?«
Seine Frau sagte mit leisem Tadel: »Wir waren uns doch einig, das Thema nicht mehr zu erwähnen.«
»Du hast Recht«, gab er zu. Er wandte sich an mich: »Und du, Ibrahim? Was hast du so vor?«
Die Frage verwirrte mich, ich wiederholte begriffsstutzig: »Was ich vorhabe?«
»Ich meine, in deinem Leben«, erklärte er. »Es geht doch um den Sinn deines Lebens, um dein Dasein. Was willst du anfangen?«
Ich blickte verlegen umher, dann erwiderte ich, zu ihr gewandt: »Nichts Großes. Ich werde weiter unterrichten.« Als ich den Priester ansah, lächelte er mir ermutigend zu und wartete, dass ich weitersprach. Verlegen gestand ich: »Ich möchte an der Uni in London studieren.«
»Und Gedichte schreiben«, ergänzte er.
Gequält berichtigte ich ihn: »Keine Gedichte. Es sind Geschichten, Märchen, Geheimnisse von Menschen.«
»Du forschst also die Leute aus, um ihre Intimitäten aufzuschreiben?«, fragte Yvonne.
Ich spürte, dass meine Ohren rot anliefen, und stotterte: »Nein, natürlich nicht! Ich schreibe über verborgene Dinge, um sie zu begreifen. Ich möchte nur verstehen, nicht mehr.«
Jemand warf streitsüchtig ein: »Die Geheimnisse der Seele kennt niemand als der Schöpfer allein. Ist es nicht so, Ehrwürden?«
Der Priester dachte nach. »Schon«, sagte er. Nach kurzem Schweigen murmelte er wie zu sich selbst: »Aber da gibt es auch die Schriftsteller. Manche jedenfalls.«
Der Querulant hatte wohl ein bisschen zu viel getrunken, vielleicht wollte er den Blick des hübschen Mädchens auf sich lenken. »Schriftsteller?«, rief er. »Wozu Schriftsteller? Warum nicht gleich Astronomen und Astrologen, Wundertäter wie die Scheicha Fatima und der Prediger von Ram? Alles Lug und Trug. Alles Schwindel. Die Seele kennt nur der Schöpfer.«
Der Priester lächelte. Er war ein begeisterter Liebhaber der russischen Literatur. »Hast du jemals Dostojewski gelesen?«, entgegnete er. »Oder Tschechow? Kennst du Krieg und Frieden oder Die Brüder Karamasow?«
Es folgte ein langer Vortrag über Dostojewskis Größe und seinen Beitrag zur Analyse der menschlichen Seele und ihrer Mysterien. Ich fühlte, wie diese Welt mich in ihren Bann zog. Eine dunkle, spannungsgeladene Atmosphäre, voller Leben, Szenen und Personen, Iwan, Dimitri, Elisa, und ich mitten darin. Sie und ich, Mariam und ich, das war unsere Welt. Meine auf jeden Fall. Ich gehörte zu ihnen. Unverwandt schaute ich Mariam an, und mein Inneres raunte: »Du bist die Heldin, du bist die Fabel, du bist die Verkörperung meiner Träume.« Mit einem Schluck leerte ich mein Glas.
Da saß sie nun, mir gegenüber, wenige Zoll von mir entfernt. Mariam. Ruhig hörte sie zu, ohne etwas zu sagen. Abwesend blickte sie in die Ferne und kehrte dann kurz zurück in unsere Runde. Sie lächelte nicht, nickte auch nicht mit dem Kopf wie wir. Sie sinnierte, ihr Blick wurde matt, verlor sich gleichsam in Trance. Noch hatte ich ihre Stimme nicht vernommen, nur ein Flüstern. Natürlich bestätigte dieses Schweigen ihre Rätselhaftigkeit und den Nimbus, mit dem ich ihre schwarze Gestalt auf dem Friedhof im roten Abenddämmer umhüllt hatte. Wie so oft schlüpfte ich in die Rolle des neugierigen Beobachters. Jede Geste, jedes Lächeln, jeder Augenaufschlag wurde meiner blühenden Fantasie zur Bestätigung. So war ich zweifach gefangen – von meiner uneingestandenen Liebe und dem Gaukelspiel meiner Einbildung.
»Hast du das Buch nicht gelesen?«, fragte mich der Priester.
Ich schreckte auf. »Welches Buch?«
Alle lachten. Sie lächelte, ich konnte ihre blitzenden Zähne sehen und war außer mir vor Entzücken.
Yvonne sagte: »Morgen holst du es in der Bibliothek.«
Zu ihrer Schule gehörte eine Bibliothek. Sie befand sich direkt hinter der Kirche, in einer schindelbedeckten Baracke zwischen hohen Pinien und Zypressen. Wenn mir der Priester ein Buch empfahl, beauftragte er seine Frau: »Gib es ihm.« Dann erwiderte sie eifrig: »Gleich morgen früh.« Am nächsten Tag verdrückte ich mich aus der Schule, und wenn ich hinkam, lag das Buch schon auf dem Tisch. Es wurde zur Gewohnheit. Er gab mir einen Tipp, ich rannte in der Pause zur Bibliothek, lieh mir das Buch aus und war vor dem Klingeln wieder zurück.
Eines Tages, genau wie ich es erträumt, besser gesagt geplant hatte, traf ich sie dort. Sie gab gerade ein Buch ab. Sobald sie zwischen den Regalen verschwand, lieh ich es aus. Ich eilte in meine Schule, anschließend nach Hause und vertiefte mich in das Buch, als sei es ihre Welt, Mariams Welt.
Die Verfasserin hieß Françoise Sagan. Kaum zwanzig, hatte sie in der Literaturszene bereits Furore gemacht. Das Buch war ein seltsames Gemisch aus Gedanken und Gefühlen, Wünschen und Fantasien. Es war abgegriffen und zerlesen. Bestimmt war es durch viele Hände gegangen. Überall standen Anmerkungen und Kommentare, einige waren durchgestrichen, andere, mit Tinte geschriebene, waren lesbar geblieben. Ich wusste, dass der Geistliche ausrangierte Bücher von der Amerikanischen Universität in Beirut übernahm. Die Unterstreichungen und Randnotizen stammten sicher von Studenten. Aber in meiner Rolle als Liebender und Detektiv deutete ich jede Linie und jede Notiz, wie es mir gefiel, nämlich als Hinweis auf die verborgenen Facetten ihrer reichen Persönlichkeit. Hier, diese Markierung etwa betraf eine philosophische Idee, die Entdeckung des Selbst. Aha! Sie ist auf der Suche nach ihrem Selbst! Diesen Abschnitt über Emotionen und Empfindungen hatte sie gewiss auch angestrichen. Sicher ertrank sie in einem ganzen Ozean von Gefühlen, diesen verschleierten, brennenden Blick besaß nur ein junges Mädchen mit starken Emotionen. In diesem Absatz über die Befreiung des Individuums von den Ketten der Gesellschaft hatte sie sich selbst erkannt, denn sie mied ja die Menschen, besuchte Friedhöfe, wollte gar ins Kloster gehen. Wenn die Heldin in Tränen ausbrach, begann ich erst recht zu interpretieren – all das waren doch Hinweise darauf, was sie liebte, fühlte und erstrebte. Mariam verschmolz mit der Heldin, nein, die Heldin war Mariam! Ich wusste schließlich nicht mehr, mit wem ich lebte und wen ich liebte. Ich lebte mit Mariam und liebte sie durch das Buch, durch die Welt der Bücher und die Bilder der Literatur.
Mir kam überhaupt nicht in den Sinn, dass es eigentlich um mich ging und nicht um Mariam. Diesen Irrtum, ja dieses Vergehen sollte ich erst später entdecken, zwei, drei Jahrzehnte danach. Meine Beziehung zur Welt war gestört, weil ich im Grunde nur mit Menschen verkehrte, die aus Büchern und meiner Fantasie stammten. Ich modellierte sie nach meinem Geschmack und Ermessen. Ich interpretierte in meiner Begeisterung ihren Charakter und ihr Schicksal, wie es mir gerade einfiel, wie es meinen Gedanken, Träumen und Vorstellungen entsprach. Doch jedes Mal erlitt ich wieder Schiffbruch. Denn ich sah Hintergründe, wo es keine gab, und baute meine Erwartungen auf Visionen. Alles brach zusammen, wenn ich entdeckte, dass eine Frau, ein Mann oder ein Vorfall meine Hoffnungen durchkreuzte. Dann litt ich tage-, ja wochenlang. Handelte es sich um eine Frau, waren es mehrere Monate. Wie Salz lösten sich meine Illusionen auf, und meine verletzte Seele wurde zum Schatten ihrer selbst. Am Ende war ich derselbe wie vor der Begegnung, vor der Affäre. Einsam vergrub ich mich in die Bücher und flickte meine Träume zusammen.
Yvonne ertappte mich, als ich Mariam durch ein Bücherregal beobachtete. »Sie gefällt dir wohl?«, fragte sie.
»Wie bitte?« Geflissentlich schaute ich zum Fenster hinaus.
»Sei vorsichtig«, flüsterte sie. »Lass die Finger davon.«
Ich sah sie an. Sie katalogisierte ein Buch, aber sie lächelte freundlich. Sie hatte also gemerkt, dass ich hinter dem Mädchen her war und die Bibliothek immer dann aufsuchte, wenn sie auch gerade kam. Anfangs sah es wie Zufall aus, doch als es sich wiederholte, hatte sie zu zweifeln begonnen.
Sie setzte hinzu: »Mariam ist ganz zufrieden mit ihrem Leben. Und ihre sieben Brüder bewachen sie wie die Schießhunde, sie ist ja ihre einzige Schwester. Ohne den Pfarrer wäre sie längst im Kloster.«
»Ein Pfarrer?«, fragte ich verblüfft. »Was meinst du?«
Sie lächelte mild. »Nichts, gar nichts. Aber Mariam … Ich wollte sagen … das katholische Kloster … Jedenfalls, hier ist dein Buch.«
Ich nahm das Buch und ging. Doch von Stund an war ich verstört. Verbotenes ist süß, und Süßes macht süchtig. Fortan sah ich mich nur noch als Opfer, und sie war die Täterin.
Junge, rette deine Haut, dachte ich nach einer unruhigen Nacht voller Albträume und Ängste. Du bist ein Spinner. Mariam ist eine Fiktion, ein Hirngespinst. Was weißt du von ihr? Von ihrer Welt? Weißt du denn, ob sie dich will? Oder überhaupt einen Mann? Sie möchte ins Kloster, überlege doch! Selbst wenn sie etwas für dich übrig hätte, dann steht immer noch die andere Religion dazwischen. Und deine Armut, du lebst ja von der Hand in den Mund. Nicht zu vergessen deine Mutter, deine Schwester, all die Verwandten und Bekannten in den Gassen um die Aksa-Moschee. Befreie dich von deinen Illusionen!
Am nächsten Donnerstag packte ich mein Köfferchen und flüchtete zu meiner Mutter. Ich traf sie beim Kochen in der düsteren Küche unseres Hauses. Es war ein uraltes Gebäude. Mein Vater hatte es einer Familie abgekauft, die bei der Gründung des Staates Israel, gleich zu Beginn der Auswanderungswelle, nach Amerika emigriert war. Ein herrschaftliches Haus. Auch beim Mobiliar hatte Vater weder Kosten noch Mühe gescheut. Stück für Stück bestellte er vom besten Geschäft in Jaffa, das war sein ganzer Stolz. Zuletzt erstand er ein altes Klavier von einem emigrierten Juden, der ihm rasch noch die Tonleiter und Ehrfurcht vor Beethoven beibrachte. Doch mein Vater behielt die Tonleiter nicht, und überhaupt lauschte er lieber der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum. Er liebte Musik und Gesang, auch das Kino und »Teatro«. Er liebte das Leben. Als sich Gelegenheit bot, in einem jüngeren, aufregenderen Milieu neu anzufangen, ließ er meine Mutter und uns Kinder sitzen. Er heiratete eine zwanzig Jahre jüngere Frau und begann Laute zu spielen.
Meine Mutter ist einmal sehr hübsch gewesen, die schönste Tochter einer ehrwürdigen, aber verarmten Familie. Von Großvater, der zur Türkenzeit als Oberrichter in Astana amtiert hatte, konnten meine schwer geprüften Onkel jedenfalls nichts Nennenswertes erben. Trotzdem schwärmte Mutter unentwegt vom alten Ruhm und brüstete sich mit dem Ruf der Familie. Als Ismail, mein Vater, um ihre Hand anhielt, wies mein Großvater ihn beim ersten und beim zweiten Mal ab, denn trotz seines Reichtums besaß dieser Bewerber keinerlei Ansehen. Da schwor Vater vor der Aksa-Moschee und hunderten von Zeugen, Widad werde ihm gehören, ansonsten fließe Blut. Er begann jeden Freier zu bedrohen, bis alle sich verkrümelten. Am Ende blieb nur er übrig, dieser »Tagelöhner und Sohn eines Steinhauers«, wie Großvater ihn im Jähzorn nannte. Immerhin war er Oberrichter mit einem Turban, und mein zweiter Großvater bloß Steinmetz mit einer Pluderhose, so groß wie ein Fallschirm.
Doch dann kaufte der Großvater mit der Pluderhose in Jaffa eine Säge. Er klopfte keine Steine mehr, sondern schnitt sie in Quadern aus dem Berg. So wurde er reich. Der andere Großvater, ausgestattet mit Siegel und hohen Würden in Astana, wohlbeschlagen in allem, was unsere Tradition betraf, ereiferte sich: »Dieses unmoralische Subjekt verschleudert unseren Boden an die Juden!« Damit meinte er, dass der Steinmetz und sein Sohn Felsquader für den Häuserbau im Judenviertel von Westjerusalem verkauften. Dennoch, Vater heiratete Mutter dank eines Handels, der bis heute Gewinn abwirft. Der Turban-Großvater aber starb in Armut. Seine Söhne waren beschränkt und ohne besondere Talente, auf die man stolz sein konnte, außer dem einen, der schöne Kalligrafien malte. Mein Vater kaufte meine Mutter für einhundert Medschidi, Goldlira mit hohem Karat. Die Brüder teilten die Summe unter sich auf und ließen für meine Mutter nur fünf übrig. Sie nähte die Münzen auf ein Samtband und trug es um den Hals als Beweis für den hohen Wert ihrer Schönheit.
Wenn ich sie jetzt betrachtete, ahnte ich nur noch die frühere Schönheit. Ihr graues Haar war unfrisiert, der Körper füllig und schwammig. Ihr faltiger Hals war noch immer hellhäutig, aber blutleer wie eine Kerze. Meine Mutter, die stolze, vitale Frau von einst, gab es nicht mehr. An ihre Stelle war eine andere mit Runzeln und Krähenfüßen getreten. War die Zeit daran schuld, oder der Kummer? Wohl beides, doch der Kummer zerstörte die letzten Reste ihrer Gesundheit, ihres Stolzes, ihrer Lebenskraft, er machte sie schlaff und schwerfällig.
Sobald sie mich erblickte, rief sie: »Ibrahim! Ich habe so auf dich gewartet!« Sie umarmte mich, und ich spürte, wie sie zitterte, wie gebrechlich sie war. Sie wischte sich die Tränen ab, dann zog sie mich an den Tisch und fragte besorgt: »Sag, wie geht es dir? Erzähl erst mal.« Ich setzte mich und berichtete ihr das Neueste von meiner Arbeit, dem Unterricht und dem Zimmer, auch übers Essen, Trinken und Waschen und meine Korrespondenz mit der Universität. In ein paar Jahren würde ich ein Zertifikat erwerben, mit dem ich sogar Direktor werden könnte. »Kommst du wieder nach Jerusalem?«, fragte sie nur. Da wurde ich traurig, ich wusste nicht, warum, aber mein Herz war auf einmal bedrückt.
Vor Sonnenuntergang traf meine Schwester Sara ein, sie hatte noch eine Menge für ihre Hochzeit vorzubereiten. Beim Abendessen raunte sie mir zu, Vater habe irgendwas angestellt. Weiter verstand ich nichts, weil Mutter ärgerlich dazwischenfuhr: »Was gibts da zu flüstern? Redet laut, ich will mithören!« Meine Schwester verstummte, dann sagte sie kleinlaut: »Darf man nicht mal etwas fragen? Wie ists so im Dorf, Ibrahim? Kann man da leben, gehts dir gut?« Mutter zischte: »Möge Gott dir vergeben, Muhammad!« Sie meinte meinen Onkel, den Kalligrafen, denn er war der Grund für meinen Weggang.
»Das Gänschen ist ja nun verlobt», sagte meine Schwester. »Damit sind wir sie los. Warum kehrst du nicht zurück?«
»Du musst kommen«, befahl meine Mutter. »Soll ich ganz allein leben? Jawohl, sie ist verlobt und vergeben, alles hat sich eingerenkt. Dein Onkel ist heilfroh und glücklich. Die Sache ist also erledigt. Kehre zurück! Das Haus steht leer. Bald wird deine Schwester ausziehen, und ich bin einsam. Du musst heimkommen!«
Ich fühlte mich so traurig. Mutter war nicht mehr dieselbe. Früher hatte sie ein strenges Regiment geführt. Ein Wort von ihr, und das Haus bebte. Wir Kinder flüchteten, durch die Korridore, treppauf, treppab, und versteckten uns unter den Betten, hinter den Schränken und im Bad. Sie schlug nicht zu, schrie uns nicht einmal an. Aber unter ihrem scharfen Adlerblick schmiegten wir uns eng aneinander. Die Angst verband uns, und die gedrückte Stimmung ließ uns verstummen. Obwohl wir noch klein waren, machten wir uns Sorgen, denn unsere Mutter ging viele Jahre in Trauer. Das Schicksal hatte ihr den liebsten Menschen geraubt, Waddah, ihren Erstgeborenen. Wie eine Flamme hatte er sich selbst verzehrt. Als Jugendlicher schwänzte er die Schule und trat der Rettungsarmee von Amin al-Husaini bei. Am Tor von Jerusalem ist er dann gefallen, und ich war der einzige Ersatz für ihn. Nach seinem Tod bekam sie Blutungen und eine seltsame Krankheit, die alle Föten abtötete, sodass sie fortan nur Fehlgeburten hatte. Wir blieben eine sehr kleine Familie. Kein Araber, der auf Abstammung und Nachkommenschaft Wert legt, könnte sich damit abfinden. Natürlich bot das alles meinem Vater einen plausiblen Entschuldigungsgrund, als er sich wieder verheiratete. Er sagte den Leuten: »Ich will eine Frau, die Männer zur Welt bringt.« Und ich? Was war ich? Etwa kein Mann? Nein, durchaus nicht. Ich war bloß ein schwächlicher, blutarmer Bub mit blassem Gesicht. Vater musterte mich voller Skepsis. Ich glaube, er fragte sich, ob ich überhaupt lebensfähig war und seinen Namen vererben konnte. Deshalb erklärte er bei seiner zweiten Heirat: »Ich brauche einen Jungen, der meinen Namen weitergibt.« Also besaß Ismail keinen Stammhalter. Und ich? Laut schluchzte ich auf. Überrascht fuhr er herum, denn er wusste nicht, dass ich mich hinter dem Schrank versteckt hatte und lauschte. »Was treibst du da?«, rief er verblüfft. Verlegen und entschuldigend sah er seinen Gast an und schüttelte den Kopf. Der Gast murmelte nur: »Es gibt keine Macht noch Stärke als bei Gott!«
Meine Schwester tat nie einen Mucks, sie war sowieso kein männliches Wesen, keine Spur davon. Sie hörte zu, schlug den Blick nieder und zuckte mit den Schultern, dann stöhnte sie: »He! Geht das schon wieder los!«
Meine Mutter und meine Schwester waren für mich die größte Sorge. Wäre Mutter gestorben, hätte Vater mich gewiss zu sich genommen. Ich würde jetzt bei ihm wohnen, hätte mich an ihn und seine neue Frau und das Lautenspiel gewöhnt. Womöglich hätte er mich an die Amerikanische Universität in Beirut geschickt, das taten alle Wohlhabenden mit ihren Söhnen. Er hätte mich bestimmt gut versorgt. Dieses ständige Knausern und das hässliche Zimmer, ach, dieser Hammelpferch, wären mir erspart geblieben. Aber nein! Mit meinem Dickschädel, da war ich genau wie mein Bruder, musste ich unbedingt bei Mutter bleiben und wollte ihn nicht mehr kennen. Mit der Zeit vergaß ich ihn sogar, und er vergaß mich. Wir wurden einander fremd.
Mutter sagte: »Deine Schwester möchte, dass du ihn aufsuchst.« Sie meinte Vater. »Er hat ihr ein tolles Hochzeitsgeschenk versprochen – ein Schlafzimmer.«
Sie stockte und sah mich an. Ich schaute wortlos ins Leere.
»Ein Schlafzimmer!«, rief sie wütend. »Jemand mit so viel Ländereien, Häusern und Geschäften hätte irgendwas Prachtvolles bringen sollen, schon wegen der Leute. Aber dein Vater, pfui Teufel …« Sie hörte nicht auf zu schimpfen und zu brummen.
»He, jetzt geht das wieder los!«, murmelte Sara. Mutter vernahm es und sah sie scharf an.
Ich wollte mich in die Küche verdrücken. Unterwegs drehte ich mich um und fragte meine Schwester: »Und was meinst du dazu?«
Sie antwortete kühl, ohne mich anzusehen: »Was ich meine?«
»Na, zu dem Schlafzimmer«, erinnerte ich sie.
»Welches Schlafzimmer?«
In so einer Situation, wenn Sara sich dumm stellte, verlor ich den Verstand. Ich begann zu schreien: »Welches Schlafzimmer? Du weißt wohl nicht, welches? Hörst du mir überhaupt zu?« Sekundenlang starrte sie mir ins Gesicht, dann zuckte sie mit den Schultern und knurrte: »He, geht das wieder los!« Doch diesmal fühlte ich mich beschämt. Wochenlang hatte ich die beiden allein gelassen und nur noch an Mariam gedacht. Sara wollte heiraten, dann wäre Mutter wirklich ganz einsam. Denn ich würde das Dorf nicht verlassen und in die Jerusalemer Gassen zurückkehren. Dort im Dorf hatte ich mein Herz verloren. Dort war mein Leben, meine gelebte Literatur. Das Dorf bot mir eine verwunschene Zuflucht, wo ich mich vor der Welt und unseren Problemen verstecken konnte, vor den Schwierigkeiten mit Vater und Mutter und Saras Blödeleien, vor dem Ärger mit meinem Onkel und dem üblichen Familienstreit.
Ich schlug einen ruhigeren Ton an: »Du möchtest also, dass wir ihn besuchen gehen?«
»Wen?«
Ich brauste nicht auf, lächelte sie geduldig an: »Unseren Vater.«
Sie schwieg ein Weilchen und dachte nach, als handle es sich um etwas ungeheuer Wichtiges, Schwerwiegendes. Schließlich sagte sie: »Wenn du nichts dagegen hast.«