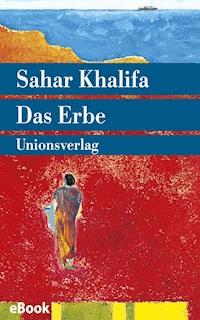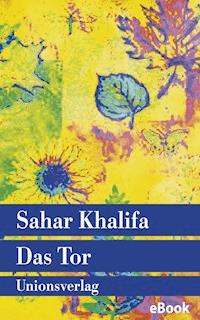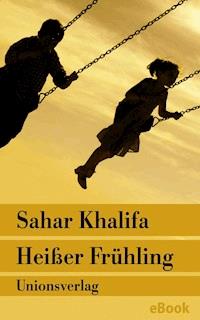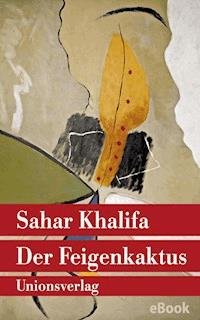8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie wächst auf als Tochter eines Schulinspektors, und durch ihre Verheiratung wird sie zur Händlersgattin. Sie lebt in einer Welt, in der der Mann das Juwel des Hauses, der Schmuck der Schwestern und der Augapfel der Familie ist. In der Leere, Enge und quälenden Einsamkeit ihres Ehelebens verliert sie sogar die Fähigkeit zu träumen, taugt bald nicht mehr zum Leben, wird zu einem Häufchen Asche. Als sie Jahre später und gegen tausend Ängste ihren Mann verlässt, steht sie vor dem Nichts. Erst nach vielen Kämpfen erkennt sie, dass ihre Gefühle im Recht sind und der Stolz eine Lebensgrundlage ist. Dieser sehr persönliche Roman hat durch seine Offenheit in der arabischen Welt Aufsehen erregt: Eine Generation von Frauen hat sich in ihm wiedererkannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Aufgewachsen als Tochter eines Schulinspektors, wird sie durch ihre Verheiratung zur Händlerstattin: sie, die Namenlose in einer vollständig auf die Bedürfnisse des Mannes ausgerichteten Gesellschaft. Als sie Jahre später ihren Mann verlässt, steht sie vor dem Nichts und muss sich das Recht auf Gefühle und Stolz in langen Kämpfen erringen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sahar Khalifa (*1941) ging mit achtzehn Jahren eine traditionelle Ehe ein, die dreizehn Jahre dauerte. Nach der Scheidung widmete sie sich verstärkt dem Schreiben, studierte in den USA und arbeitete an der Universität Bir Zeit. In Nablus gründete sie ein palästinensisches Frauenzentrum.
Zur Webseite von Sahar Khalifa.
Leila Chammaa (*1965) ist seit 1992 als Übersetzerin arabischer Prosa und Lyrik ins Deutsche und als Beraterin tätig. 2004 war sie Koordination der literarischen Lesungen im arabischen Ehrengastprogramm auf der Frankfurter Buchmesse.
Zur Webseite von Leila Chammaa.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sahar Khalifa
Memoiren einer unrealistischen Frau
Roman
Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die arabische Originalausgabe erschien 1986 in Beirut.
Originaltitel: Mudakkirat imra’a gair waqiciya (1986)
© by Sahar Khalifa 1986
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30691-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 20:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
MEMOIREN EINER UNREALISTISCHEN FRAU
Ich bin die Tochter des Inspektors; ich blieb …1 – Mit den Dingen verbinden mich Geschichten. Für mich …2 – In allem suchte ich Zuflucht, sogar in der …3 – Der Tag beginnt mit einem unbeugsamen Verharren hinter …4 – Der Februar und meine Katze. Als hätte ein …5 – Nein, ich war keine realistische Frau. Seit ich …6 – Wochen vergehen, ohne dass einer den anderen anspricht …7 – Je mehr ich mich ins Malen verliebte …8 – Je mehr mich die Leere umgab, desto unausgefüllter …9 – Deine Augen, Anbar, kennen kein Leid. Neid entflammt …10 – Dennoch verreiste ich. Ich erfand alle möglichen Ausreden …11 – Ich lief zum Flugzeug und schaute mich um …12 – Sie streckte beide Hände aus und jubelte mit …13 – Amman, du Gefängnis der Armen. Ich gehe verloren …14 – Als wir uns begegneten, war es Abend …15 – Nie sah ich etwas, das mit dem Apfel …16 – Ich sah die Brücke nicht, sah die Gesichter …17 – Ich erwachte in der Morgendämmerung vom vertrauten Trommeln …18 – Meine Mutter setzte sich. Der Duft der Wasserpfeife …19 – Ich ging in unserem Garten umher, sprang über …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Sahar Khalifa
Über Leila Chammaa
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Sahar Khalifa
Zum Thema Palästina
Zum Thema Israel
Zum Thema Arabien
Zum Thema Frau
Zum Thema Asien
Zum Thema Kindheit
Ich bin die Tochter des Inspektors; ich blieb es, bis ich heiratete, wurde dann die Ehefrau eines Händlers. Gelegentlich bin ich beides. Verspottet mich mein Mann, so nennt er mich »Inspektorentochter«, ist mein Vater verärgert, nennt er mich »Händlersgattin«. Ja, gewiss, ich war glücklich, die Tochter des Inspektors zu sein. Denn der Inspektor verkörpert Wissen und Würde, er besitzt Autorität über die gesamte Lehrerschaft. Ging mein Vater durch die Straßen, erhoben sich viele Hände zum Gruß: »Guten Morgen, Herr Professor« oder »Guten Abend, Herr Professor«, »Auf Wiedersehen, Herr Professor« und »Willkommen, Herr Professor«. Meinem Vater gelang es vortrefflich, sich wie ein Professor zu gebärden, im Klassenzimmer, zu Hause, überall. Entsprechend verhielt man sich auch ihm gegenüber. Aufmerksam folgte man seinen Erläuterungen, nickte dabei mit dem Kopf und sprach: »Recht haben Sie, Herr Professor.« Diese Anrede genoss mein Vater sichtlich. Seine Ausführungen fanden kein Ende, während die Leute nickten und nickten. Und ich war maßlos stolz. Je stolzer ich wurde, desto mehr wollte ich hören. Weil ich darunter litt, als dumm zu erscheinen, behielt ich meine Fragen und Eindrücke für mich. Ich zog meine Lippen zusammen und ging mit festem und sicherem Schritt. Damit war ich so lange zufrieden, bis es mich langweilte. Ich stieß einen explosionsartigen Laut aus, woraufhin mein Vater sagte: »Das ist ein flatterhaftes Mädchen!« Um meine Festigkeit wiederzuerlangen und nicht für dumm zu gelten, fragte ich nicht nach der Bedeutung des Wortes. Im geheimen schlug ich im Wörterbuch nach und stellte fest, dass es eindeutig im Zusammenhang mit »Luft« steht. Ich war beruhigt, denn Luft ist leicht, erfrischend und lebenswichtig. Mein Vater erklärte die Sache aber aus einem anderen Blickwinkel. Er behauptete, Flatterhaftigkeit sei ein Mangel an Ehrfurcht. Entsetzt über diese Vorstellung, ordnete ich mich unter, um gelobt zu werden. Schließlich hatte ich es satt; ich atmete heftig aus. Als ich wieder einatmete, blieb allen anderen die Luft weg.
Ich war die Tochter des Inspektors, bis ich heiratete, wurde dann die Ehefrau eines Händlers. Ich fühlte mich sehr erhaben als Tochter des Inspektors, des Professors und als Spross einer ehrenwerten Familie und weil mein Vater alle Familienangelegenheiten mit Stolz und Würde behandelte.
Meinem Vater wurde wegen seiner beruflichen Stellung Hochachtung entgegengebracht; die Würde hatte er von seiner Familie geerbt. Man konnte gar nicht umhin, ihn zu achten. Natürlich wurde auch ich, Tochter eines geachteten Mannes, respektiert. Nun ließ ich aber meiner Flatterhaftigkeit freien Lauf und überschritt dabei das akzeptable Maß. Aber schnell gewann ich meinen Atem wieder, zügelte mich und festigte meine Schritte. Ich ließ meine Lippen ihre gewohnte Stellung einnehmen, und mein verschlagener Gesichtsausdruck wich einer Unschuldsmiene. All das führte dazu, dass mich die Leute als schamlos charakterisierten. Mit der Zeit entdeckte ich, dass ich eine schamlose Respektierte oder eine respektable Schamlose war. Ich begann zutiefst an meiner Identität zu zweifeln. Zwar war ich ein Mädchen, aber in meiner Angst, die aus den Ängsten der Leute um mich entstand, verhielt ich mich wie ein Junge. Ich fühlte mich als Zwitter. Da ich den Wunsch hatte, mehr Respekt zu erlangen, lehnte ich meine Eigenschaften ab und wurde zu einem Hermaphrodit. Sie ist weder Mann, noch ist sie Frau. Diese Worte hörte ich die älteren, erfahrenen Frauen der Familie lächelnd oder düster, wohl wollend oder warnend über mich sagen. Mir war ihr Gerede recht, ich fürchtete das Schweigen mehr.
Meine Identität wurde noch diffuser, als ich in der Schule feststellte, dass die Mädchen armer Familien unbeugsamer, aufrichtiger und geistreicher waren. Meine mühevollen Versuche, sie im Sprechen und Verhalten nachzuahmen, bewirkten nur, dass ich von beiden Seiten abgelehnt wurde. Die reichen Mädchen akzeptierten mich nicht in ihrem vornehmen Milieu. Die armen Mädchen nahmen mich nicht in ihre zerrüttete Umgebung auf. Die einen blickten mich verächtlich aus den Augenwinkeln an, die anderen schauten mir mahnend ins Gesicht. Ich verlor mich zwischen diesen und jenen, so wie ich mich bereits zuvor zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen verirrt hatte. Dennoch blieb ich die Tochter des Inspektors und wurde dann die Ehefrau eines Händlers. Ich verlor mich zwischen meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und den Wegweisern der Zukunft. Sie zu deuten, war ich nicht in der Lage. Das Schwanken wurde zu einem fest verwurzelten Zustand. Außer Stande, über mich selbst zu entscheiden, überließ ich mich ihren Entscheidungen und Befehlen. Selbst da verlor ich mich zwischen und in ihren Befehlen. Weder war ich eine gute Ausführende, noch war ich eine erfolgreiche Meuterin. Kein Wunder, dass ich auf wackligen Beinen stand und mir die Hände zitterten. Ich ließ denn auch viel Glas fallen, das dann verstreut auf dem Boden lag, und verletzte mir den Schenkel. Noch mehr Stolpersteine. Unter Schreien und Fluchen meiner Mutter sammelte ich die Scherben auf und schnitt mir in die Hand. Als ich das Blut sah, überkam mich Angst. Ich wollte allem den Rücken kehren, hing jedoch fest. An Ort und Stelle erstarrt, stand ich auf einem Bein, während das andere in der Luft schwebte.
So kam ich zur Ruhe und unterbrach meine Mühsal. Ein Bein auf dem Boden, eins in der Luft. Jahre schlummerte ich in dieser Stellung. Als ich eines Tages aus dem Schlaf erwachte, fand ich mich als Ehefrau eines Händlers wieder. Welch ein Unglück. So viel Ansehen hatte mich im Hause des Inspektors begleitet. Ich verzweifelte. Überzeugt, dass das Unglück mein Los war, versuchte ich auch nicht, verändernd einzugreifen. Nur im Traum und durch die Lüge versuchte ich, etwas zu verändern. Aber damit lässt sich kein Weg bahnen. So blieb ich reglos erstarrt. Wehe ihr, wenn sie sich dreht, und wehe ihr, wenn sie sich nicht dreht. Es kam mir vor, als stellte ich mich gegen den Wind. Es war, als blase er mir ins Gesicht, und ich gab den Stoß zurück. Ich begann, die Melodie der »Flatterhaftigkeit« wieder anzustimmen. Das Wörterbuch versicherte mir von Neuem, dass dieses Wort mit unser aller Lebensgrundlage zusammenhängt. Ich sagte mir, da die Luft belebend, lieblich und leicht ist, bin auch ich lebendig und sympathisch. Wer diese Eigenschaften aber offen zeigt, erleidet Unrecht.
1
Mit den Dingen verbinden mich Geschichten. Für mich existiert keine Trennungslinie zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Gegenständen. Sie sind in meinen Augen alle Dinge. Auch die Menschen sind Dinge? Gott bewahre! Aber Dinge sind Menschen. Für mich leben die Dinge in ihrer eigenen Welt und die Menschen ebenso in einer eigenen Welt. Die Welt der Menschen und die der Katzen, die Welt der Äpfel, die der Geschichten und der Lieder. Lauter eigene Welten. Ich behandle die Dinge mit einer Zärtlichkeit, die fast schon kindisch ist. Gehe ich mit ihnen freundschaftlich um, erwidern sie meine Gefühle. Ganz anders die Menschen. Nähere ich mich ihnen, fügen sie mir Leid zu. Doch war es nicht meine Schuld. Ich wurde so geboren, nein, vielmehr wurde ich zu dem geformt. Ein Mädchen zu sein, das erkannte ich, ist ein Unglück. Das Männliche bäumte sich vor mir auf, eingehüllt in ein königliches Gewand. Ich begriff, dass Liebe Schande ist, deshalb bedeutete mir das Männliche den kürzesten Weg ins Grab. Auch verstand ich, dass es Hochachtung ohne Folgsamkeit und Gehorsam nicht gibt. Ich gehorchte, bis ich es leid war. Ich explodierte. Ich drückte das Wörterbuch an mich. Ich fand »Anbar«, verbarg sie an meiner Brust und versteckte mich mit ihr.
Mit dem Apfel verbindet mich eine Geschichte. Mein Vater hielt mich an der Hand, während wir durch die Straßen gingen. Ich sah Männer mit Hüten und Ziegenbärten, hohe Gebäude und Läden, voll mit bunten Dingen, die den Blick einfingen. Ich war ein Kind von der Größe einer Katze und hatte Phosphoraugen. Zum ersten Mal erblickte ich Frauen mit ärmellosen Kleidern. Wir befanden uns in Jaffa. Die Stadt war immer noch eine besondere Stadt. Wir kamen an einem Apfelverkäufer vorbei, der die Äpfel auf seinem Wagen zu einer Pyramide aufgetürmt hatte. Wie immer war ich hin und weg. Ich blieb wie angewurzelt stehen und ging keinen Schritt weiter. Mir wurde ein Apfel, riesig wie ein Ballon, ausgesucht. Er war rot und glänzte wie ein Rubin. Obwohl mein Vater drängte, aß ich ihn nicht. Als er sah, wie ich den Apfel in den blendenden Sonnenstrahlen drehte und wendete, lachte er. Er holte ein Taschentuch hervor, polierte den Apfel, sodass er noch stärker glänzte und meine Begeisterung zunahm. Mal rieb ich ihn an der Brust, mal betrachtete ich ihn, hüpfend, in der Sonne. Ich war so sehr mit dem Apfel beschäftigt, dass ich mich selbst vergaß. Ich schwieg und sah nichts außer meinem Apfel. Mein Vater summte beim Autofahren. Denn trotz seiner respektablen Stellung liebte er es zu summen. Ich bewegte meinen Kopf im Takt dazu, während mein Blick wie gebannt an der roten Farbe hing. Ich rieb ihn, und er glänzte; ich betrachtete ihn lächelnd, und mein Vater lächelte. Da ich noch klein war, lächelte mein Vater nur und sagte: »Iss ihn!« Aber ich drückte ihn an meine Brust, und er erwiderte meine Berührung. Der Apfel war kein Apfel, er war ein lebendiges Wesen. Wäre sein Name nicht Apfel, hätte ich ihn Samira oder Amira genannt.
Als wir zu Hause ankamen, versammelten sich die Kinder um mich und schrien: »Ein Apfel, ein Apfel!« Ich erschrak. Ich umklammerte ihn, und mir war, als würde mir die Seele aus dem Leib gerissen. Sie versuchten, mir den Apfel zu entwinden, doch kämpfte ich um ihn. Ich hörte, wie meine Mutter meinen Vater nach dem Arztbesuch fragte. Ich wünschte mir so sehr, er würde sagen, ich sei krank und müsse bald sterben. Vielleicht ließen sie dann den Apfel in Ruhe. Um mich waren nur noch Kindergeschrei und der Apfel.
Meine Mutter tadelte den Vater auf sanfte Weise. Er erwiderte, die Stadt sei voll von Äpfeln, und ich sei nicht krank. Sie versuchten, mir den Apfel zu nehmen. Ich rollte mich um ihn und wurde zu seiner menschlichen Hülle. Schließlich trennte meine Mutter mich doch von dem Apfel. Ich hängte mich an sie, weinte, schimpfte. Sie schlug mich. Aber ich hängte mich nur noch fester an sie. Ich fühlte, wie meine Haut brannte, als die Kinder »Ein Apfel, ein Apfel!« schrien. Sie hatten mir den Apfel entrissen, und ich wurde gewahr, wie ein gewaltiges Messer den Apfel schlachtete und ihn in Stücke zerteilte. Als ich sah, wie meine Mutter die rote Schale abzog, stellte ich mir sein Blut vor und fürchtete mich; ich hasste. Ich vergoß Tränen um ihn. Der Apfel hatte gelebt, und jetzt war er tot. Ich hatte ihn und er mich geliebt. Ich hatte ihn an meine Brust gedrückt und er sich an mich geschmiegt. Er war von mir, von meiner Welt. Und da war die Mutter; sie hielt mir ein geschältes Stück hin, das auf einem Messer aufgespießt war. Ich sollte das Fleisch des Apfels essen! Ich warf mich auf den Boden und stellte mich tot; sie glaubten mir nicht. Ein Verwandter fragte, was mit mir sei, näherte sich mir und hätschelte mich, denn ich war noch klein. Er fragte nach dem Grund meines Todes, sie antworteten: »Der Apfel!«
Er wandte sich an mich, obwohl ich tot war: »Stimmt es, dass du so gierig bist und den Apfel allein essen willst?«
Ich erwachte plötzlich aus dem Tod und schrie: »Ich, den Apfel essen? Wie könnte ich je den Apfel essen?«
Als sie in Gelächter ausbrachen, explodierte ich. Meine Kehle war zugeschnürt, und ich schlug meinen Kopf auf den Boden, dass es widerhallte. Unaufhörlich brüllte ich: »Dieser Apfel ist anders, anders!«
Während ich den Kopf auf den Boden schlug, äfften sie mich fortwährend nach: »Dieser Apfel ist anders, dieser Apfel ist anders!«
Auch meine Katze ist anders. Sie liebt mich, hört mir zu und erzählt mir Geschichten. Geschichten für Kleine, Geschichten für Große und die Geschichte, die mich mit dieser Welt verbindet. Ich fand sie auf einem Müllhaufen. Ich nahm sie mit, putzte sie und machte aus ihr einen Menschen. Dann sagte ich zu ihr: »O meine Katze, meine Katze! Ich nenne dich Anbar!«
Sie sagte: »Miau!«
Sofort verstand ich: »Miau« bedeutete »Ja«. Prüfend sagte ich: »O meine Katze, meine Katze, wenn du mich ärgerst, werfe ich dich aus dem Fenster.«
Sie sagte: »Miau!«
Sofort übersetzte ich »Miau«: Es war ein »Nein«.
Ich freute mich, lachte, und Anbar lachte auch. Wir waren sehr glücklich miteinander. Anbar hatte Afaf, Afaf aber Anbar gefunden. Als Afaf jedoch verloren ging, fand ich Anbar.
Eine wunderschöne Katze. Sie hat weißes, geflecktes, buschiges Fell. Ihr Gesicht ist eine Jasminblüte, und ihre Ohren sind zwei Blüten Arabischen Jasmins. Ihre Nase ist eine Hyazinthe und ihr Schwanz ein Federbündel. Sie reizte ihn. Sie durchschaute seine List, was ihn wütend machte. Immer wieder verpasste er ihr einen Fußtritt, sodass sie gegen die Badezimmerwand prallte. Dann hörte ich ein unterdrücktes Wimmern, das von einem Häufchen Fell und Knochen herrührte. Heimlich weinte ich, und wenn er nicht aufpasste, nahm ich sie auf den Schoß. Ich flüsterte: »Hat er dich geschlagen?«
»Miau!«
»Hat dich das Tier geschlagen?«
»Miau!«
»Mich schlägt er auch!« Und ich grub mein Gesicht in ihr Fell und weinte noch mehr.
Er wollte sie unbedingt loswerden, dennoch ließ ich mich nicht abbringen. Wie gewöhnlich sagte er, wobei der Whisky seine Stimme beeinträchtigte: »Du bist verrückt!« Ich antwortete nicht, hielt Anbar auf dem Schoß, und meine Augen waren auf den Fernseher geheftet. Darin sang eine Frau: »Wer geliebte Menschen hat in seinem Land.« An dieser Stelle begann die Spirale sich einzubohren, als dringe eine brennende Pfeilspitze in meine Brust, grabe sich hinein und bleibe zwischen meinen Rippen stecken. »Wer geliebte Menschen hat in seinem Land, hat geliebte Menschen in seinem Land.« Meine Tränen begannen still zu rinnen, die Katze richtete ihre Ohren auf. Ich nahm sie und ging ins Badezimmer.
Ich fürchtete mich, vor Leuten zu weinen. Dennoch tat ich es. Ich weinte vor ihnen, weil meine Tränen schneller waren als ich. Sie entrannen mir, bevor ich entrinnen konnte. Meine Tränen rannen, sie fielen nicht tropfenweise, sondern flossen wie ein reißender Strom. Es bildete sich eine heiße Linie, die sich von den Augen hinab zum Kinn entlangzog. Eins habe ich mir während meiner Gefängnisjahre angeeignet, nämlich mein Schluchzen zurückzuhalten, bis ich das Badezimmer erreichte. Dies lehrte mich nicht die Scham, sondern die Angst. Ich hatte Angst davor, »Verrückte« genannt zu werden. Trotzdem behielt ich Anbar. Denn Anbar war kein Apfel.
Anbar war zugleich meine Katze, mein Kind und meine Großmutter, wenn sie Geschichten erzählte. Seit meiner Kindheit bin ich in die Geschichten vernarrt. Wir nannten sie »Geschichtchen«. An Wintertagen sammelten wir uns um den Ofen, auf dem wir Käse brieten, sodass sich im Haus ein warmer satter Duft verbreitete. Wir wärmten das Brot auf der Glut, bis es sich rötete. Manchmal vergaßen wir es auf dem Feuer, dann verkohlte es, und das Haus füllte sich mit Rauch. Aber wir lauschten nur der Geschichte von Hasan, dem Tüchtigen, der nächtlichen Siham und den drei Rosen. Von den Rosen war jede eine schöne Frau, so schön, dass sie einen blendete wie das Sonnenlicht. Deshalb bedeckten die Leute beim Vorübergehen ihre Augen. Nur Hasan, der Tüchtige, bedeckte seine Augen nicht, und sein Herz wurde getroffen. Plötzlich verstummte die warme Stimme meiner Großmutter, und die Wolke, auf der wir schwebten, erzitterte.
Wir baten sie, fast schon schmerzerfüllt flehten wir sie an: »In Gottes Namen, Oma, bitte!« Darauf sagte sie: »Habt Geduld, meine Kehle ist ganz trocken!« Eine von uns beeilte sich, ihr ein Glas Wasser zu reichen. Inzwischen wendeten wir das Brot und den Käse über dem Feuer, küssten die Großmutter und drängten uns noch dichter an sie, spürten die Wärme, obwohl es kalt war. Wir aßen das geröstete Brot und den Käse und tranken dazu Tee. Aus Sorge, dass wir ins Bett machten, schimpfte die Mutter über das viele Teetrinken. Wir aber lauschten nur dem leisen Zischen von Käse auf dem Feuer und der Stimme der Großmutter. Wir folgten den weiten Reisen in die Welt finsterer Gänge unter der Erde und unter dem Wasser, in die Welt der Elfenbeinschlösser, der Marmorpaläste und der Blumen aus Rubinen, Perlen und Diamanten und der Smaragdblätter. Mit den Geschichten verbindet mich eine Geschichte. Ich schlief mit der Stimme meiner Großmutter ein, während ich immer noch träumte. Ich träumte, ich erlebe die Geschichte, wie Großmutters Stimme sie erlebt. Eine Stimme, die ausgeht vom Ofen, dem Käseduft und den Farben der Dunkelheit und des Lichts. Die nächtlichen Träume endeten stets mit dem frühen Morgen, dem Fortschleichen aus einem feuchten Bett und unterwürfigen Blicken. Die Angst begann mit Tagesanbruch und hörte erst wieder mit dem Rauschen der Stimme von Großmutter auf. Die Nacht war schöner als der Tag, der Sonnenuntergang schöner als der Morgen und das Teetrinken schöner als seine Folgen. Deshalb lebte ich mehr in den Träumen. Ich hielt Anbar fest in den Armen.
Die Ohren Anbars waren in Bereitschaftsstellung, sie hörte das verstohlene Drehen des Schlüssels im Schloss. Sie öffnete ihre grünen Augen, und die Pupillen begannen sich zu weiten. Ihr Hals blieb gestreckt. Sie hörte ein weiteres schwaches Knacken und sprang davon. Liebevoll rief ich sie: »Anbar!«
Er hörte mein Rufen durch die Tür, bewegte schnell den Schlüssel und trat ein. Ich vernahm zischende Flüche, und dann hörte ich ein schreiendes Miauen. Die Katze wurde getreten und prallte gegen die Wand und wieder Fell, Knochen und das unterdrückte Wimmern. Ich rannte, kroch, schluchzte: »Jeden Tag die gleiche Geschichte!« Ich wartete die Antwort nicht ab, ich wartete nie. Ich lief der Katze hinterher, sie aber floh vor mir und versteckte sich unter dem Bett. Ich beschäftigte mich damit, nach ihr zu suchen, nur damit mein Blick nicht auf sein Gesicht fiel. Ich hasse es, ihm ins Gesicht zu schauen. Ich verabscheue es, in seine stumpfen Augen zu blicken, die in eine rot gefärbte Höllenwacht umschlagen und zucken, sobald sich Zweifel oder der Whisky darin entfacht. Ich hörte ihn wie immer die Türen öffnen, wie immer den Kühlschrank öffnen, wie immer aus der Flasche einschenken. Ich hielt meine Katze fest, umarmte sie und kehrte an meinen Platz vor der Heizung zurück. Die Katze fing von Neuem an zu schnurren, und ich roch wieder den Röstduft, das Aroma von Käse, das Glucksen des Ofens mit dem Zischen des Petroleums, der rote Ball, die Glut im Ofen, die Blumen aus Rubin, die Reise durch Gänge, die der Erinnerung ins Unterirdische entgleiten.
2
In allem suchte ich Zuflucht, sogar in der Krankheit. Ein Hilferuf nach dem anderen. Sollte mich das Fieber verzehren. Sollte ich das Bewusstsein verlieren. Ich wünschte mir, bis auf den letzten Tropfen zu verbluten. Ich blieb in meinem Bett liegen, krank ohne Krankheit, und beobachtete dabei meine Katze, die auf dem Fensterbrett stand und das Sonnenlicht einfing. Ich flüsterte: »O meine Katze, meine Katze, du befindest dich hinter Glas, genau wie ich.« Sie hat eine beneidenswerte Eigenart. Spiele ich mit ihr in einer Weise, die sie nicht mag, dann macht sie Krallen und kratzt. Ich betrachte ihre flinken Augen, wie sie mich fixieren, und lächle sie mit der Zärtlichkeit und Bewunderung einer Mutter an. Wär ich doch wie du, Anbar! Hätte ich doch eine Kralle so lang wie ein Palmblatt! Wär ich doch diese Palme! Eine Palme am Arabischen Golf, die aus der Unfruchtbarkeit der Wüste herauswächst. Ich möchte mich nicht erinnern. Doch, ich erinnere mich. Nein, ich will nicht. Doch, ich erinnere mich. Habe ich jemals vergessen? Ja, ich habe vergessen, dann erinnerte ich mich, dann vergaß ich, und ich erinnere mich immer wieder.
Meine Hand spielt mit dem kleinen Gerät. Von ihm geht eine Stimme aus so kalt wie das Rauschen des Windhauchs vom Fenster dort. Dort, weit weg, hinter den Weiten der Wüste und den Grenzen der Fremde und hinter einem Fluss und einer Brücke und der Besatzung und hinter Soldaten und Juden. Es ist nicht die Zeit, über all dies nachzudenken. Mein Leid genügt mir. Mein Leid, meine Kindheitsträume und die Gänge der Geschichten füllen mich aus. Flucht vorwärts und Flucht rückwärts, und ich verharre hier hinter der Glasscheibe und der Wüste und dem Palmblatt. »O wie zart ist der Windhauch, wenn er meinen Schatten streift!« Das Palmblatt wiegte sich hin und her wie das Zittern der Lichtringe auf dem Wasserspiegel des Bassins. Ich war klein und stand am Rand des Bassins im Haus der Familie. Ich konnte die Wasseroberfläche kaum sehen. Blätter eines Bitterorangenbaumes sanken darauf. In meinen Händen sammelte ich glockenförmige, aprikosenfarbene Blüten und warf sie auf die Wasseroberfläche. Sie verteilten sich zwischen den Blättern und gingen nicht unter. Das Wasser war kalt, und meine kleinen Finger waren eisig. Meine Zehen steckten in bunten Holzpantoffeln aus Syrien. Meine Finger waren kalt wie Eis und rot wie Rote Bete. Von den Glockenblumen war ich fasziniert und betört. Das Bassin erschien mir riesig. Das Wasser bewegte und drehte sich, die Blätter drehten sich, die Glocken drehten sich. Tropfen fielen auf meinen Kopf. Ich hob meinen Kopf. Ineinanderverschlungene Zweige, die dunkel, beinahe schwarz erschienen. Zwischenräume des Himmels und Wattewolken. Bitterorangen glänzten, Blätter schimmerten, Glocken wirbelten – mein Kopf.
Klein war ich und das Bassin der Familie groß. Als ich erwachsen war, erschien mir das Bassin der Familie klein. Verwundert fragte ich nach, da wurde mir gesagt: »Dasselbe Bassin.« Viele Dinge schrumpfen, wenn wir groß werden, nicht aber der elende Ehekummer. Er wird immer größer und größer und erreicht das Ausmaß des Bassins, des Sees, des Meeres, des Ozeans. Und ich ertrinke.
Ich blieb stumm und betrachtete die Palme durch die Glasscheibe. Umm Walid kramte sämtliche Geschichten aus und schilderte alle Tragödien der Frauen, nur nicht die ihre und die meine. Diese ist geschieden worden, jene ist davongelaufen, die andere ist wieder zu ihrem Mann zurückgekehrt, nachdem sie Vernunft angenommen und erkannt hat, dass eine Frau nirgends außer in das Haus ihres Mannes gehört und es keine Krone für ihren Kopf gibt außer ihm.
Kennst du diese Geschichte, Afaf? Eine Frau geriet über ihren Mann in Zorn, kehrte zum Zelt ihres Vaters zurück und lehnte jede Vermittlung ab. Der Stammesoberste gab ihrem Vater einen Rat, den dieser auch befolgte. Er befahl den Frauen, der Tochter alle Kleidungsstücke auszuziehen und ihr nichts außer einem Überwurf zu lassen. Dann rief er sie dahin, wo er selbst, der Stammesoberste und ihr Ehemann zusammensaßen. Plötzlich riss ihr der Vater den Überwurf vom Leib. Aus ihrer Verwirrung eilte sie zu ihrem Mann und ersuchte ihn um Schutz: »Bedecke mich, du Unbescholtener, bedecke mich, du Unbescholtener!«