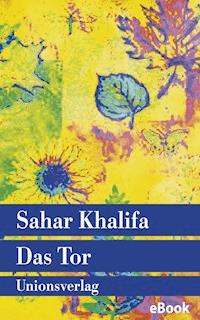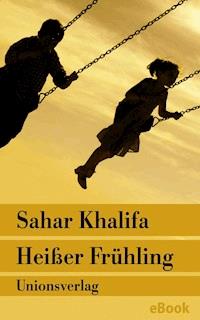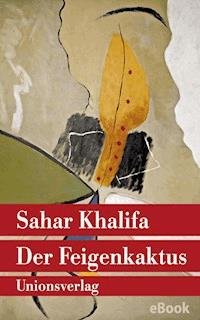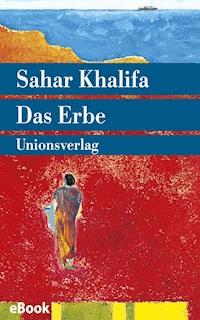
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sena ist in Brooklyn als Tochter eines palästinensischen Krämers aufgewachsen. Sie ist erfolgreiche Anthropologin, hat zwei Autos, trainiert Aerobic, besucht Partys auf Jachten, in Botschaften, an Swimming-Pools. Eines Tages erhält sie eine Nachricht aus dem Westjordanland: Ihr seit langem verschollener Vater liegt im Sterben. Kurz entschlossen packt sie die Koffer und fährt zurück in ihr Land, das sie nicht kennt und von dem sie nicht weiß, ob es ihre Heimat ist. Die Wirklichkeit bricht über sie herein. Das Land ist in Aufruhr, die Menschen sind aufgewühlt. Ihre weitverzweigte Sippe bestaunt die angereiste Fremde, fürchtet um die Erbschaft des reichen Vaters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Sena, erfolgreiche Anthropologin, ist in Brooklyn als Tochter eines palästinensischen Krämers aufgewachsen. Eines Tages erhält sie eine Nachricht aus dem Westjordanland: Ihr seit langem verschollener Vater liegt im Sterben. Kurz entschlossen fährt zurück in ihr Land, das sie nicht kennt und von dem sie nicht weiß, ob es ihre Heimat ist.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sahar Khalifa (*1941) ging mit achtzehn Jahren eine traditionelle Ehe ein, die dreizehn Jahre dauerte. Nach der Scheidung widmete sie sich verstärkt dem Schreiben, studierte in den USA und arbeitete an der Universität Bir Zeit. In Nablus gründete sie ein palästinensisches Frauenzentrum.
Zur Webseite von Sahar Khalifa.
Regina Karachouli (*1941) ist promovierte Arabistin und Kulturwissenschaftlerin. Nach langjähriger Lehr- und Forschungstätigkeit am Orientalischen Institut in Leipzig ist sie freie Übersetzerin aus dem Arabischen.
Zur Webseite von Regina Karachouli.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sahar Khalifa
Das Erbe
Roman
Aus dem Arabischen von Regina Karachouli
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die arabische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Al-Mirath im Verlag Dar al-Adab, Beirut.
Die Übersetzung aus dem Arabischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: Al-Mirath (1997)
© by Sahar Khalifa 1997
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Aldo Bachmayer, Martellotower (Ausschnitt, 1993–97)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30685-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 19:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS ERBE
Erster Teil — Ohne Erbe1 – Ich kam ins Westjordanland auf der Suche nach …2 – Bevor ich mir selber verloren ging, verlor ich …3 – Großmutter Deborah war der erste Mensch, der mir …4 – Mein Leben bei Großmutter lief wie am Schnürchen …5 – Mein akademisches Leben war schlichtweg fade. Ohne Geschmack …6 – Mit der Zeit wuchs meine Entfremdung, bis ich …7 – Ich bog in die Nebenstraße ein und versuchte …8 – Ich kehrte zurück zu Falih, dem Pförtner der …Zweiter Teil — So ein Erbe9 – Dann erhielt ich diesen Brief. Ein Onkel schrieb …10 – Vor einer blaugrau gestrichenen Eisentür blieb ich stehen …11 – Am späten Nachmittag füllte sich der Hof mit …12 – Das Zimmer war voller Menschen. Zuerst übersah ich …13 – Als die Frau meines Vaters vom Laden zurückkam …14 – Den Mund voll Kaugummi, saßen wir auf dem …15 – Umm Dschirjes hatte mich zur Geburtstagsfeier bei Violet …16 – Zu zweit schlenderten wir durch die Nacht …17 – Mein Cousin ging in sein Zimmer. Ich blieb …18 – Ich wusste nicht mehr, was ich eigentlich sammeln …19 – Die Trauerfeier war zu Ende. Tagelang hatten sie …20 – Unter Fitnas Leitung lernte ich Jerusalem kennen …21 – Als Fitnas Mutter, Sitt Amira, eintrat, sprangen alle …22 – Auf dem Weg zum Souvenirgeschäft vertraute mir Fitna …23 – Ich brach meinen Ausflug ab und flüchtete aus …24 – Wir machten uns auf die Suche nach Masin …25 – Nahla setzte sich vor den Spiegel und massierte …26 – Als er ihr Knie und ihre Wade berührte …27 – Nahla verspätete sich, auch Masin kam nicht …28 – Nahla saß in Nablus gefangen. Der Fahrer eines …29 – Am folgenden Tag sollte ihre Beklemmung noch wachsen …30 – Als Nahla nach Wadi al-Raihan heimkehrte, fühlte sie …31 – Die Neuigkeit schlug ein wie der Blitz und …32 – Kamals Probleme und das Gerede der Leute nahmen …33 – Projekte standen hoch im Kurs. Man dachte an …34 – Wir fanden ein Schloss, eine Art Zitadelle auf …35 – An einem düsteren Tag schlüpfte ich bei Sonnenuntergang …36 – Fitna kam persönlich aus Jerusalem, um Violet und …37 – Masin war äußerst verärgert über die Stimmung auf …38 – Der Makler hatte sich mit Bier voll laufen …39 – Er trat aus der Toilette. Freude und Erleichterung …40 – Wir fanden keinen Schlaf. Der Morgen dämmerte bereits …41 – Abdel Hadi erklärte, er komme als Vermittler …42 – Die Brüder beschlossen, dem Vater nichts von dem …43 – Said stieß die Tür auf, dass es krachte …44 – Wie war ich an diesen Ort gelangt …45 – Abu Salims Söhne und Töchter waren außer sich …46 – Wir machten uns auf die Suche nach Nahla …47 – Masin entschied sich, Nahla auf dem Weg zu …48 – Auch wir Frauen wollten Nahla finden. Wir hielten …49 – Langsam, in ihrer ganzen Leibesfülle, mit einem halben …50 – Sitt Amira schlief nicht. Obwohl sie einigermaßen Ruhe …51 – Als Ingenieur Kamal dem Plan seines Bruders Said …52 – Es duftete nach Kamille und Zitronenblüten, Mondschein glänzte …53 – »Keine Bewegung! Kein Wort!« Kamal spürte eine Messerspitze …54 – Laut knarrend öffnete sich die Tür. Sie erstarrten …55 – Abu Salims Söhne kehrten zurück. Diesmal leitete ein …56 – Stundenlang diskutierten wir. Fremde, Rückkehr, Entwicklung und Modernisierung …57 – Natürlich war Amerika für Violet, wie für viele …58 – Auch er hatte eine Geschichte und eine Vergangenheit …59 – Er begann die Sache zu planen. Wollte er …60 – Wie grundverschieden doch zwei ähnliche Männer auf die …61 – Abdel Hadi Bey ließ Wadi al-Raihan samt der …62 – Er fand keinen Schlaf, saß herum und wartete …Dritter Teil — Die Frucht der Hinterlassenschaft63 – Wochen waren vergangen. Der Gestank der Kläranlage verpestete …64 – Die Leute teilten sich in zwei Lager …65 – Schon Tage vor dem Beginn der Festlichkeiten ging …66 – Die Zitadelle füllte sich mit Fahnen, Lampen und …67 – Die Konsuln, Journalisten und der Bürgermeister waren eingetroffen …68 – Wie vom Wetterbericht angekündigt, drehte der Wind auf …69 – Keiner wusste genau, warum die Feier platzte und …70 – Nachdem das Fest geplatzt war, befand sich Masin …71 – Sitt Amira weigerte sich, zu den Konsuln und …72 – Drei Personen, gefangen in dieser langen Schlange …73 – Mein Onkel begleitete mich zum Flughafen. »Willst du …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Sahar Khalifa
Über Regina Karachouli
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Sahar Khalifa
Zum Thema Palästina
Zum Thema Israel
Zum Thema Arabien
Zum Thema Frau
Zum Thema Asien
Meiner kleinen Enkelin Sahar al-Disi.
Möge sie das Erbe entdecken.
Sahar Khalifa
Erster Teil
Ohne Erbe
1
Ich kam ins Westjordanland auf der Suche nach ihm, auf der Suche nach ihnen, auf der Suche nach meinem Gesicht in der Fremde. Um zu erfahren, wie es weitergehen würde. Ich hatte einen Brief von einem Mann erhalten, der mir schrieb, er sei mein Onkel väterlicherseits und mein Vater befinde sich an einem Ort namens Wadi al-Raihan. Was immerhin bedeutete, dass er am Leben und gut aufgehoben war.
Wie groß ist der Unterschied, wie weit die Entfernung zwischen New York oder Washington und Wadi al-Raihan! In meiner Erinnerung war Wadi al-Raihan das genaue Gegenteil von New York. Ein kleiner, sauberer Ort, die Einwohner einfache Leute, die ihre Mitmenschen und die Natur liebten. Eben ganz im Gegensatz zu den New-Yorkern.
Als ich meinen Vater an jenem Abend davon reden hörte, rannte ich jubelnd die Treppenstufen hinauf: »Wir kehren in die Heimat zurück, wir kehren zurück, zurück!« Doch wir fuhren niemals zurück, weil mein Vater vor mir floh, besser gesagt, ich flüchtete vor ihm.
Die Geschichte begann, als mein Vater aus seinem Dorf anreiste, eine amerikanische Frau heiratete – meine Mutter selbstverständlich – und die Green Card erhielt. Dann kam es zur Scheidung, wie gewöhnlich, darauf folgten neue Ehefrauen und eine ganze Herde Kinder. Zunächst war mein Vater fliegender Händler gewesen, der seine Ware auf dem Rücken schleppte und die Wohnungen abklapperte. Er verkaufte Dinge aus aller Herren Ländern, als handele es sich um Reliquien aus heiligen Gefilden. Er füllte kleine Flaschen mit Wasser und Sand und pries sie an: »Heiliger Sand und heiliges Wasser vom heiligen Strom! Du kennst Jordan, Frau? Heiliges Wasser und Taufe von Jesus Christus. Habt ihr Taufe? Wir haben viel, viel Taufe. Jeden Tag wir taufen. Ich von Jerusalem, und bringe Wasser von Jordan.«
Er sprach nur gebrochen Englisch, wusste sich jedoch mit orientalischer Gewandtheit zu helfen. Er breitete seine Artikel aus – glitzernde Gewänder, Haarnadeln und Zwirn – und redete auf eine amerikanische Hausfrau ein: »Schau, Lady, wie schön! Dieser Kaftan gearbeitet von Hand in Arabia, dort drüben. Du kennst Arabia? Wüste, Kamele und Datteln, Weihrauch und Moschus und Koran. Du kennst Mekka?«
Die amerikanische Hausfrau fand den Mann und seine Waren interessant und exotisch und rief voller Begeisterung: »Aber natürlich! Lassen Sie sehen, zeigen Sie her!«
»Langsam, langsam, Lady. Schau dies und dies und dies auch.«
Danach zog er, als sei es ihm eben zufällig in die Hände geraten, ein altes, vergilbtes Bild von König Husain I. hervor. »Siehst du, Lady? Das Bild von meinem Vater, war großer Emir. Ist tot. Beduinenstamm klaut sein Emirat, und ich noch kleiner Junge, nach Jerusalem geflohen, und dann Kairo, und dann Marrakesch, und von dort mit Schiff direkt nach Amerika. Siehst du, Lady? Ich bin armer Bettler, aber mein Vater war großer Emir.«
Die Frau reißt die Augen auf und starrt auf das Bild: ein edles Gesicht mit weißem Bart, ein großer Turban bedeckt das Haupt.
Darauf er, ein Mann mit gebrochenem Herzen: »Mein Vater war großer Emir, aber ich, o Jammer, nur armer Bettler.«
»Nein, nein, durchaus nicht!« Ihre Blicke wandern zwischen dem Mann und dem Bild hin und her. »Nein, nein, Sie sind kein Bettler.« Nachdenklich schaut sie ihm ins Gesicht: schwarze Augen, pechschwarz schimmernder Schnurrbart. Überwältigt stammelt sie: »Sie sehen wie ein Emir aus. Ich wette, Sie sind ein Emir!«
Nun legt er los: »Und du auch eine Emira, eine Sultanin, Königin der Schönheit, beim allmächtigen Gott!«
Er kramt ein Stück Stoff hervor, bindet es um ihre Hüften und schwört, sich dreimal scheiden zu lassen – beim Propheten Muhammad, dem Herrn der Propheten und Gesandten! –, wenn sie nicht das leibhaftige Ebenbild Scheherezades in all ihrer Pracht und Herrlichkeit sei, ja das Juwel aller Araber und Muslime – die reine Wahrheit, beim allmächtigen Gott! Diese Prozedur wiederholt er ein ums andere Mal. Und jedes Mal sagt er: »Probieren wir noch mal dies, und dies noch mal, und dies.«
Auf diese Weise gelang es ihm, die Billigwaren aus Hongkong, hergestellt von Lumpenemiren seinesgleichen, als Reliquien aus heiligen Gefilden zu verkaufen. Nach wenigen Jahren konnte er in Brooklyn den Kramladen aufmachen, der alles enthielt, was man sich denken kann: Brot, Kämme und Haarklemmen, Nadeln und Zwirn, Gewürze, Ikonen und bunten Sand, Bilder mit Maria und ihrem kleinen Sohn, schwarze Oliven und getrocknete Muluchija, eingelegte Gurken und Damaszener Kaugummi, alte Gebetsketten und was einem sonst in den Sinn kommt.
Er war zweifellos erfolgreich, doch das Geheimnis lag nicht in seinem Englisch und seiner Zungenfertigkeit; es lag vielmehr in seinen Augen, seinem Schnurrbart und seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, Geschichten und Fabeleien zu erfinden.
All das habe ich geerbt. Ich wurde eine angesehene Autorin in der Wissenschaft vom Menschen und den Zivilisationen, das heißt Anthropologin. Doch bevor ich werden konnte, was ich bin, musste ich mir erst einmal die Tricks meines Vaters aneignen. Alles begann an dem Tag, als ich zwei schmerzhafte Knöllchen in meiner Brust spürte. Die Frau meines Vaters schob die Sache auf eine unheilbare Erbkrankheit in unserer Familie. Doch die Symptome entwickelten und vergrößerten sich, und schon bald begann ich, heimlich durch die Schlüssellöcher und Fensterritzen zu lugen.
Als ich eines Tages auf dem Flachdach stand, um zwei Verliebte zu beobachten, die in der Dunkelheit miteinander schmusten, ertappte mich mein Vater in flagranti, sodass mir gar nichts anderes übrig blieb, als eine Geschichte zu erfinden. Ich behauptete, zu fasten und dort oben auf den Gebetsruf zu warten. Dann fragte ich unschuldig: »Wann ist denn das Fastenbrechen? Bilal lässt sich aber Zeit mit dem Ruf.«
Bilal war unser närrischer, törichter Nachbar, der sich ehrlich mühte, Amerika auf den Weg zum Islam zu führen, indem er fünfmal am Tag seine Stimme zum Gebetsruf erschallen ließ. Mein Vater schaute mich prüfend an, dann entschied er sich, mir zu glauben. Ich glaubte mir ja selber. Als sei ich vor Hunger den Tränen nahe, stieß ich mit erstickter Stimme hervor: »Ich bin hungrig, sehr hungrig!«
In der Nacht hörte ich, wie mein Vater seiner Frau Vorwürfe machte: »Du solltest dich schämen, das Mädchen kommt noch um vom vielen Fasten! Sieh nur, wie klein und schmächtig sie ist. Geht es denn an, dass sie jeden Tag fünfmal betet, im Ramadan fastet und auch noch die versäumten Tage nachholt?«
Die Frau meines Vaters warf sich im Bett herum, dass die Sprungfedern unter ihrem gewaltigen Gewicht krachten: »Willst du es nicht so haben?«
»Aber doch nicht die versäumten Tage vom Ramadan nachholen!«, erwiderte er empört.
Ärgerlich begehrte sie auf: »Fastet denn deine Tochter überhaupt, mein Lieber? Die frisst doch wie die Heuschrecken. Vor dem Mittagessen futtert sie in einem Atemzug sieben Maiskolben. Ich wollte sie zurückhalten, aber es war aussichtslos. Lieber Gott, was ist sie störrisch, nicht zum Aushalten! Störrisch und verlogen und verrückt, niemals erzählt sie eine Geschichte wahrheitsgemäß. Gott bewahre uns vor diesem Mädchen! Ich fürchte, dass sie was anstellt wie Huda und vor allen Nachbarn Schande über uns bringt!«
Huda war die Tochter unserer Nachbarn vom selben Block und wie ich eine halbe Amerikanerin. Mit fünfzehn wurde sie schwanger, und wir sahen zu, als ihr Vater sie auf der Straße verfolgte – wie ein wütender Stier, in der Hand ein langes Messer. Mein Vater holte ihn ein und versuchte, ihn zu stoppen. Doch vergeblich. Erst mithilfe zweier Nachbarn gelang es, ihn daran zu hindern, dass er sie erstach.
»Abgeschlachtet gehörte sie«, wiederholte mein Vater bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor mir. »Sie hat seinen Namen in den Schmutz gezogen und seine Ehre befleckt. Nun muss er vor den Leuten den Kopf einziehen. Ich an seiner Stelle hätte sie bis an die Pforten der Hölle verfolgt.«
Doch Huda konnte fliehen. Sie fand bei ihrer amerikanischen Großmutter Unterschlupf, und wir sahen sie nicht mehr in Brooklyn. Seit diesem Tag hörten wir nur noch Gerüchte über sie. Manche Leute sagten, sie habe das Neugeborene behalten, andere erzählten, sie habe es zur Adoption freigegeben, und wieder andere behaupteten, sie habe abgetrieben. Doch wie weit auch die Meinungen über Huda und ihr Baby auseinander gingen, in einem waren sich alle einig: Hudas Vater war kein richtiger Mann mehr.
Ich hörte meinen Vater im Schlafzimmer murmeln: »Gott behüte, Gott behüte! Sie wartet auf den Gebetsruf, sagt sie! Und ich stehe daneben wie ein dummer Ziegenbock, fehlte nur noch der Strick.«
Am nächsten Morgen hörte ich meinen Vater die neueste Nachricht verkünden: »Ich furz auf Amerika und die Amerikaner! Schluss aus, ich kehre in die Heimat zurück!«
Er saß mit zwei Nachbarn vor dem Laden, sie rauchten Wasserpfeife. Ich stand in einem Winkel, um sie zu beobachten und zu belauschen. Sobald ich das Wort »Heimat« vernahm, vollführte ich einen Freudensprung und rannte, ja flog förmlich die Treppenstufen hinauf, in den ersten Stock. »Heimat«, das klang mir wie ein Lied in den Ohren, zauberhaft wie das Märchen von Aladin und der Wunderlampe oder vom Geist aus der Flasche. Wie eine von meines Vaters Geschichten, durchweht von Dunstschleiern, Weihrauch und Schmetterlingsflügeln.
Frohlockend stieß ich die Tür auf: »Wir kehren in die Heimat zurück, in die Heimat zurück!«
Die Frau meines Vaters näherte sich, in der Hand eine große Holzkelle, mit der sie drohend herumfuchtelte: »Wer lügt, gehört ins Feuer. Morgen kommst du in die Hölle, dort schmilzt du weg wie eine Kerze.«
Ich begann zu weinen, beharrte aber störrisch: »Wir kehren in die Heimat zurück, bei Gott dem Allmächtigen. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Geh doch hin, und hör es selbst.«
Einige Augenblicke stand sie verwirrt, dann stürzte sie ans Fenster. Sie schaute hinunter und hörte meinen Vater sagen: »Worauf warten wir noch, Brüder? Haben wir dieses Amerika mitsamt seinen Scheußlichkeiten nicht satt bis obenhin? Wir alle haben Söhne und Töchter. Wollt ihr etwa, dass eure Töchter Schlampen werden wie die Weiber in Amerika? Oder wollt ihr, dass eure Töchter sauber und anständig bleiben und dass ihr sie ordentlich erzieht und ehrbar verheiratet?«
Die beiden Männer nickten unaufhörlich. Mein Vater steigerte sich immer mehr in Rage und schrie so laut, dass er bis ans andere Ende der Straße zu hören war. »Dort ist das wahre Leben, Brüder! Dort redest du arabisch, du isst arabisch und trinkst echten arabischen Kaffee. Brauchst du Hilfe, findest du tausend ausgestreckte Hände, die dir beistehen. Benötigst du Geld, nimmst du es von irgendeinem Freund. Nichts mit Banken, Wechseln und Kopfzerbrechen. Ist der Tag zu Ende, sitzt du stundenlang im Kaffeehaus, und zuletzt suchst du noch die Moschee oder die Männerrunde im Diwan auf. Die Leute dort sind wahrhafte Muslime. Sogar die Christen sind in Ordnung, sie kennen Gott genauso gut wie wir. Wir beten in der Moschee zu Gott, und sie beten zu ihm in der Kirche. Da ist kein großer Unterschied. Hier dagegen, du lieber Gott, was gibt es hier! Was ist hier eigentlich los, erklärt mir das mal!«
Einer der beiden Männer brummte: »Na, na!«
»Schon gut, schon gut«, rief mein Vater, »wir alle haben uns satt gegessen. Ich habe gegessen, du hast gegessen, und jeder von uns ist satt zum Erbrechen. Aber was ist mit den Amerikanern in Saudi-Arabien, mein Lieber, was wollen die dort? Etwa die Kaaba verteidigen? Sich im Jordan taufen lassen oder Gebete aufsagen? Sags mir, was treiben sie dort?«
Die Männer wiegten wortlos die Köpfe. Wutentbrannt brüllte mein Vater: »Was wackelt ihr mit dem Kopf wie Bilal! Sagt mir bloß, was die dort treiben!«
Einer der beiden platzte heraus: »Sie fressen uns das Essen weg und kacken uns hinterher auf den Bart. Punktum! Das ist alles, was sie dort machen. Und wir Araber sind die dummen Esel. Bei Gott, wir verdienen es nicht besser. Was sie dort treiben? Sie schänden uns unverhohlen, in aller Dreistigkeit.«
»Gott behüte!«, entgegnete der andere. »Sie schänden uns? Ich bin es, der sie schändet, egal ob weiß oder schwarz, alle schände ich!«
Mein Vater brüllte dazwischen: »Das ist ja gerade die Absicht! Du schändest ihre Töchter, und sie schänden deine Töchter. Stimmts oder etwa nicht?«
»Gott behüte!«
Der Erste antwortete: »Ich lasse nicht zu, dass jemand auch nur ein Haar auf dem Kopf meiner Töchter anfasst!«
»Okay, und Huda?«
Mein Vater fragte: »Wohin ist Huda eigentlich gegangen?«
Minutenlang saßen die drei mit gesenkten Köpfen, bis mein Vater das Thema beendete, indem er erklärte: »Ich will, dass meine Töchter als Araberinnen aufwachsen, sauber und rein wie eine Kerze. Sie sollen arabische Muslime nach Sitte und Gesetz heiraten und von Muslimen geschwängert werden und Kinder bekommen. Verflucht sei das ganze Amerika, ich kehre zurück!«
Doch mein Vater kehrte nicht zurück. Er eröffnete einen neuen Laden in New Jersey, kaufte eine neue Wohnung und heiratete eine neue Frau. Und dann verfolgte er mich auf der Straße, mit einem langen Messer in der Hand. Ich war gerade fünfzehn.
2
Bevor ich mir selber verloren ging, verlor ich meine Sprache und meine Identität samt Namen und Adresse. Mein Name war eigentlich Sainab Hamdan, aber mit der Zeit wurde daraus Sena. Mein Vater hieß Muhammad Hamdan, doch dann gab es für mich weder einen Muhammad noch die Hamdans. Der Geburtsort meines Vaters war Wadi al-Raihan, ich wurde in Brooklyn geboren. Sena war also ein Zwischending zwischen zwei Sprachen und zwei Einflüssen, das Produkt Brooklyns und des Westjordanlandes, der Großmutter und des Vaters, und am Ende weder Fleisch noch Fisch. Die Lieder meines Vaters, die Koranverse und der Lobpreis des Propheten hätten mich vor den Folgen solcher Ungewissheit bewahren sollen, aber es war klar, dass sie es nicht konnten, schon deshalb, weil ich weder den Sinn der Worte verstand noch die Schönheit der Melodien zu schätzen wusste. Die neue Frau meines Vaters gehörte zu denen, die Englisch für ein Zeichen des Fortschritts, der guten Erziehung und feinen Bildung hielten. Sie sprach ein miserables Kauderwelsch, und ihre Erziehung war auch nicht besser. An Stelle von P sagte sie immer B, und aus K wurde bei ihr G: »Abble bei, panana sblit. Barg your gar in the barging lot.«
Wir Kinder waren Gott sei Dank in der Lage, B und P zu unterscheiden, brachten aber trotzdem keinen ordentlichen Satz zu Stande. Unser Gerede war ein so merkwürdiges Mischmasch aus zwei Sprachen, dass unsere amerikanischen Gäste fragten, ob wir nicht zur Schule gehen wollten, um wenigstens einigermaßen Englisch zu lernen, während unsere Verwandten ihrem Unmut Luft machten, dass wir nicht den Klub besuchten, um uns ein anständiges Arabisch anzueignen. Doch mein Vater nahm allen den Wind aus den Segeln, indem er mich am Ende jeder Party aufforderte, unseren verehrten Gästen zu zeigen, wie perfekt ich Englisch konnte. Worauf ich auf einen Stuhl stieg, umgeben von Arrakflaschen und Appetithäppchen und umringt von Leuten, die mir applaudierten und zulachten. Ich begann mit »verb to be and verb to have«, ging darauf zu »twinkle twinkle little star« und »row row row your boat« über und beendete die Vorführung mit der amerikanischen Nationalhymne. Die ganze Gesellschaft fiel mit solcher Lautstärke ein, dass sich unsere neuen Nachbarn gezwungen sahen, die Polizei und später die Feuerwehr zu rufen. Die Szene wiederholte sich, wenn ich meinen Auftritt inmitten unserer versammelten arabischen Verwandten hatte. Ich beglückte sie zunächst mit den Hilfsverben »kana und ihre Schwestern« und den Konjunktionen »inna und ihre Schwestern«, ließ danach den Lobpreis des Propheten, den Willkomm der Medinenser »Der volle Mond erschien«, die Sure »al-Fatiha« und »Hela hela« folgen und schloss die Darbietung mit einem andalusischen Strophengesang, in den alle Anwesenden mit größter Begeisterung einstimmten. Als der Morgen dämmerte, suchten uns wiederum die Polizisten heim und schleppten unsere Bekannten aus dem Gebäude.
Ich kann also nicht behaupten, dass meine Kindheit unglücklich gewesen sei. Ganz im Gegenteil, sie war reich an Eindrücken, Fröhlichkeit und gutem Essen. Abgesehen von den Ehefrauen meines Vaters und davon, dass sich der Traum von der Rückkehr in die Heimat nicht erfüllte, dass ich umsonst hoffte, meine Mutter würde mich einmal aus Los Angeles anrufen, und dass ich niemals unbeobachtet mit meiner Großmutter zusammensitzen durfte – abgesehen davon flogen meine Tage leicht wie der Wind dahin. Kurzum, ich freute mich des Lebens bei meinem Vater, den ich von ganzem Herzen und wie mein Augenlicht liebte.
Er war ein gütiger Mann, voller Erinnerungen, Scherze und geistreicher Geschichten. Ich werde nie vergessen, wie er uns an den kalten New-Yorker Winterabenden um den mächtigen Holzofen versammelte und die alten Schnurren erzählte, während er Kastanien röstete, Arrak trank und ab und zu ein Häppchen dazu naschte. Er sagte immer, er sei ein Sohn dieser Welt. Er sei weit herumgekommen und habe alles gesehen und gehört, nichts könne ihn noch überraschen oder aufregen. Dabei brach er vor Rührung in Tränen aus, sobald nur der Name eines Freundes oder Verwandten in Damaskus oder Beirut erwähnt wurde.
Die traurigen Lieder liebte er besonders. Wenn er sie hörte, wiegte er sich zu den Melodien und bewegte flatternd beide Hände, als wolle er gleich auf und davon fliegen. Zuletzt übermannte ihn der Rausch. Sichtlich betrunken, schrie er bei jeder schönen Stelle hingerissen: »Gott! Gott!« Ich blieb sitzen, sah ihm schweigend zu und würgte an meinen Tränen.
Jene Tränen, jene Melodien, jene Geschichten bewahrten mich vor dem Gefühl absoluten Verworfenseins. Denn wenn ich an das Messer und an diesen Blick zurückdenke, erinnere ich mich auch an die Tränen der Sehnsucht, an Träume und Wünsche, die unerfüllt blieben. Bis jetzt klingen mir seine Worte im Ohr: »Ich bin ein Sohn dieser Welt, das ist wahr. Aber ich habe keines Menschen Ehre beschmutzt und niemandes Vertrauen missbraucht. Jede Frau, mit der ich intim wurde, stand mir rechtmäßig zu nach dem Gesetz Gottes und seines Propheten. Mein Lebtag habe ich mich niemals über die Meinung anderer hinweggesetzt, mein Leben lang nahm ich Rücksicht auf die Leute und auf das, was sie sagen. Hör zu, Sainab, die wichtigsten Dinge auf der Welt sind: ein guter Ruf und Furcht vor Gott und dem Jüngsten Tag! Kann der Mensch denn auf eines davon verzichten? Vergisst du Gott, wird er dich vergessen. Missachtest du Gottes Wort, verachtest du auch die Worte der Menschen. So ist das Leben, so ist die Welt. Das Leben ist eine Lehre, eine Warnung und ein Durchgang. Das Leben ist eine Botschaft, die Botschaft von Liebe und Toleranz. Was ist das Leben, Sainab?«
Ich antwortete, und die Tränen rollten mir über die Wangen: »Das Leben ist eine Warnung, Papa.«
»Was noch?«
»Das Leben ist eine Prüfung, Papa.«
»Und weiter?«
»Das Leben ist ein Durchgang.«
»Ein Durchgang wohin? Zu wem?«
»Ein Durchgang ins jenseitige Leben zum Propheten und seinen Gefährten, zu den Gläubigen, den reinen Männern und Frauen.«
»Sehr gut, Töchterchen, wunderbar! Gott schütze dich vor der Welt! Möge er dir den Weg leicht machen und ihn mit guten Vorsätzen und Wohltaten pflastern! Komm, setz dich neben mich, hier hast du eine Kastanie. Gib auf die Häppchen acht, und pass auf, dass du den Arrak nicht umkippst. Was ist denn, Töchterchen? Was hast du?«
3
Großmutter Deborah war der erste Mensch, der mir einfiel, als ich merkte, dass ich schwanger war. Vielleicht, weil Huda zu ihrer Großmutter geflüchtet war, und ich machte es ihr nach. Vielleicht auch, weil Großmutter mir zu Weihnachten immer einen Obstkuchen und eine Karte mit Kerzen darauf schickte. Einmal hatte sie mir sogar einen Teddybären, so groß wie ein Baby, geschenkt. Es war das erste Mal, dass ich ein so großes Spielzeug bekam. Aber mein Vater konnte den Bären nicht leiden. Er sagte, das sei etwas für Jungen. Er nahm ihn mir weg und warf ihn fort. Jedenfalls behauptete er das, aber in Wahrheit tat er es nicht. Nach zehn oder mehr Jahren fand ich den Bären auf dem Zwischenboden unter alten Sachen, die meiner Mutter gehörten. Sobald ich nämlich begriffen hatte, dass ich schwanger war, kletterte ich auf den Zwischenboden und sprang wohl zehnmal hinunter. Müde geworden, hockte ich dann in der Dunkelheit zwischen altem Hausrat voller Schimmel und Schwamm. Niemand stand mir zur Seite, nur jener Teddy. Ich setzte ihn auf meinen Schoß und schluchzte in seinen Bauch hinein. Ich hatte Angst, dass mein Vater die Schwangerschaft entdecken und mich umbringen würde, wie er mir angedroht hatte. Nachher hat er es auch tatsächlich versucht. Aber ich flüchtete aus Brooklyn und schlüpfte bei meiner Großmutter in Washington unter. Dort führte ich ein ganz normales Leben, besser gesagt, überhaupt keins. Meine beiden Leben waren vollkommen verschieden. Zwischen Brooklyn und Washington, anders ausgedrückt, zwischen dem Leben mit der Großmutter und dem Leben mit dem Vater bestand wirklich ein Riesenunterschied. Mein Vater schlug zum Beispiel gern einmal über die Stränge, während Großmutter niemals beschwipst war und auch nie eine Geschichte erfand. Ihre Küche sah aus wie eine Apotheke, alles war blendend weiß, und die Lebensmittel wurden peinlich genau in Gläsern verwahrt. Jedes Körnchen und Krümelchen konnte man in den durchsichtigen Dosen erkennen. Auf jede Dose war ein weißes Etikett geklebt, das sie mit Ziffern und Buchstaben beschriftet hatte. Wenn es mehr als ein Glas gleichen Inhalts gab, schrieb sie: »Zucker 1«, »Zucker 2«, »Zucker 3«. Oder »Englischer Tee«, »Australischer Tee«, »Chinesischer Tee«. Kurzum, ihre Küche war ordentlicher als unser Gemischtwarenladen. Allerdings hatte auch mein Vater sein besonderes Ordnungsprinzip. In wenigen Sekunden hätte er dir irgendeine gewünschte Ware aus diesem seltsamen Durcheinander herausfischen können: Knoblauch, der von der Decke baumelte, Dörrfisch, Wurst, Zwiebeln, sauer eingelegte Rüben, Auberginen, getrocknete Muluchija, Arrak »Cortas«, Tomatenmark und Blütenwasser. Zwischendurch stellte er dem Kunden Fragen, ohne eine Antwort zu erwarten: »Ein Kilo Mandeln und Nüsse? Ein Kilo schwarze Oliven? Drei Yard Schnur? Ein Kilo Kaffee mit Kardamom? Verschnauf mal ein bisschen! Die Welt ist doch kein Flugzeug, weshalb so eilig? Das Leben ist schließlich kein Wettrennen, oder bist du auch schon so weit, dass du durchgehst wie ein Pferd ohne Zügel? Nimms gelassen, genieße die Welt. Wozu die Rennerei? Wozu das Drängeln? Mit wem wetteiferst du? Kannst du etwa die Welt überholen? Oder den Tod? Lass es dir gesagt sein: Sieger bleibt in jedem Fall der Tod. Gott steh uns bei! Wie schnell er ist, wie nahe, näher als die Braue dem Auge! Also stelle alles Gott anheim, und nun setz dich endlich. Nimm eine Tasse Kaffee, rauche eine Wasserpfeife, und hör dir eine Geschichte an. Mach schon, entspann dich. Du gehst mir nicht so weg, bei Gott. Ich lass mich scheiden, wenn du jetzt gehst. Was hast du, Mann? Willst du meine Familie ruinieren und meinen Kindern eine Stiefmutter verpassen? Ich habe schon vier Frauen beisammen, während du noch ledig bist. Na, was meinst du? Lass mich dir eine vorschlagen. Ich wüsste da ein anständiges junges Mädchen, ganz nach deinem Geschmack. Sie ist erst vierzehn und hat die Green Card. Morgen bekämst du die Staatsbürgerschaft und könntest frei herumlaufen. Eine Taille hat sie, die tanzt besser als jede Sprungfeder. Und ein Paar grüne Augen, einfach hinreißend! Rundum proper, wie ein Entlein, und Apfelbäckchen hat sie auch. Blutjung und biegsam, die kannst du noch erziehen, wie du willst. Möchtest du das Mädchen sehen? Schön, bleib ein bisschen hier sitzen, gleich kommt sie aus der Schule. Na, tausendmal willkommen! Nur einen Moment, gleich habe ich deine Sachen beisammen.«
Aber aus dem Moment wurde eine Stunde, ohne dass man merkte, wie die Zeit verging. Es lag ja nicht an der langsamen Bedienung, denn er stellte dir die Waren, wie versprochen, im Handumdrehen zusammen. Der wahre Grund – wenn du die Wahrheit willst – waren all die Geschichten, dieses Erzählen und Plaudern über Antar und Abla, den schlauen Hasan, den dummen Bilal, über das Neueste aus der Nachbarschaft, Skandale, Politik, die Gold- und Silberpreise, Warenangebote, leer stehende Wohnungen, Autos, Fahrräder und so weiter. Hatte er nicht gesagt, er sei ein Sohn dieser Welt? Allerdings einer vollkommen anderen Welt als der meiner Großmutter.
Der Gegensatz zwischen meinem Vater und meiner Großmutter eskalierte, sobald ich schwanger war. Nachdem ich eine Woche bei ihr gewohnt hatte, suchte er uns auf. Wir backten gerade Plätzchen, da schaute Großmutter aus dem Fenster und sah ihn kommen. Sofort schob sie mich in die Vorratskammer. Als er in die Küche trat, versuchte sie, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Doch er gab keine Antwort und ließ seine Augen wie ein Jagdhund überall umherschweifen. Er schien ganz alt geworden und sein Gesicht war dunkel angelaufen. Ich glaubte nicht, dass er mich wirklich umbringen wollte. Die Liebe zwischen uns war viel zu tief. Unvorstellbar, dass er eine solche Tat begehen könnte. Ich hatte die Hoffnung auf Versöhnung noch nicht aufgegeben, obwohl mich Großmutter immer wieder warnte: »Siehst du nicht, was mit Huda und den anderen passiert ist? Waren sie nicht auch kleine Mädchen wie du? Wurden sie nicht von ihrer Familie geliebt?«
Ich hielt die Luft an und beobachtete ihn durch die Türritzen. Sein Gesicht war finster, die Augen traten hervor. Ich sah, dass er Großmutter zurückstieß. Sie versuchte zu telefonieren, er entriss ihr den Hörer und zog den Stecker heraus.
»Das nützt alles nichts, meine Liebe, misch dich ja nicht ein!«, schrie er mit Donnerstimme. »Schluss, aus! Sie ist so gut wie tot. Für ihr Vergehen muss sie büßen. Ich muss meine und ihre Schande mit Blut abwaschen!«
Großmutter versuchte, ihn zu überzeugen, dass ich nicht hier sei, doch er wollte nichts hören. Er rannte ins Wohnzimmer und schlug alles kurz und klein, was ihm im Wege stand, trat mit Füßen um sich und brüllte, was die Stimme hergab, bis er vor Wut völlig außer sich geriet. Bei so einem Anfall, den er nur sehr selten erlitt, verwandelte er sich in ein reißendes Tier ohne Verstand und Wahrnehmung. Dann war er nicht mehr mein Vater, wie ich ihn kannte, sondern irgendein wildfremder Mann.
Er stürmte wieder in die Küche, den Teddybären in der Hand. Erschrocken wich ich zurück. Dabei stieß ich einen Krug um, er fiel zu Boden und zerbrach. Im selben Augenblick lag ich zu seinen Füßen. Er schleifte mich, wie ich war, über und über mit Glassplittern, Marmelade und Blutflecken bedeckt, in die Küche. Er zerrte mich an den Haaren und schrie: »Du Hundetochter! Bei Gott, dein Blut werde ich trinken!«
Ich klammerte mich an seine Hosenbeine und flehte um Gnade. Er reagierte mit derben Schlägen in meinen Bauch und auf meinen Kopf. Dann packte er mich wieder am Haar, riss meinen Kopf zurück und fragte mit böse funkelnden Augen: »Wer ist der Hurensohn?« Er war betrunken und stank nach Arrak. Ich musste mich übergeben. Er schüttelte mich wie einen leeren Sack und schrie wieder: »Wer ist der Hurensohn? Wer hat mich mit Dreck besudelt?«
Ich brachte kein Wort heraus. Allmählich verlor ich das Bewusstsein. Trotzdem spürte ich seine Bewegungen und war sicher, dass mein Ende nahte. Ich kniff die Augen fest zu, presste seine Beine an meine Brust und wartete, dass ein Messer herabsauste. Doch plötzlich ertönte ein lautes Krachen, als ob eine Bombe explodierte. Die ganze Küche wankte, die Gläser schwangen hin und her wie Uhrenpendel. Ich merkte, dass sich seine Muskeln verkrampften, dann schlug er der Länge nach auf den Boden. Für einen Moment begegneten sich unsere Augen in einem Blick voller Erstaunen, Schmerz und Bestürzung. Ich hörte ein Geräusch und schaute zur Tür. Dort stand meine Großmutter mit einem Jagdgewehr in der Hand.
»Keine Bewegung!«, zischte sie. »Oder dein Kopf geht zu Bruch.« Ihr Gesicht war ruhig, ihre Augen bewegten sich nach rechts und links. »Weg mit dem Messer! Sofort!«
»Hundetochter …«, röchelte er.
Da gab sie noch einen Schuss ab. Er traf den Tisch neben ihm, er kippte um und fiel auf ihn.
»Sainab, her zu mir! Komm schnell zu mir!«
Aber ich blieb bestürzt hocken, ich konnte mich nicht bewegen. Sie wandte sich wieder an ihn: »Du kennst mich, Hadsch. Wirf das Messer weg.«
Er schleuderte das Messer mit der linken Hand fort. Die rechte, verwundete drückte er an seine Brust.
»Und du, Mädchen, komm hierher. Geh in mein Zimmer und ruf die Polizei. Los, mach schon!«
Ich stieg die Treppe hinauf, wagte jedoch nicht, die Polizei anzurufen. Ein Gefühl von Schuld, Schande, Angst, Mitleid und Verlorensein blockierte mein Denken und lähmte meine Hand. Auf dem Bettrand sitzend, blickte ich aus dem Fenster. Der Herbst ging zu Ende, die Blätter waren von den Bäumen abgefallen, nur ein paar hingen noch an den Zweigen. Verwirrt flüsterte ich: »Was habe ich getan? Was soll ich machen? Was soll jetzt werden?« Mir wurde schwarz vor Augen, ringsum war es still wie im Grab. In diesem Zustand verharrte ich, die Zeit schien mir stehen geblieben zu sein.
Als ich später hinunterging, hörte ich ihn schreien: »Du bist schuld! Ohne dich wäre sie nicht weggelaufen. Du hast meine Familie ruiniert und mein Herz gebrochen. Du bist keine richtige Frau, und auch kein Mann.«
Besonnen und geduldig redete sie ihm zu: »Beruhige dich, Hadsch. Lass mich deine Wunde säubern. Halt mal fest. Jetzt streng deinen Verstand an, reden wir vernünftig miteinander. Sainab bleibt hier. Geh du zu deinen Leuten, sag ihnen, dass du sie getötet hast und ein Mann bist. Keine Tricks! Dass du ja nicht vor Gericht ziehst oder dergleichen. Du kennst das Ergebnis, du hast es früher schon einmal versucht, probier es also nicht wieder. Vergiss Sainab, wie du ihre Mutter vergessen hast.«
»Ich habe nichts vergessen«, sagte er schluchzend, »mein Lebtag werde ich nicht darüber hinwegkommen.«
Auch ich konnte nicht vergessen. Jahrein, jahraus lebte ich bei meiner Großmutter. Ich vergaß meine Mutter und vergaß meinen Sohn. Aber niemals vergaß ich, wie er damals durch den Korridor getaumelt war, den Arm in einer Schlinge um seinen Hals, den Rücken gebeugt unter der Last einer vieltausendjährigen Schande. Ich rief ihm nach, so laut ich konnte: »Papa, vergib mir!«
Er wandte das Gesicht ab und wies mit der gesunden Hand gen Himmel. Schwerfällig tappte er durch die menschenleere Straße, den Kopf gesenkt, die Binde am Nacken verknotet, und seine Füße schlurften durch Stroh und Laub.
Von Gewissensqualen gepeinigt, rief ich wieder: »Vergib mir, Papa, vergib mir!«
Er winkte noch einmal. Dann verschwand er in der Straße – für immer.
4
Mein Leben bei Großmutter lief wie am Schnürchen, die Ereignisse überschlugen sich. An Einzelheiten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nur zwei Geschehnisse blieben haften, sie beschäftigten mich Tag und Nacht. Das erste war, dass ich meinen Sohn im Adoptionszentrum abgab, und das zweite, dass ich meiner Mutter wieder begegnete. Dazwischen lernte ich von Großmutter, ein neues Leben zu beginnen. Anfangs bewegte ich mich äußerst vorsichtig, wie jemand, der versucht, zwischen den Regentropfen durchzuschlüpfen, ohne nass zu werden. Ständig belehrte sie mich: »Auf den Erfolg kommt es an. Wenn du scheiterst, erlangst du nur Mitleid, aber keine Achtung und Freundschaft. Wenn du deinen Sohn zurückhaben willst, dann geh und nimm ihn dir, falls du für ihn aufkommen kannst.«
Von da an wollte ich gewinnen. Ich siegte in jedem Wettkampf und stellte Rekorde auf. Zuerst glaubte ich, all das nur für meinen Sohn zu tun, nicht etwa für mich. Ich dachte, mein Erfolg würde mich stärken und befähigen, ihn zurückzuholen. Doch je erfolgreicher ich wurde, desto mehr wollte ich erreichen. Am Ende bestand der Erfolg darin, mich selber zu bestätigen, sodass ich schließlich jedes Gefühl für andere verlor.
Die anderen waren für mich nichts weiter als Konkurrenten, und ich besiegte sie alle. Liebe und Emotionen, Verwandtschaft und Freundschaft waren Zeitverschwendung. Es gab mich und Deborah, sonst niemanden. Sogar Deborah rückte in den Hintergrund und verblasste. Ich blieb allein und ging leeren Herzens meiner Wege. Ich hatte nur mich. Niemand gehörte zu mir, ich sah nichts als meinen eigenen Schatten. Meine Schritte verhallten hinter mir, und meine Fragen führten zu keiner Entscheidung. Es blieb auch keine Zeit, weder für Fragen und Antworten noch für Erinnerungen oder Gefühle. Ich hetzte weiter, immer weiter.
Nach und nach wurde ich eine vollkommen andere. Mir lag nichts mehr an Märchen und Wundergeschichten. Ich hatte keinen Spaß mehr, lachte nicht und genoss es nicht, mit anderen zu speisen. Ich lernte, im Gehen ein Sandwich hinunterzuschlingen. Ich lernte, Schweigen zu ertragen und die Tage ohne Freunde zu verbringen. Ich lernte, an Wochenenden stundenlang ohne Lieder und Musik herumzusitzen. Niemand wunderte sich darüber. Meine Großmutter hatte einen strengen Charakter, und meine Kommilitonen und alle anderen Leute waren genauso wie sie. Zugegeben, sie waren freundlich, aber jeder blieb für sich. Jeder drehte sich um seine eigene Achse. Ich lernte meine Lektion und hielt mich daran. Am Ende hatte ich mich selber in einen gläsernen Käfig gesperrt, die Menschen und Dinge blieben draußen.
Eigentlich war es angenehm, so zu leben. Wir sahen alle nett aus, und unsere Konversation war natürlich noch netter. Es gab weder Streit noch Tadel, weder Konflikte noch Antipathien. Wie denn auch, zwischen uns standen ja Glaswände! Kurz gesagt, wir berührten niemanden und wurden nicht berührt. Aber trotz all dieser Friedfertigkeit breitete sich in meinem Inneren, unter der unschuldigen Oberfläche etwas wie Kälte aus. Selbst am Ofen überrieselte mich ein Schauer, ich spürte ihn noch im Hochsommer. Sobald die Nacht hereinbrach und die Lichter ausgingen, verkroch ich mich in Großmutters Schaukelstuhl. Stundenlang saß ich im Dunkeln und sah zu, wie die Glut in Asche zerfiel. Großmutter kehrte spätnachts von irgendeinem Verein zurück, dann setzte sie sich zu mir und begann die Tageszeitungen durchzusehen. Gewöhnlich überließ ich ihr aus Höflichkeit den Schaukelstuhl. Doch wenn ich spürte, dass die Kälte um mich und in mir zu groß war, blieb ich sitzen und tat, als wäre ich gar nicht hier. Dann sah mich Großmutter mitleidig an und sagte: »Bestimmt hast du einen langen Tag hinter dir, du Ärmste. Stimmts?« Wenn ich keine Antwort gab, setzte sie hinzu: »Ach, die Ärmste, wie muss sie sich plagen!«
Sie blieb eine Stunde oder etwas länger sitzen. Bevor sie aufstand, um schlafen zu gehen, hörte ich sie sagen: »Lieber Gott! Was ist nur über Amerika und die Amerikaner gekommen! Was ist bloß über uns gekommen?«
Das »uns« schmerzte mich. Was bedeutete »uns«? Wer war das – »wir«? Wir, die Amerikaner? Ich bin keine Amerikanerin. »Was bist du dann?«, fragte sie mich eines Tages, als ich diese Gedanken aussprach. Ich antwortete nicht, dass ich Araberin sei, denn ich war es nicht. Aber wer war ich dann? Trotz der Nationalität meiner Mutter, der Geburtsurkunde und des Schulzeugnisses, trotz meiner Bücher, meiner Sprache, meiner Kleidung und meines ganzen Lebens war ich eigentlich keine Amerikanerin. Mein tiefstes Inneres war bevölkert von Visionen, Bildern und sehnsüchtigen Mawwalliedern, die mich wie ein Windhauch, wie Veilchenduft und längst verwehter Wohlgeruch umfächelten und mein Herz wie Honig hinschmelzen ließen. Gleich einem Schwarm Schmetterlinge erhob sich die Erinnerung. Bis zum Morgen schwebte sie durchs Zimmer und erfüllte das Dunkel mit dem Duft von Jasmin und Weihrauch, dem Aroma von Kaffee und Kardamom, von Mandeln, Zimt, Gewürzmischungen und Muskatnuss, von geröstetem Brot und Kastanien. Wie Segel glitten die Schmetterlinge dahin, wie winkende Hände, wie ein Schwarm Tauben. Aus weiter Ferne schlug ein Gesang an mein Ohr: »Erbarmen, o Nacht!« Und ich flehte voller Sehnsucht: »Verzeih mir, Papa, verzeih mir doch.« Die ganze Nacht konnte ich so verbringen, während ich zusah, wie die Glut zu Asche wurde.
In der Dunkelheit tastete ihre Hand nach meiner Schulter und rüttelte mich. »Es ist nur ein Traum, Sena«, flüsterte sie, »nur ein Traum.«
»Nein, nein, ich träume nicht.«
»Doch, Sena, es ist nur ein Traum.«
Ein Traum? Was war mit dem kleinen Mädchen und all den Gesängen und Liedern, dem Lachen und Scherzen, dem Essen und Trinken, den Appetithäppchen und dem Arrak? »Nur ein Traum, Sena, nur ein Traum.« Dann ging sie wieder schlafen.
Vielleicht war ich krank. Sie konsultierte einen Nervenarzt, der ihr sofort erklärte: »Ein Gefühl der Entfremdung, nichts weiter.« Sie nickte verständnisvoll und meinte: »Natürlich, das muss es sein. Eine kleine Mutter mit einem kleinen Kind.« Sie brachte mich zu ihm. Der Junge lächelte. Sobald ich jedoch näher trat, um ihn anzufassen, zuckte er zurück und weinte vor Angst.
»Fühlst du dich jetzt besser?«
»Gar nichts fühle ich.«
Großmutter war betroffen und sagte nichts mehr. Erst auf dem Heimweg begann sie auf mich einzureden: »Das ist nicht recht. Eine Mutter sollte doch etwas spüren.«
Sie fuhr fort, mich zu ermahnen, bis ich ihr Predigen satt bekam. Ich überlegte: Müssen wir etwas fühlen oder nicht? Und dieses kleine Kind? Fühlt es etwas oder nicht? Wenn ja, was fühlt es? Fühlt es Ärger? Liebe? Fremdheit oder Furcht? Spürt so ein kleines Kind schon Entfremdung? Weiß es von allein, wer seine Mutter ist, oder lernt es das erst? Ob es merkt, dass ich nichts fühle?
Großmutter war wirklich sehr geduldig. Sie lud meine Mutter ein, uns zu besuchen, und sie kam tatsächlich aus Los Angeles. Ich probte gerade im Saal, als sie zu mir hinter die Kulissen trat. Sie lachte und weinte und sagte wie zu ihrer Verteidigung: »Damals war ich noch zu jung.« Dann wischte sie sich die Tränen ab und setzte hinzu: »Ich war alldem nicht gewachsen, ich hielt es nicht aus. Ihre Gewohnheiten, ihr Essen, ihr Trinken, ihre ganze Art! Ihr Wesen war so fremd, ich ertrug es nicht.«
Ich erwiderte kein einziges Wort und schaute unverwandt in den Spiegel.
»Tadle mich nicht!«, sagte sie bittend.
»Weshalb sollte ich dich tadeln?«
»So liebst du mich?«
»Ich hasse dich nicht.«
»Und was ist mit Liebe?«
Sie erschien mir dumm, und ich verspürte Überdruss und Langeweile. Doch sie fuhr fort zu schwatzen, zu weinen und zu schluchzen, bis ich beinahe die Nerven verlor. Schließlich schrie ich: »Ich bitte dich, sag mir, wie ich dich lieben soll, wenn ich dich überhaupt nicht kenne!«
»Aber ihn liebst du wohl?«, entgegnete sie vorwurfsvoll.
Ich gab kein Wort, keinen Laut von mir.
»Obwohl er versucht hat, dich umzubringen!«
Ich verteidigte weder ihn noch mich.
»Umbringen wollte er dich!«
Ich blickte sie nicht an, schaute in den Spiegel.
»Ich tadele ihn nicht, ich tadele dich nicht«, sagte ich schließlich, »ich tadele niemanden. Ich wundere mich nur.«
»Sie wundert sich nur«, flüsterte sie verblüfft, »sie wundert sich!« Noch während sie zur Tür hinausging, wiederholte sie immerfort: »Sie wundert sich nur, sie wundert sich!« Als sie bei ihrem Auto angekommen war, winkte sie noch einmal. Ich winkte auch und sah ihr nach, bis sie verschwunden war.
5
Mein akademisches Leben war schlichtweg fade. Ohne Geschmack, ohne Empfindung. Als meine Mutter starb, erbte ich. Nun besaß ich zwei Appartements, eins in Washington, das andere in San Diego. Ich hatte zwei Autos und besuchte Partys auf Jachten, in Botschaften, an Swimming-Pools. Ich wurde Mitglied in drei Klubs, trainierte Aerobic und genoss Whirlpool, Massage und Sauna. Aber trotz all dieses Luxus hatte ich das Gefühl, dass ich etwas entbehrte. Deshalb fragte mich Großmutter auch immer: »Was fehlt dir denn? Hast du keinen Erfolg?«
O doch, ich war erfolgreich, und wie! Ich gewann den Preis für den besten Universitätsabschluss und stieg zur Leiterin der Sektion Anthropologie auf. Aber was dann? Wie sollte es weitergehen? Jetzt war ich in den Dreißigern, in zehn Jahren würde ich in den Vierzigern sein, dann in den Fünfzigern und Sechzigern, danach ginge ich in Pension und würde sterben. Was käme nach dem Tod? Und kurz vor dem Tod? Was bliebe mir, wenn ich erst einmal sechzig wäre? Wie würde ich dann sein? Sicher die genaue Kopie meiner Großmutter: Ich würde Marmelade einkochen, Plätzchen backen, Wohltätigkeitsvereinen beitreten und jeden Sonntag in der Kirche beten. Nein, das nicht. Bis jetzt war ich nicht zur Kirche gegangen und würde es nicht tun. Ich war keine Christin. Aber auch keine Muslimin. Großmutter mahnte mich immer wieder: »Du brauchst ein Bekenntnis, du brauchst einen Glauben.«
Was denn für einen Glauben?, fragte ich mich. Selbst als ich noch klein war und gar nicht genug lernen, einwenden und fragen konnte, war mir das Gerede von einer himmlischen Gerechtigkeit unerträglich. Vielmehr war ich vollkommen überzeugt, dass alles, was mir passierte, ein schlagender Beweis für den Tod der Gerechtigkeit sei. Wenn es überhaupt eine Gerechtigkeit gab, musste sie ja nicht unbedingt vom Himmel kommen. Außerdem betrat ich die Kirche höchstens zu einer Hochzeit oder Trauerfeier. Hörte ich sie dann ihre Choräle singen, rollte mir schon einmal eine Träne aus den Augen, aber die wischte ich gleich wieder ab. Meine Tränen durften nur fließen, wenn ich allein über mich und mein vergebliches Suchen nachgrübelte. Das Geheimnis meines Erfolgs bestand ja gerade darin, dass ich nicht weinte und zusammenbrach.
6
Mit der Zeit wuchs meine Entfremdung, bis ich der Einsamkeit überdrüssig war und mich ohne Wenn und Aber nach der Vergangenheit zurücksehnte. Dieses ganze Suchen nach Identität war ein zu dürftiger Ersatz. Schmerz und innere Zerrissenheit waren nur noch eine alte Wunde, die längst nicht mehr blutete. Nur die Narbe tief drinnen erinnerte noch an vergangene Seelenqualen. Es gab keine Ausflüchte mehr. Am Ende musste ich mir eingestehen, dass ich weder Ruhe noch Frieden fände, bis ich umkehrte, zurück in die Vergangenheit, zu dem, was ich verloren hatte.
Meine Reise begann in New York. Zum ersten Mal seit meiner Flucht machte ich mich auf den Weg zu unserem Kramladen in Brooklyn. Dort sah alles ganz verändert aus, wie verwandelt. Unseren Laden gab es nicht mehr, an seiner Stelle erhob sich ein protziges, weißes Gebäude, beinahe ein Palast. Davor standen eine hohe Mauer, dichte Bäume und ein braun gebrannter arabischer Wächter, der mich fragte, was ich wünsche. Ich sagte, dass ich nach meinem Vater suchte. Unser Gemischtwarenladen habe sich hier, genau an der Stelle der Villa, befunden. »Wann soll das gewesen sein?«, fragte der Mann mit staunend aufgerissenen Augen. Er wohne seit Jahren in Brooklyn und kenne viele Ladeninhaber, aber von einem Händler namens Hadsch Muhammad habe er nie etwas gehört. Dann schlug er vor, ich möge seinen Vater aufsuchen und ihn fragen. Sein Vater sei ein betagter Mann, vielleicht erinnere er sich.
7
Ich bog in die Nebenstraße ein und versuchte, mir die Dinge und Ereignisse von einst zurückzurufen. Hier sind wir so oft gewesen, hierher kamen wir immer! Da, die Uferpromenade und die Kreuzung, die Bäume im Westend drüben hinter dem Fluss, die Musik der schwarzen Jugendlichen auf dem Platz, ein Mann, der zugedeckt mit seinem Mantel auf der Bank schlief. Alles war noch an Ort und Stelle, nur nicht der Vater, sein Geschäft, die Ladenzeile und die Nachbarn. Ich gelangte zu dem Haus und klopfte an die Tür. Eine Frau trat heraus. Sie erinnerte mich an die Frauen meines Vaters.
»Ja, meine Dame«, sagte sie freundlich. »Abu Falih ist da, er sitzt am Fenster.« Lächelnd wies sie hinein, ihre Goldreifen klirrten.
Er saß im Schaukelstuhl am Fenster, das nach Westen ging. Über seine Beine war eine gehäkelte Decke gebreitet, auf dem Kopf trug er eine arabische Baumwollkappe. Durch das Fenster hinter ihm waren, übereinander gestapelt wie Streichholzschachteln und Legosteine, die Wolkenkratzer zu sehen. Der Widerspruch zwischen Motiv und Hintergrund konnte nicht krasser sein: Greis mit uralten Gesichtszügen vor supermodernen Gebäuden und Hochhäusern.
»Er schläft und wacht auf, so geht das den ganzen Tag«, flüsterte die Frau. »Er vergisst sofort alles, aber weit zurückliegende Dinge weiß er noch. Er erinnert sich an den Feigenbaum und den Backofen, an Hadsch Muhammad und den Muchtar, nur mich vergisst er. Trinken Sie Kaffee oder eine Limonade? Aber ich bitte Sie, nein, Sie müssen etwas zu sich nehmen. Ach was, von wegen Umstände. Sind wir denn Amerikaner? Bei Gott, wenn wir anstatt fünfzig sogar hundertfünfzig Jahre in Amerika lebten, würden wir doch nicht so werden wie die. Ihr Vater hat hier gewohnt, sagen Sie? Nein wirklich, wie die Zeit vergeht. Das muss gewesen sein, bevor ich diesen alten Mann heiratete. Warten Sie, er wird gleich aufwachen. Um diese Zeit wird er immer munter, dann gibt er Ihnen Auskunft. Vielleicht besinnt er sich, vielleicht auch nicht. Sie müssen Geduld haben. Ich bringe Ihnen erst mal ein Glas Limonade, sonst werden Sie mir noch verdursten.«
Ich setzte mich auf das Sofa in der Ecke unter dem üblichen Konterfei des Hausherrn: Abu Falih in der Blüte seiner Jugend mit Fes und Tuch. Unten im Rahmen steckte das Farbfoto einer Gruppe Männer mit Hüten und Schnurrbärten. In dem dunklen Winkel, wo ich Platz genommen hatte, stand ein Tisch mit einer bestickten Decke, Plastikblumen und Fotos von Enkelkindern, zahlreich wie die Ameisen. Eine Braut, ein Absolvent, ein junger Bursche, ein Mann und eine Frau mittleren Alters, ein kleiner Junge, noch einer, ein kleines Mädchen, und wieder ein Junge, ein Buick, Modell aus den Zwanzigerjahren, davor ein Mann mit weißen Gamaschen und Tarbusch, einen Fuß auf der Erde, den anderen seitlich auf der Stoßstange. An der Wand gegenüber hing wie ein Gemälde ein Gebetsteppich mit dem Felsendom und einigen Koranversen.
Abu Falih erwachte. Er nippte an der Limonade, gähnte und beachtete meine Anwesenheit überhaupt nicht.
Die Frau klopfte ihm auf den Rücken. »He, Abu Falih! Die Dame kommt aus Washington. Gib ihr Auskunft. Kennst du einen, der früher mal einen Gemischtwarenladen in der Straße neben der Bäckerei hatte?«
»Was für eine Bäckerei?«, fragte er verwundert.
Sie zwinkerte mir zu und flüsterte: »Nichts zu machen. Aber es wird schon noch werden.« Sie klopfte ihm wieder auf den Rücken. »Erinnerst du dich nicht, Hadsch, weißt dus nicht mehr? Vielleicht ist er hier auf dem Foto mit euch abgebildet. Schauen Sie, meine Tochter, womöglich erkennen Sie ihn.«
Ich nahm das Foto. Der da könnte es sein, oder jener. Trotzdem, dieser war es nicht, und jener auch nicht. Alle sahen aus wie mein Vater, aber keiner war mein Vater.
»Ihr Arabisch ist sicher nicht ganz perfekt«, sagte die Frau. »Ihre Mutter ist wohl Araberin, oder nicht?«
»Sie ist schon lange tot«, antwortete ich mit stockender, unsicherer Stimme, »ich erinnere mich nicht an sie. Aber als ich klein war, sprach ich gut Arabisch. Vater erzählte uns immer Geschichten, eine nach der anderen, kleine und große. Stundenlang redete er von Jerusalem und dann wieder über eine Stadt, ich hab vergessen, wie sie hieß. Ich weiß es wirklich nicht mehr, es klang wie al-Ram oder al-Taira, vielleicht auch Abu Dis, ich weiß nicht mehr, immerfort brachte er neue Namen an. Vor allem Jerusalem, immer wieder Jerusalem, aber auch al-Dabagh, Bab al-Chalil und al-Musrara.«
»Ach, welch ein Land!«, murmelte der Mann seufzend. »Wohin sind diese schönen Tage entschwunden!«
Die Frau sah mir ins Gesicht, als wolle sie mir Mut machen. »Reden Sie weiter, lassen Sie ihn mehr hören.«
Ich durchstöberte meinen Kopf nach Erinnerungen, irgendeiner Geschichte, fand aber nichts als verschwommene Vorstellungen von einem Bild, das bei uns im Salon hing, und von Szenen, die hier und da in meinem Gedächtnis aufblitzten. Der Platz in der Aksa-Moschee, die Kuppel, steinerne Fliesen, Bögen und Säulen aus Silber, duftende Pflanzen und Wasser zur rituellen Waschung, das an heißen Tagen wie geschmolzenes Eis aus dem Wasserhahn sprudelt. Und mein Vater, der seine Kreise zieht wie ein Vogel. Er trägt seinen gewohnten Korb mit perlmuttverzierten Koranexemplaren, Kuhl-Gefäßen aus Messing in Gestalt eines Pfaus, Schminkstäbchen in Flügelform, Gebetsketten aus Bernstein, Muscheln und Karneol und geschnitzten Karawanen aus Ölbaumholz.
»Jerusalem, Jerusalem«, murmelte der Mann wieder, »was für eine Stadt! Wohin entschwanden diese schönen Tage!«
»Na, was ist, mein Alter?«, fragte die Frau scherzend. »Wollen wir nicht nach Hause zurückkehren, dass wir Heil und Segen durch unsere Pilgerschaft erlangen und nach der langen Abwesenheit wieder zu uns finden?«