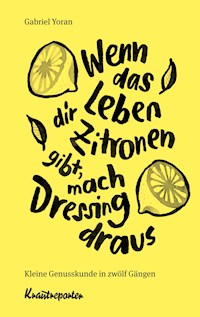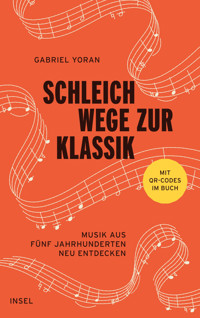18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum es gar nicht so leicht ist, den Planeten gesundzukonsumieren
»Knebel« nennt man die drehbaren Elemente an Küchenherden, mit denen sich bequem die Temperatur regulieren lässt. Wer heute einen Induktionsherd kauft, verbiegt sich freilich bald die Finger auf widerspenstigen Touchflächen. Solche Dinge, die in gewissen Hinsichten schlechter sind, als sie einmal waren oder sein könnten, nennt Gabriel Yoran »Krempel«. Warum existieren sie überhaupt? Würde man sich die Weiterentwicklung von Produkten nicht als linearen Fortschritt vorstellen?
Warenkritik gilt wahlweise als angestaubter Antikapitalismus oder Ausdruck reaktionärer Nostalgie. Gleichzeitig sollen wir mit unseren Kaufentscheidungen das Klima retten oder zu besseren Arbeitsbedingungen im globalen Süden beitragen. In dieser Lage fragt Yoran, ausgehend von Brauseschläuchen und Kaffeevollautomaten, nach den Ursachen der Verkrempelung. Und er wagt sich an den oft tabuisierten Versuch, über Kriterien für die Legitimität von Bedürfnissen nachzudenken. Yoran tut dies so unterhaltsam wie umfassend informiert – und in dem Bewusstsein, dass wir als Verbraucher:innen ebenfalls in den Verkrempelungszusammenhang verstrickt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Gabriel Yoran
Die Verkrempelung der Welt
Zum Stand der Dinge (des Alltags)
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.Korrigierte Fassung, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: nach Entwürfen von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78282-8
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
1. Kauf halt was anderes, wenn es dir nicht passt
2. Das hat doch alles schon mal funktioniert!
3. Was war Fortschritt?
4. Wie ich mich vom Konsum freikaufen wollte
5. Ein Bund gegen den Schund
6. Du weißt doch, was gemeint ist
7. Sie haben Geld, sie haben Zeit und sie brauchen dringend ein Hobby
8. Warum viele Produkte anderswo besser sind
9. Nicht der Kundendienst ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt
10. Das letzte Tabu
Anmerkungen
1. Kauf halt was anderes, wenn es dir nicht passt
2. Das hat doch alles schon mal funktioniert!
3. Was war Fortschritt?
4. Wie ich mich vom Konsum freikaufen wollte
5. Ein Bund gegen den Schund
6. Du weißt doch, was gemeint ist
7. Sie haben Geld, sie haben Zeit und sie brauchen dringend ein Hobby
8. Warum viele Produkte anderswo besser sind
9. Nicht der Kundendienst ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt
10. Das letzte Tabu
Dank
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
7
1. Kauf halt was anderes, wenn es dir nicht passt
So, jetzt ist es so weit: Ich bin meine Mutter.
Das dachte ich, als ich auf das Kochfeld des neuen Herds blickte. Nichts ergab irgendeinen Sinn. Was bedeuten die Zahlen? Wo soll ich drücken? Hilfe!
8So fühlen sich vermutlich meine Eltern, wenn auf dem Computer ein unbekanntes Fenster aufploppt oder das Handy nach dem Passwort für etwas verlangt, von dem sie noch nie gehört haben. Eben ging man noch ganz selbstverständlich mit etwas um, plötzlich erscheint es einem fremd, geradezu feindselig.
Im Februar 2022 postete ich ein Foto des Herdbedienfelds auf Twitter, und siebentausend Likes später wusste ich, dass ich einer Sache auf der Spur war. Statt mit Knebeln, den klassischen Drehstellern an der Front von Küchen- und anderen Geräten, wird die Temperatur an dem neuen Herd über ein futzeliges Touchfeld eingestellt, das erst beim dritten Anlauf reagiert, unmittelbar neben den heißen Töpfen platziert ist und sich bei Kontakt mit selbigen (oder Wasser) piepsend abschaltet. Zudem ist es mit der völlig rätselhaften Zeichenfolge »0 1 3 5 8 10 14 A« beschriftet.
Alles an diesem User-Interface ist völlig unverständlich. Vor allem aber, wie es seinen Weg durch den Entwicklungsprozess, die Nutzertests, die Qualitätskontrolle und schließlich in den deutschen Einzelhandel machen konnte. Wer hat sich das ausgedacht? Warum ist niemand in irgendeiner Produktkonferenz aufgestanden und hat gesagt: Entschuldigung, aber das ist doch kompletter Stuss!
Dieser Herd ist keine Ausnahme. Die billigere wie die teurere Konkurrenz ist heute oft mit einer solchen Touchbedienung ausgestattet, die keine relevanten Vorteile, dafür aber handfeste Nachteile hat. Die früher üblichen Knäufe konnte man bedienen, ohne hinzuschauen, ohne sich die Finger zu verbiegen oder sie sich zu verbrennen (weil man damals eben nicht genau da hantieren musste, wo die heiße Pfanne steht), sie reagierten auf Anhieb, 9auch wenn man sie mit feuchten Händen anfasste. Die Touchfelder haben nur einen Vorteil, jedoch nicht für die Kundschaft: Sie sind tatsächlich günstiger in der Herstellung – die Herde werden aber nicht billiger verkauft. Will man hingegen einen modernen Herd mit klassischen controls, muss man einen Aufpreis zahlen.
Nun ist es keineswegs so, dass an den neuen Geräten alles schlechter wäre. Alle, die mal mit Induktion gekocht haben, werden zustimmen, dass diese Technik gegenüber einem herkömmlichen E-Herd viele Vorteile hat – die Temperatur lässt sich präziser steuern, der Stromverbrauch ist geringer, und die Herdplatte wird nicht heiß (der Topf schon!).
Man kann an solchen Geräten eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von Fort- und Rückschritt beobachten. Während die Primärfunktionen, beim Herd also das Erhitzen von Speisen, besser und effizienter erfüllt werden, verlangt das Produkt eine hakelige, unnötig umständliche Befassung mit sich. Nicht die Dinge bedienen uns, sondern sie »wollen bedient werden«, wie der Medienphilosoph Vilém Flusser schon in dem 1993 erschienenen Buch Dinge und Undinge schrieb.1 Und dieses, im doppelten Sinne, Befassungsbedürfnis der Dinge ist seitdem in vielen Produktkategorien steil angewachsen.
Wasch- und Spülmaschinen erzielen zwar mit so wenig Strom und Wasser wie nie sehr gute Ergebnisse, machen sich derweil aber mit immer mehr (teils angeblich KI-gesteuerten) Programmen wichtig, die niemand benutzt. Sie piepsen ganze Melodien und blinken um die Aufmerksamkeit der Familie, die doch einfach nur saubere Wäsche und Teller will. Dafür gehen sie schneller kaputt als ältere Modelle.
Was Stromverbrauch und Haltbarkeit anbelangt, sind 10moderne LEDs klassischen Glühbirnen geradezu beschämend überlegen, auch das Problem der zu kalten Farbtemperaturen hat man in den Griff bekommen. Die fancy Heim-Automatisierung verlangt allerdings, dass Gäste eine App installieren, um das Licht im Klo einzuschalten.
Autos sind sicherer als je zuvor, und Fortschritte in der Batterieentwicklung ermöglichen mittlerweile auch elektrisch respektable Reichweiten. In der 2019er-Baureihe von Deutschlands meistverkauftem Pkw, dem VW Golf, regelt man Heizung und Klima jedoch nicht mehr mit Knöpfen, sondern über eine berührungsempfindliche, unbeleuchtete Fläche, die man nachts nur findet, wenn man weiß, wo sie ist, und die man nicht bedienen kann, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. Wohlgemerkt: Es geht nicht um irgendwelche abwegigen Spezialeinstellungen, sondern schlicht darum, die Temperatur im Innenraum zu ändern.
Das Radio im 2019er-Golf verzichtet, wie die Autozeitung berichtet, ebenfalls
komplett auf lieb gewonnene Drehknöpfe. Im Klartext: Man muss die Touch-Flächen für »Volume +« und »Volume –« finden und durch Tippen oder Finger-Dauerauflage bedienen. Das geht während der Fahrt oft nicht wie gewünscht, muss wiederholt werden und gelingt selbst nach Eingewöhnung nicht ohne Blickkontrolle. Und so trauern sämtliche Tester dem bewährten Drehknopf nach.2
Ursächlich für diese bemerkenswerten Designentscheidungen sind nicht nur die niedrigeren Kosten der Touchcontrols, sondern möglicherweise auch überschießende Scheininnovationen an anderer Stelle. In VW-Fanforen wird spekuliert, dass hinter der Klima-Control-Unit ein 11Infrarotsensor für die neue Gestenerkennung eingebaut sei, weshalb dieses Feld unbeleuchtet bleiben müsse. Der Sensor erlaubt die Steuerung, beispielsweise der Radiolautstärke, mit Wischgesten in der Luft. Im Test kommt die Fuchtelbedienung nicht besonders gut weg, zumal neue Gesten auswendig gelernt werden müssen.
Bedienungsparadigmen ändern sich mit der Zeit – das ist nicht kritikwürdig. Heute spielt man Alben via Spotify ab, und nur noch wenige Nostalgiker trauern Schallplatten hinterher. Aber wie Volkswagen (und viele Wettbewerber) tadellos funktionierende Lösungen gegen ergonomisch schlechtere auszutauschen, während man gleichzeitig einen Fortschritt in Form von Touch- und Gestensteuerung behauptet, das erfordert schon einigen Willen zum Selbstbetrug – auch von der Kundschaft, die ihre Fahrzeuge ja mögen will. (Fünf Jahre nach Markteinführung des Golf VIII, mit dem »Facelift« 2024, ist die Klima-Control-Einheit nun wieder beleuchtet – wie in all den Jahrzehnten zuvor. Keine Pointe.)
Dass Waren besser und schlechter zugleich werden, habe ich in meinem Bekanntenkreis noch nicht gehört. Die Behauptung hingegen, früher sei alles besser gewesen, ist moderne Folklore. In den USA sagt man »They don't make 'em like that anymore«, was so viel heißt wie: So was (Gutes) gibt es heute gar nicht mehr. Wie Zombies suchen Probleme, die in Allerweltsprodukten schon gelöst waren, unseren Alltag heim. Dinge, die tadellos funktioniert haben, werden mit der nächsten Produktgeneration aus scheinbar unerfindlichen Gründen wieder schlechter.
Dieses Unbehagen am Konsum ist nicht nur mein individueller Eindruck. Überall in der westlichen Welt sitzen Verbraucher:innen verzagt vor ihren Anschaffungen. Im 12US-amerikanischen Onlinemagazin Vox etwa heißt es: »Your stuff is actually worse now«3 (»Ihre Sachen sind jetzt tatsächlich schlechter«). Die Wirtschaftswoche beklagt: »Bei vielen Gütern und Dienstleistungen verschlechtert sich die Qualität.«4 »Your sweaters are garbage« (»Ihre Pullis sind Müll«), stellt The Atlantic fest.5 Aber nicht nur Konsumgüter sind betroffen. Ärzte beklagen in einem Fachartikel das immer dünnere Plastik bei Atemschläuchen – eine potenziell lebensgefährliche Entwicklung. Die besorgniserregende Überschrift: »Quality fade in medical device manufacturing«.6»Quality fade« wird zwar meist mit »Qualitätsabbau« übersetzt, aber das suggeriert ein absichtliches Vorgehen, also jemanden, der da etwas abbaut. »Fading« hingegen bezeichnet ein Nachlassen, etwas, für das niemand konkret Verantwortung trägt. Tatsächlich ist beides der Fall.
Und es betrifft nicht nur physische Dinge. Auch Produkte, die ausschließlich online existieren, verkommen. Der Autor Cory Doctorow beschreibt unter dem Titel »Enshittification« (in etwa »Scheißifizierung«) die offenbar zwangsläufige Verschlechterung von Social-Media-Plattformen: Der »Plattform-Kapitalismus« führe zu Monopolen und damit zwangsläufig zu Angeboten, die gerade gut genug sind, dass die Kundschaft nicht in Massen davonläuft.7
Man könnte diese Phänomene als Luxusprobleme abtun. Niemand muss seine Zeit mit Social Media verplempern. Wer immer das Neueste kauft, kauft eben Unausgereiftes. Man könnte sie als überschießenden Fortschritt entschuldigen, der sich mit der Zeit selbst korrigiert. Oder eben einfach als unbedeutend im Angesicht der globalen Krisen. Man könnte sie als Boomergejammer verwerfen.
Und ja: Marktregulierung, Sicherheitsbestimmungen, 13Siegel, Zertifikate und unabhängige Tests machen es Konsument:innen heute schwer, wirklich gesundheitsschädigende oder gefährliche Kaufentscheidungen zu treffen. Tatsächlich gibt es in manchen Kategorien gar keine richtig schlechten Produkte mehr, zumindest nach allgemein anerkannten Kriterien. Wirecutter, das Verbrauchermagazin der New York Times, stellte zum Beispiel fest, dass man praktisch keine schlechten Fotoapparate mehr kaufen kann.8 Die Hersteller hätten begriffen, dass sie im Massenmarkt der Schnappschüsse, Familien- und Urlaubsfotos gegen Handykameras keine Chance haben. Stattdessen konzentrieren sie sich nun auf teurere, sehr gut verarbeitete Produkte, die können, was ein Smartphone nicht kann. Das Ergebnis sind großartige Geräte – in einer Nische. In etlichen Massenmärkten sieht die Lage ganz anders aus.
Viele Verbraucher:innen haben das nagende Gefühl, die Dinge des Alltags würden auf merkwürdige Art schlechter. Darüber zu sprechen ist nicht einfach. Mit einer Ausnahme: Es gilt als legitim, industriell produzierte Lebensmittel zu kritisieren. Alle hassen diese Branche, und der Industrie-Insider Sebastian Lege bekommt mit seinen Fernsehshows, in denen er die »Tricks der Lebensmittelindustrie« genüsslich vorführt, jede Woche viele Stunden Sendezeit auf den Kanälen des ZDF. Aber seine Polemik geht manchmal auf Kosten der Fakten, denn wenn das Industrieprodukt besser ist als das handwerklich hergestellte (und das passiert sogar bei Brot), passt die Story nicht mehr.9
Abgesehen von Lebensmitteln gilt die Kritik an Waren aber als rückwärtsgewandt (»Früher war alles besser«) oder frivol (»Uns geht es doch im Vergleich sehr gut«). Sich zum Konsum korrekt zu verhalten ist außerdem schwer, 14weil man sich ja nur konsumierend zu ihm verhalten kann: Kauf halt was anderes, wenn es dir nicht passt.
Aber damit will ich mich nicht abfinden. Die Dinge des Alltags sind nicht egal, denn gute Dinge machen gute Dinge mit uns – und schlechte Dinge schlechte. Wenn wir die schlechten Dinge befragen, die Bedingungen, unter denen sie entwickelt und vertrieben werden, erzählen sie uns von den Ursachen, Mechanismen und Anreizsystemen, die sie schlechter sein lassen, als sie sein müssten.
Diesen Dingen möchte ich den altmodischen Namen »Krempel« geben. Krempel wie das auf Dachböden und in Kellern gesammelte Zeug, das ein Zwischenreich bewohnt, in dem die Dinge aufgegeben, aber noch nicht weggeworfen wurden. Krempel wartet nur darauf, abgelöst zu werden. Denn es ist die provozierende Vorläufigkeit von Objekten wie dem erwähnten Kochfeld, die sie zu Krempel macht. Ob es Sparmaßnahmen sind, die sich in schlechterer Materialqualität äußern, oder eine freidrehende Fortschrittssimulation, die Produkten unnötige Komplexität hinzufügt: Je verzweifelter das Vorgängerprodukt übertrumpft werden muss, desto Krempel.
Wir sind zum Konsum verdammt; unser Wirtschaftssystem verlangt ihn von uns. Man kann nicht nicht konsumieren. Aber das Ideal des nachhaltigen, nicht zerstörerischen Konsums scheint unerreichbar, politisch, wirtschaftlich, logistisch – vor allem psychologisch, weil Konsum ein Alldurchdringer ist. Wenn du als Konsument:in definiert wirst, ist es schwer erträglich, für Konsum kritisiert zu werden.
Unsere Welt wird als Ort verstanden, an dem konsumiert wird. Wenn Warenhäuser zumachen, wird sofort die »Verödung der Innenstädte« befürchtet. Es ist ein Zir15kelschluss, auf den der Philosoph Matthias Warkus hingewiesen hat: Irgendwann wurde »Verödung« gleichbedeutend mit der Aufgabe von Geschäften. Mit anderen Worten: Wir können uns Städte schlechterdings nur als Konsumorte vorstellen; eine Kritik des Konsums wird so zu einer Kritik unserer Seinsweise als Menschen in Städten.
Als Gegenbewegung zum Krempel-Konsumismus präsentieren sich die »Minimalisten«, Menschen, die mit möglichst wenig Dingen und auf möglichst wenig Raum auskommen wollen. Es ist ein Trend, aber ich kenne mehr Dokumentarfilme über solche Leute als Minimalisten selbst. Der Begriff ist auch nicht wirklich trennscharf, werden darunter doch Selbstversorger-Aussteiger ebenso gefasst wie Leute mit maßgefertigten Einbauschränken, in denen alles verschwindet, so dass die Wohnung immer clean aussieht.
Alle Minimalisten soll die Überzeugung verbinden, dass mehr Besitz nicht mehr Glück bedeutet. Es ist eine wenig überraschende kapitalistische Paradoxie, dass selbst dieser Trend längst wieder konsumierbar gemacht wurde, mit einer Ästhetik der klaren Linien, die tatsächlich nur für gutes Geld zu haben ist. Der technische Aufwand, der etwa betrieben werden muss, um von einer herkömmlichen zu einer wirklich glatten Küchenarbeitsplatte zu gelangen – also einer ohne überstehende Spülbecken und Kochfelder –, ist erheblich. Auch in Oberschränken versenkbare Dunstabzugshauben kosten extra. Alles, was Technik unsichtbar werden lässt und Kanten gerade, ist teuer. Minimalismus, als Gestaltungsprinzip verstanden, bedeutet Maximalismus bei den Kosten.
Eine besonders augenfällige Perversion der minimalistischen Idee ist das Tiny House, eine zeitgenössische In16terpretation der einsamen Waldhütte. Diese winzigen frei stehenden Häuser sind aber weder eine Antwort auf die Wohnraumkrise noch besonders energieeffizient. Und auch Tiny Houses müssen auf Grundstücken stehen. In Wirklichkeit sind diese Gebäude Zweit- oder Drittimmobilien für Leute mit genug Geld, um sich keine Gedanken über echte Problemlösungen machen zu müssen.
Bei kaum einer Alltagstätigkeit fallen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie beim Konsumieren. Ich soll das Richtige kaufen, nicht zu viel, nicht zu billig, nicht über meinen Verhältnissen, nicht unter meinem Niveau. Ich soll verantwortungsvoll konsumieren, kein Kind in einer baufälligen Textilfabrik in Bangladesch ausbeuten, auch nicht den Logistikleiharbeiter im Verteilzentrum vor Berlin. Ich soll nur ausnahmsweise bei Amazon bestellen, lieber gar nicht. An Starbucks muss ich vorbeigehen, doch schon bei Aldi und Ikea ist die Sache komplizierter, handelt es sich dabei doch um Ketten mit geradezu normativer Marktmacht: Diese Unternehmen markieren den Standard, das Normalnull des deutschen Konsums. Da sie sich (im Fall von Ikea: vermutlich) in Familienbesitz befinden, entziehen sie sich jeglicher Kontrolle, und sei es nur durch Aktionäre oder Fonds, die mehr Nachhaltigkeit durchsetzen wollen (siehe Kapitel 2). Doch als 2019 das Berliner Hipster-Feinkostparadies Markthalle Neun der Aldi-Filiale in einer Ecke des Gebäudes kündigte, protestierten die Anwohner:innen. Sie befürchteten den Todesstoß durch die Gentrifizierung: In einem Kiez, in dem, so Zeit online, 25 Prozent der Menschen von staatlichen Transferleistungen abhängen, verschwindet ein bezahlbares Lebensmittelgeschäft.10 Dreihundert Anwohnende demonstrierten für die Ärmsten – und gleichzeitig für eine milliardenschwere Discounterkette.
17Die Fundamentalkritik am Kapitalismus ist, wohl aufgrund ihrer Fruchtlosigkeit, einer Kritik des individuellen Konsums gewichen. Diese wendet sich nicht gegen ein System, sondern gegen die Lebensweise jedes Einzelnen. Als moralische Anforderung wird sie leichter vorgebracht, ist aber auch schwerer auszuhalten. Man fügt sich in sein konsumierendes Schicksal, tut kaufend etwas für die Wirtschaft, ab und zu akzentuiert von einer besonders vernünftigen Kaufentscheidung, einem besonders fairen Kaffee vielleicht.
Wer konsumiert, zerstört. Selbst eine Kreislaufwirtschaft würde Abfall erzeugen, der nicht wiederverwertet werden kann. Natürlich wäre eine solche Form des Wirtschaftens der Wegwerfökonomie vorzuziehen. Stattdessen bekommen wir bestenfalls das ein bisschen Richtigere im Falschen: Kaffee zu einem Preis, der den Bäuer:innen zum Leben reicht, zum Leben in Armut wohlgemerkt. Und der Kaffee kommt natürlich weiterhin aus Übersee. Ein klein wenig weniger Leid, Zerstörung in Maßen, ein bisschen Frieden.
Wir haben den Planeten kaputt konsumiert, jetzt sollen wir ihn wieder heile konsumieren. Dieser an die Kundschaft gerichteten Forderung lässt sich aber nicht nachkommen, solange nicht auch die Hersteller in die Pflicht genommen werden. Wenn den Konsumierenden ihr Verhalten nicht mehr nachgesehen wird, dann darf es den Produzierenden erst recht nicht nachgesehen werden. Wie sollen wir das Richtige tun mit den falschen Produkten? Denn leider werden die Dinge nicht nur nicht kontinuierlich besser – sie werden nie besser, als sie unbedingt sein müssen. Und zu oft sind sie absichtlich schlechter als das.
Der kapitalistischen Orthodoxie folgend, müssten als schlecht erkannte Produkte eigentlich von besseren An18geboten umzingelt und schließlich niedergerungen werden. Mehrere Faktoren verhindern diese Selbstkorrektur jedoch: die Digitalisierung ganzer Produktkategorien (die Unternehmen, Kundschaft und Regulierungsbehörden überfordert), die Marktkonsolidierung (die Konkurrenz reduziert), die Verschiebung weg vom Wettbewerb der Produkte hin zum Wettbewerb der »Markenwelten« oder »Ökosysteme«; neue Vertriebswege, die Vergleichbarkeit erschweren (Markenshops statt Fachhandel, Onlineversandhändler mitsamt intransparenten und oft unbrauchbaren Bewertungen), und das durch diese neuen Kanäle veränderte Einkaufsverhalten, das zum Bedeutungsverlust des Fachhandels überhaupt erst geführt hat. Da die Informationsasymmetrie zwischen dem Hersteller auf der einen und der Kundschaft auf der anderen Seite riesig ist, wäre ein zwischen den beiden Seiten vermittelnder Fachhandel eigentlich wichtiger denn je. Tatsächlich finden wir fast nur noch große Ketten vor mit schnell fluktuierendem Personal, dessen Fachkenntnis man durch einfaches Googeln toppen kann. Aber warum sollte man Aufpreise für den stationären Handel zahlen, wenn dessen Beratung auch nicht besser ist als zusammengesuchte Infoschnipsel aus dem Netz?
Das Dumme mit der kapitalistischen Orthodoxie ist, dass sie einen kategorialen Webfehler enthält: Ein gutes Produkt für die Kundschaft kann ein schlechtes Produkt für den Produzenten sein.
Zur Verkrempelung der Welt trägt ein Wettbewerb bei, der oft genug nur noch eine Scheinveranstaltung ist (siehe Kapitel 2); sie ist das Ergebnis eines einseitig von Unternehmen bestimmten Diskurses über Fortschritt und Innovation (Kapitel 3). Unternehmen verkaufen fragwürdige Produkte an eine Kundschaft, die durch eine Arena aus 19glitzernden Quatschinnovationen geführt wird (Kapitel 7), während sie gleichzeitig von der Politik zum moralischen Konsum angehalten ist, mit keinem geringeren Ziel, als den Planeten zu retten. Nationale Vertriebsapparate verhindern, dass internationale Vergleichbarkeit von Waren überhaupt hergestellt werden kann, so dass wir oft nur Produkte bekommen, die wir – gerade noch – akzeptieren (Kapitel 8). Und während wir uns von Telefonrobotern in der Warteschleife versichern lassen, wie wichtig ihnen unser Anruf ist (Kapitel 9), werden wir von wichtigtuerischen Apps mit Pfuschnachrichten oder von Schubert spielenden Waschmaschinen behelligt, auf dass unsere verbliebene Aufmerksamkeit auch noch frittiert werde (Kapitel 6).
Die Kritik an den Dingen des Alltags ist nicht neu. Und die Strategien, um die Verkrempelung der Welt irgendwie einzuhegen, sind es auch nicht. So regte der Deutsche Werkbund schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine heute unvorstellbare Zusammenarbeit von Industrie und Kunstschaffenden an, um bessere Waren hervorzubringen. Davon ist aber nicht viel übrig geblieben (Kapitel 5). Und leider krempeln wir, die Kundschaft, eifrig mit, wenn wir ohne Not Neues kaufen und uns ob der besonderen Nachhaltigkeit dieser Waren auf die Schulter klopfen (Kapitel 4). Wenn es nicht so unangenehm wäre, wenn es nicht an unsere Identität ginge, könnte man fast Zweifel bekommen an der Authentizität – und womöglich sogar Legitimität – all unserer Bedürfnisse, deren Befriedigung überhaupt erst zur Verkrempelung der Welt geführt hat (Kapitel 10).
Der Herd mit der absurden Bedienung stammt übrigens von AEG, das steht zumindest drauf. Ich weiß nicht, wie 20viele Verbraucher:innen wissen, dass die Marke nichts mehr mit dem altehrwürdigen Unternehmen zu tun hat, das Emil Rathenau (der Vater des 1922 ermordeten Industriellen und Politikers Walther Rathenau) Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin gegründet hat. Die Nutzungsrechte an der Marke werden heute von der Electrolux Global Brand Licensing an unzählige Hersteller lizenziert, die damit ganz unterschiedliche Geräte verkaufen. Damit ist der Sinn und Zweck einer Marke eigentlich hinfällig, nämlich verlässlich anzuzeigen, von wem eine Ware stammt, damit in der Kundenbeziehung wirklich etwas auf dem Spiel steht: der gute Ruf des Produzenten. Die Marke war mal ein Versprechen, auf das sich die Kundschaft verlassen konnte, sei es bei der Qualität der Ware selbst, beim Kundendienst oder bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
Nun kann man offenkundig auch ohne hundertjährige Firmengeschichte Herde und Waschmaschinen herstellen. Aber etwas Verlockendes muss an diesen alten Marken dran sein, sonst würden sie nicht wild durch die Gegend verkauft. Es ist ein Verblendungszusammenhang, in den sich Industrie und Kundschaft eingesponnen haben: Die Hersteller erzählen uns nostalgische Markenmärchen, und genug Menschen müssen sie aus Mangel an Alternativen glauben. Zudem gaukeln die vielen verschiedenen Marken eine Wahlfreiheit vor, die gar nicht existiert. Wenige Anbieter stellen fast identische Produkte her, die mit unterschiedlichen Logos versehen werden, und in vielen Kategorien dominieren Oligopole den Markt. Ein Wettbewerb findet oft nur scheinbar statt, es ist wie beim Wrestling: Das Gekloppe ist gut abgesprochen, und der Sieger steht schon vorher fest. Wer Küchengeräte von Bosch, Neff, Siemens, Constructa oder Gaggenau erwirbt, hat am En21de immer bei der BSH Hausgeräte GmbH gekauft. Bauknecht und Privileg gehören Whirlpool; AEG und Zanussi Electrolux.
Volkswagen betreibt das Spiel mit den Marken VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat und Cupra. »Gleichteilestrategie«, »Konzernbaukasten«, »Plattformstrategie« – es gibt viele Begriffe dafür, die gleichen Dinge unterschiedlichen Kunden zu unterschiedlichen Preisen zu verkaufen. Wenn in einem Luxusauto auf den Lautsprechern das Logo von Bang & Olufsen prangt, kommen sie in Wirklichkeit von der Firma Harman, die wiederum Samsung gehört (genau wie die Audiomarken AKG und JBL). Die Fortschrittsperformance, die so tut, als ginge es voran, wird begleitet von einer Wettbewerbsperformance, die so tut, als hätte man eine Wahl. Das Unfassbare an Märkten, die sich an Endverbraucher:innen richten, ist das Scharadenhafte, bei dem alle so tun als ob – während der Planet ganz real abbrennt.
Die Idee der freien Konsumentscheidung ist dennoch strategisch wichtig, denn mit ihr lässt sich der moralische Ballast des richtigen Verhaltens auf den einzelnen Konsumierenden abladen: Nicht die Industrie, die die schlimmen Dinge anbietet, trägt die Verantwortung für ihre Existenz, sondern die Kundschaft, die die schlimmen Dinge will.
Der britische Soziologe Don Slater schrieb 1997, dass ab den 1980er Jahren der consumer in den Industrienationen zum »hero of the hour« stilisiert wurde. Das Wirtschaftswachstum werde durch seine Ausgaben und Kreditaufnahmen garantiert; politische Entscheidungen (etwa im Thatcherismus) hielten Kundinnen und Kunden, imaginiert als radikale Individualisten, alle Möglichkeiten zum Konsum offen.11
22Aber wie es schon bei Spider-Man heißt: »Aus großer Macht folgt große Verantwortung.« Wenn wir die Heldinnen und Helden der Stunde sein sollen, müssten wir uns dann nicht umso verantwortungsbewusster verhalten? Perverserweise ist es für den sorglosen Einkauf jedoch entscheidend, sich eben nicht als Teil einer (Welt-)Gemeinschaft zu begreifen, sondern im Sinn individueller Bedürfnisbefriedigung zu handeln. Und mit dem Gefühl, als Einzelperson eh nichts ausrichten zu können, konsumiert es sich auch gleich viel leichter. Der Designer Jonas Stallmeister folgerte aus dem berühmten Zitat spekulativ: »Aus Ohnmacht folgt Verantwortungslosigkeit?«12
Ein Ausgangspunkt für dieses Buch war die Annahme, dass wir als Konsumierende befähigt werden müssten, gute Produkte als solche zu erkennen und Krempel zurückzuweisen, mit einer Neuinterpretation der alten Disziplin der Warenkunde. Tatsächlich ist der Frage des »richtigen« Konsums aber mit schlichten Produktempfehlungen nicht beizukommen. Der Konsum ist viel mehr als die Anschaffung der »richtigen« Waren. Er ist einer der großen Schauplätze, auf denen sich der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft abspielt. Wenn ich Butter kaufe oder einen pflanzlichen Brotaufstrich, wenn ich ein Deutschlandticket kaufe oder ein Auto finanziere, treffe ich individuelle Entscheidungen, aber ich treffe sie nicht im Vakuum. Butter schmeckt mir deutlich besser als das beste Ersatzprodukt, aber Großmolkereien produzieren neben Milch auch erschreckend viel CO2. Mit dem Auto kann ich schnell mal raus an einen See fahren oder sperrige Dinge transportieren, aber massenhafter Autobesitz bedeutet noch mehr CO2