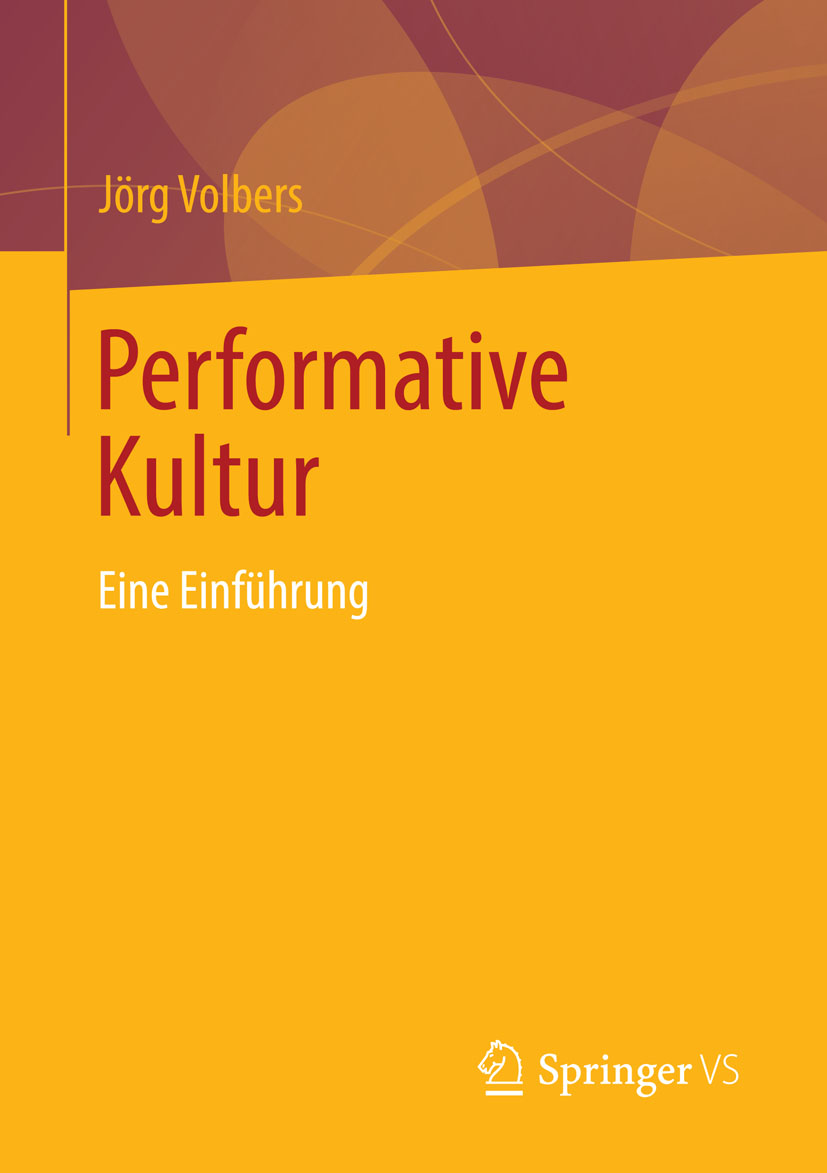Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Die moderne Philosophie steht im Schatten des Skeptizismus: Alle Wissensansprüche scheinen fallibel, alle Theorien nur vorläufig, alle Gewissheiten nur temporär zu sein. In dieser gespannten Situation ist die Versuchung groß, das Wesen des vernünftigen Denkens in der Form zu suchen. Vernunft gilt dann als ein Vermögen allgemeiner Art, das bei wechselnden Inhalten seine kritische Kompetenz bewahrt. Doch solche Formalismen müssen scheitern: Wer Erfahrung nur als »Wahrnehmung« oder »Gehalt« adressiert, übergeht die dynamische und überschreitende Natur alles Erfahrens, ohne die Denken und Wissen nicht zu haben sind. Der Autor zeigt in dieser Studie, dass der Pragmatismus von Peirce und Dewey als eine Philosophie der Erfahrung gelesen werden muss, die eine effektive Kritik der formalen Vernunft formuliert. Dabei bettet er diese Philosophie in den weiteren Kontext der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts ein, in dem der Logische Empirismus und die postanalytische Philosophie auf die dynamische Natur des Wissens reflektieren. Die Frage nach der Erfahrung, so zeigt sich, ist selbst eine Reflexion auf die geschichtliche Erfahrung einer kontingenten Moderne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Volbers
Die Vernunft der Erfahrung
Eine pragmatistische Kritikder Rationalität
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
ISBN (ePub): 978-3-7873-3330-1ISBN (PDF): 978-3-7873-3327-1
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2018. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbHFür Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
Einleitung
Autonomie und Moderne
Formale Vernunft: Der Erfahrungsbegriff des Wiener Kreises
Kritik der formalistischen Erfahrung
Rehabilitierung der Objektivität
Zwischenreflexion: Der Ort der Philosophie
Die pragmatistische Transformation der Erfahrung
Die Möglichkeit der Autonomie
Siglenverzeichnis
Literatur
Personenregister
Sachregister
Einleitung
»Wissenschaft aber und Kunst gehen für den Menschen aus der Erfahrung hervor.«
Aristoteles
§ 1 Die vorliegende Untersuchung verteidigt die moderne These, dass wir die menschliche Vernunft als die Fähigkeit zur Kritik verstehen können. Dieser Zusammenhang von Kritik und Vernunft kann auf mindestens zwei Weisen konzipiert werden. Eine Möglichkeit ist, die kritische Fähigkeit der Vernunft als ein spezifisch rationales Vermögen zu erläutern. In dieser Perspektive steht das kritische Denken dem Menschen als gegebenes Potenzial zur Verfügung, und es kommt philosophisch vor allem darauf an, dieses Potenzial reflexiv zu identifizieren. Diese Untersuchung nimmt einen anderen Standpunkt ein. Sie argumentiert, dass die kritisch zu verstehende Vernunft sich nur durch Erfahrung konstituiert – durch konkret situierte, praktisch und körperlich vermittelte Erfahrungsprozesse. Die Erfahrung kann damit nicht als ein bloßer Gegenstand einer kritisch zugreifenden Vernunft verstanden werden. Sie ist als die praktische Form selbst zu verstehen, in der allein Kritik sich verwirklicht. Erst in dieser Perspektive, so die hier entwickelte Argumentation, kann die moderne These Fuß fassen, dass die menschliche Vernunft als eine kritische Vernunft verstanden werden sollte.
Das Thema der Kritik ist ein ständiger Topos der modernen Philosophie. Angefangen mit Kants Behauptung, »das eigentliche Zeitalter der Kritik« (KrV A, 9) sei angebrochen, bis hin zu Latours (Latour 2004) skeptischer Zeitdiagnose, die Wertschätzung der Kritik sei umgeschlagen in eine selbstreferentielle Kultur des Hinterfragens, spielt die Frage nach der Natur und der Legitimation von Kritik immer wieder eine zentrale Rolle in der philosophischen Selbstverständigung.1 Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Kritik so stark diskutiert wird, liegt in ihrer Verbindung zu dem ebenso modernen Leitthema der Autonomie. Kritik ist so relevant, weil sie die Möglichkeit einer selbstständigen Stellungnahme verspricht, in der die Vernunft allein darüber bestimmt, ob ein Urteil gerechtfertigt ist oder nicht. Vernunft in diesem kritischen Sinne ist nur sich selbst verpflichtet, ihrem eigenen Gesetz, und nicht etwa einer äußeren Autorität oder dem Wunschdenken.
Hier wird die Position vertreten, dass das moderne Interesse an der Kritik sich aus der Tatsache erklärt, dass die recht verstandene Kritik sachgebunden ist. Bei aller Kritik an der Kritik steht sie für das Versprechen, der Sache selbst ihr Eigenrecht zu lassen. Auch dieser Gedanke findet sich bereits bei Kant, dessen Kritik der Vernunft ja die Kritik einer Metaphysik ist, die keine kontrollierbare Sachbindung mehr kennt und daher in ein »bloßes Herumtappen« verfällt. Diese Kritik ist eine Selbstkritik und damit die Ausübung der Autonomie zum Zwecke der stärkeren Sachbindung des Denkens. Eben dieser Zusammenhang wird durch den Fokus auf den Erfahrungsbezug des Denkens sichtbar. Kritik ist nicht das beliebige Spiel von Meinung und Gegenmeinung, noch spricht sich in der Vernunft die Autorität einer allzu selbstsicheren Aufklärung aus, die letztlich alles, was ihr nicht ähnlich sieht, blindwütig unterdrückt und verwirft.
Die hier eingenommene Position sucht also einen Kurs zwischen der Skylla einer nur noch selbstrefenziellen Postmoderne (Rorty 1979) und der Charybdis einer allzu negativen Dialektik der Aufklärung (Adorno 1966). Die kritische Vernunft muss, so die These, als eine in der Praxis durch die Erfahrung konstituierte Form der gebundenen Freiheit verstanden werden: Gelingende Kritik befähigt dazu, sowohl die Möglichkeiten als auch die Zwänge zu begreifen, die für den je gegenwärtigen Spielraum des Denkens und Handelns von Relevanz sind. Diese gebundene Freiheit ist eine Vernunft der Erfahrung, insofern sie sich der Erfahrung nicht entgegengesetzt, sondern im Gegenteil auf sie verwiesen bleibt. Kritik muss, ja darf sich nicht von der Erfahrung isolieren, um sich als autonom zu begreifen. Die kritische Selbstbestimmung des Denkens, seine Autonomie, ist nur durch Erfahrung möglich und wirklich.
§ 2 Damit ist die hier eingenommene Position grob umrissen. Die vorliegende Untersuchung entwickelt dieses Verständnis der kritischen Vernunft, indem sie nacheinander fünf philosophische Positionen des 19. und 20. Jahrhunderts sichtet: Den Logischen Empirismus Carnaps, die postanalytischen Empirismuskritiken von Davidson und McDowell sowie die Erfahrungskonzeptionen der Pragmatisten Peirce und Dewey. Alle fünf nehmen Stellung zu der Frage, wie das Verhältnis von Vernunft und Erfahrung bestimmt werden muss. Sie alle verstehen ihre Position als eine Artikulation und Anerkennung der modernen Idee, dass Erfahrung zur Kritik befähigt. Der Erfahrungsbezug ist somit der rote Faden, der die Diskussion dieser Positionen miteinander verbindet und es erlaubt, sie auch systematisch aufeinander zu beziehen.
Deweys pragmatistische Philosophie der Erfahrung ist nicht nur das Ende, sondern auch der vorläufige Abschlusspunkt dieser Untersuchung. Dewey konzipiert Kritik konsequent als eine praktische Form der gebundenen Freiheit, als die situierte und erfahrungsgeleitete Praxis der inquiry (dt. »Untersuchung«). Seine Position entspricht somit dem, was hier als systematisches Desiderat einer Erläuterung der Kritik vorgestellt wurde: Für Dewey gewinnen wir Autonomie nur in der Praxis durch Erfahrung.
Doch es geht in dieser Untersuchung nicht primär darum, Deweys Verständnis der Kritik als Erfahrung zu entwickeln. Dazu hätte es ausgereicht, sich nur mit Dewey zu beschäftigen. In der hier entworfenen Konstellation wird Deweys Position erkennbar als eine mögliche Antwort auf eine allgemeine moderne Problemlage, die weit über den Pragmatismus hinausgeht. Durch die differenzierenden Bezüge auf andere mögliche Positionierungen wird Deweys Philosophie der Erfahrung nicht einfach als eine sachlich angemessene Position hingestellt, sondern an der Sache selbst gemessen. Die historische Breite der hier vorgenommenen Untersuchung – mit Autoren von 1870 bis zur Gegenwart – lässt verständlich werden, dass die hier in den Blick genommenen Positionen gemeinsame Antworten auf eine geteilte Problemwahrnehmung sind. Ein Problem, das sich nicht nur linear in der Entwicklung einer philosophischen Tradition entfaltete (wie etwa der analytischen Philosophie), sondern über die jeweiligen Traditionszusammenhänge hinaus geht und sie verbindet. Die Vielfalt der gegebenen Antworten und ihrer systematischen Bezüge untereinander lässt deutlich werden, dass die hier behandelten Autoren sich alle – auf je eigene Weise, und mit jeweils guten Gründen und Argumenten – mit dem Problem beschäftigen, das hier im Vordergrund steht: Das moderne Problem der Kritik.
§ 3 Zwei Ergebnisse dieser detaillierten Diskussion sollen hier, zum Zwecke der Einleitung, vorausgeschickt werden. Sie helfen die interne Gliederung dieser Studie nachzuvollziehen, also die systematischen Beziehungen, die die hier verhandelten Autoren untereinander einnehmen. Die erste wichtige begriffliche Unterscheidung, die in dieser Untersuchung vorgenommen wird, ist die Gegenüberstellung eines formalistischen Ansatzes zur Erläuterung des Verhältnisses von Autonomie und Erfahrung und seiner postformalistischen Kritik. Dieser Unterschied beschreibt das Verhältnis zwischen der ersten detailliert untersuchten Position, dem Logischen Empirismus, zu den restlichen Autoren, ob nun postanalytisch oder pragmatistisch: Während der Logische Empirismus das Denken formalistisch beschreibt, vertreten die anderen Autoren die Auffassung, dass mit einem Formalismus die kritische Autonomie gerade nicht zu fassen ist.
Der Begriff des Formalismus dient dabei zunächst nur einer Charakterisierung des Logischen Empirismus’ von Rudolf Carnap. Dessen Position hat in der vorliegenden Untersuchung die Funktion, exemplarisch aufzuzeigen, wie das Kritik ermöglichende Verhältnis von Autonomie und Erfahrung nicht konzipiert werden kann: Der Logische Empirismus, so die hier vertretene These, missversteht die notwendige Verbindung von Kritik und Erfahrung auf eine charakteristische Weise. Für ihn ist die Erfahrung immer nur ein Gegenstand rationaler Bezugnahmen, der dem Denken zur weiteren Reflexion gegeben ist. Obgleich der Logische Empirismus sich von dem Subjektbegriff des klassischen britischen Empirismus verabschiedet hat und die wissenschaftliche Vernunft als eine intersubjektive sprachliche Praxis konzipiert, hat er strukturell das gleiche Erfahrungsverständnis. Die Wissenschaft, wie sie der Wiener Kreis konzipiert, bedient sich der Erfahrung und bleibt damit immer auf Distanz zu ihr, was schließlich zwangsläufig in den Skeptizismus mündet. Anders gesagt: Erfahrung bleibt hier ein lediglich kontingentes Moment einer formalistisch abstrakten Vernunft. Dieser formalistisch zugespitzte Empirismus ist der Kontrapunkt, von dem sich alle anderen hier diskutierten Positionen – von Davidson bis zu Dewey – kritisch absetzen.
Carnaps Formalismus lässt das hier verhandelte Problem in aller Deutlichkeit zu Tage treten: Für ihn sind die logischen Beziehungen des Denkens reine Strukturbeziehungen, die für sich genommen keinen konstitutiven Bezug zur Wirklichkeit aufweisen müssen. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wird für ihn im Medium der formalen Logik realisiert, in Form von objektiv definierbaren Theoriesprachen und Strukturbeschreibungen, die in der intersubjektiven Praxis der Wissenschaft vorgeschlagen und reflektiert werden können. Die Logik ist für Carnap das eigentliche Versuchsfeld der Wissenschaft, auf dem unterschiedliche Strukturen entworfen werden können, die sich dann erst in der konkreten Konfrontation mit der Erfahrung (durch Protokollsätze) bewähren. Dieser Formalismus ist somit deutlich identifizierbar als eine ebenso moderne wie problematische Artikulation der Kritik: Die konsequente Trennung von formaler Logik und empirischem Inhalt soll gleichermaßen die Freiheit der rationalen Selbstbestimmung wahren wie auch die kritische Bindung durch die Erfahrung verteidigen.
Carnaps Formalismus scheitert, wie ich zeigen werde, auf mehreren Ebenen: Als Beschreibung der Wissenschaft ist er zu theorielastig und als Beschreibung der Autonomie führt er in den Skeptizismus. Der Logische Empirismus hat also ein Problem mit der doch eigentlich von ihm offensiv behaupteten Sachbindung der wissenschaftlichen Vernunft. Dieses Problem verdichtet sich – und das lässt den Wiener Kreis zu einem so guten Ausgangspunkt für die weitere Diskussion werden – im Erfahrungsbegriff. Der Formalismus kann nicht erläutern, wie die objektiv »gegebene« Erfahrung verbindlich für das Erkennen sein kann und dabei dem Denken die Möglichkeit belässt, sich kritisch auch von der angemaßten Autorität der Erfahrung zu distanzieren. Auf diese Weise lässt der Formalismus erkennbar werden, dass im Namen der Kritik zwei konfligierende Forderungen an die Erfahrung herangetragen werden: Die Erfahrung soll das Denken verbindlich leiten und ihm zugleich doch die Distanz gewähren, ohne die es sich nicht als eine kritische Rationalität verstehen kann. Am Formalismus wird damit gerade der Konflikt erkennbar (und artikulierbar), der die ganze weitere Diskussion bestimmt: Der Konflikt zwischen der Autonomie des Denkens und der gleichzeitig erforderlichen Sachbindung durch die Erfahrung.
§ 4 Dieser vom Formalismus aufgeworfene, aber nicht gelöste Konflikt zwischen Autonomie und Erfahrung ist das Leitmotiv der weiteren Diskussion. Alle weiteren besprochenen Positionen sind Versuche, zu diesem Konflikt Stellung zu nehmen. Mit dieser Feststellung kommen wir zu der zweiten zentralen begrifflichen Unterscheidung, die diese Studie strukturiert: die Frage, ob dieser Konflikt als ein Problem wahrgenommen wird, das gelöst werden muss, oder aber als ein Konflikt, den eine Theorie der kritischen Vernunft anerkennen sollte. Während die hier verhandelten postanalytischen und pragmatistischen Autoren zwar unter dem Banner des Postformalismus vereint werden können, wird durch den Blick auf den Erfahrungsbegriff ein maßgeblicher Unterschied zwischen ihren Ansätzen sichtbar. Summarisch formuliert: Während die postanalytische Philosophie, der Tradition des Logischen Empirismus folgend, die Erfahrung weiterhin als einen Gegenstand des Denkens thematisiert, begreift der klassische Pragmatismus den Konflikt zwischen Autonomie und Erfahrung als einen praktischen Konflikt in der Erfahrung selbst.
Die postanalytische Philosophie orientiert sich an einem, wie ich es nennen möchte, deklarativen Erfahrungsbegriff. Die Erfahrung wird an dem Paradigma des Zeigens thematisiert. Erfahrung ist danach das, worauf wir – zum Beispiel in Diskussionen oder Experimenten – hinweisen können. Ein Indiz für ein deklaratives Erfahrungsverständnis ist, wenn die Diskussion sich immer an konstativen Sätzen der Form »das ist rot« oder »dieser Würfel« orientiert. Das ist der Sinn der »Deklaration«: Es geht darum, den rationalen Gehalt dieser Erfahrungen festzulegen, so wie auf einem Paket deklariert wird, was in ihm steckt. Der Logische Empirismus hat diese Richtung vorgegeben, indem er alle für die Kritik relevante Erfahrung auf »Protokollsätze« beschränkte; doch auch noch McDowells formalismuskritische Philosophie orientiert sich, wie ich in dem entsprechenden Kapitel zeige, weiterhin an diesem deklarativen Grundverständnis.
Das schwerwiegende Problem dieser deklarativen Erfahrungskonzeption ist, dass sie die zeitliche Dynamik der Kritik nicht zu erläutern vermag. Sie thematisiert Erfahrungsurteile immer nur als Einzelereignisse. Diese Einschränkung erzeugt eine systematische Blindheit: Der deklarative Ansatz kann erläutern, wie wir im Urteil die Erfahrung bestimmen, aber nicht, wie die Erfahrung uns – also das Denken – bestimmt. Dadurch aber wird die behauptete Sachbindung durch die Erfahrung immer noch zu einseitig gefasst. Solange die Erfahrung als ein passives Ereignis vorgestellt wird, dessen Gehalt »deklariert« wird, ist der Formalismus noch nicht wirklich überwunden.
Dieses Problem wird greifbar durch den Kontrast mit dem Verständnis der Erfahrung, das der klassische Pragmatismus als Gegenvorschlag unterbreitet. Der pragmatistische Ausgangspunkt zur Erläuterung des rationalen Weltbezugs ist nicht der zu deklarierende Erfahrungsgehalt, sondern die Erfahrung, die wir nicht verstehen. Was Peirce »irritation of doubt« und Dewey »indeterminate situation« nennt, sind Erfahrungen, auf die sich eben gerade nicht erklärend hinweisen lässt. Sie sind vielmehr in ihrem Gehalt immer erst unbestimmt, es kann noch nichts deklariert werden. Gerade in dieser Unbestimmtheit findet der Pragmatismus aber die konstitutive Verschränkung von Autonomie und Erfahrung: Die Unbestimmtheit der Erfahrung lässt sie überhaupt erst zu einem Problem werden, so dass die kritische Reflexion, die sich des Problems annimmt, von vornherein mit ihr verbunden ist.
Die pragmatistische Erläuterung der Vernunft setzt also nicht bei einer Konfrontation der Vernunft mit der Erfahrung an, sondern bei der Praxis, durch die diese unbestimmte Erfahrung erst eine sinnhafte Gestalt gewinnt. Das ist die Praxis der inquiry. Die pragmatistische Kernthese ist, dass diese Praxis sich sachlich zu binden vermag, wenn sie sich der als unbestimmt erfahrenen konkreten Situation zuwendet und von ihr affizieren lässt. Die Praxis der inquiry ist eine Praxis der Artikulation der Erfahrung, die dann gelingt, wenn sie die problematische Erfahrung in ihre Praxis mit einbezieht, anstatt nur über sie zu urteilen.2
Anschaulich greifbar wird dieses pragmatistische Grundverständnis in der wissenschaftlichen Praxis des Experiments. Das Experiment wird von Peirce und Dewey als eine Praxis der bewussten Manipulation von Erfahrungen verstanden. Diese Praxis vermag das Verständnis des Gegenstands zu erweitern, indem sie neue und womöglich überraschende Zusammenhänge in der Erfahrung – etwa durch den Einsatz von Instrumenten – provoziert. Denken wird in dieser pragmatistischen Perspektive somit nicht als eine rein kognitive Operation begriffen, sondern als ein Eingriff in die irritierende Situation selbst, als eine Veränderung der Erfahrung durch die konkrete Praxis der inquiry.
Damit markiert der pragmatistische Gegenbegriff zum deklarativen Verständnis der Erfahrung ein transformatives Verständnis der Erfahrung. Der Konflikt zwischen den beiden Forderungen an die Erfahrung, deren Unvereinbarkeit der Formalismus so klar bloßlegt, wird in dieser pragmatistischen Perspektive in der initialen Erfahrung der Unbestimmtheit selbst verortet. Anders als im Formalismus und bei den hier behandelten postanalytischen Philosophen fordert der klassische Pragmatismus nicht dazu auf, diesen Konflikt aufzulösen, sondern begreift ihn als das eigentlich kontrollierende Moment der sachgebundenen Praxis der Kritik
§ 5 Mit dem Kontrast zwischen dem deklarativen und dem transformativen Erfahrungsbegriff ist die zentrale These und das Ergebnis dieser Untersuchung benannt: Erst die Anerkennung, dass der Konflikt zwischen Autonomie und Erfahrung einen konstitutiven Teil der Erfahrung darstellt, ebnet den Weg zu einer angemessenen Artikulation der Kritik. Denken und Erfahrung sind in der Erfahrung konflikthaft aufeinander bezogen. Der Pragmatismus beschreibt diesen Zusammenhang mit der These, dass Ideen, Vorstellungen und sprachliche Bedeutungen einen irreduzibel antizipativen Charakter haben. Eine Überzeugung zu haben, heißt demnach, bestimmte praktische Konsequenzen zu erwarten. Erfahrung ist, dass sich diese Erwartungen nicht, oder nicht in der Form, erfüllen. In der hier eingenommenen Perspektive wird deutlich, dass diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfüllung rationalitätstheoretisch zu lesen ist. Der pragmatistische Hinweis auf die Spannung von Erwartung und Erfüllung soll uns nicht dazu ermuntern, bessere Erwartungen zu fassen.3 Im Gegenteil ist es gerade diese Diskrepanz, die uns erst zu denken erlaubt. Sie drückt eine Spannung aus, die konstitutiv ist für denkende, und d. h. hier: sich in der Erfahrung orientierende Wesen.
Um diese Neuperspektivierung der Kritik konsequent zu artikulieren, ist es erforderlich, über die vom Formalismus gezogenen thematischen Grenzen hinauszugehen. Das ist eine weitere zentrale Einsicht der vorliegenden Untersuchung: Die postformalistische Kritik am Erfahrungsbegriff weist über sich selbst als philosophisches Thema hinaus. Um den Konflikt von Autonomie und Erfahrung angemessen zu verstehen, greift die vorliegende Untersuchung immer weiter aus. Die anfängliche thematische Engziehung des Wiener Kreises, Kritik nur als ein Problem der »wissenschaftlichen Vernunft« zu sehen, weicht einer zunehmenden Kontextualisierung. Nicht nur die Praxis der Vernunft muss als eine situierte Praxis verstanden werden – auch das Problem der Kritik, das zu der Reflexion auf diese Praxis auffordert, erweist sich als ein situiertes Problem.
Von besonderer Bedeutung ist das vom Formalismus völlig ausgeblendete moderne Naturverhältnis. Es erweist sich als eine maßgebliche Voraussetzung für das moderne Problem der Kritik. Daher rücken mit McDowell und Dewey auch zwei formalismuskritische Philosophien in den Blick, die ihre Rekonfiguration der Erfahrung mit einer Kritik des modernen Naturbildes verbinden. Sie richten sich gegen das Verständnis der Natur als ein »entzaubertes« Reich objektiver Verhältnisse, in dem Bedeutungen und Werte keinen Platz finden (Daston 2014). Hier zeigt sich eine thematische Parallele zwischen dieser naturalistischen »Entzauberung« der Welt und der Leitfrage, wie objektive Erfahrungen das Denken normativ zu binden vermögen. In beiden Kontexten scheint Bedeutung nur durch Zuschreibung möglich zu sein, durch eine Projektion auf ein für sich genommen normativ unempfängliches Material.
Beide Autoren, Dewey und McDowell, verbinden ihre Formalismuskritik daher mit einem revidierten Naturalismus, der verständlich werden lassen soll, wie die Vernunft als ein Teil der Natur begriffen werden kann und nicht als ihr Gegenüber. Die Dominanz des hier thematischen Leitkonflikts von Autonomie und Erfahrung zeigt sich dann auch daran, dass diese beiden Autoren ihren revidierten Naturalismus jeweils ganz anders anlegen. Während McDowell sich am aristotelischen Ideal einer konstitutiven Einheit von Natur und Vernunft orientiert, entwirft Dewey das lebendige Naturverhältnis, unter Rückgriff auf Darwin, als grundsätzlich konfliktbehaftet (Särkelä 2015). Wieder lässt sich die gegensätzliche Tendenz beobachten, den Konflikt zwischen Autonomie und Erfahrung entweder philosophisch zu lösen (oder aufzulösen) – oder aber ihn zu einem konstitutiven Moment des menschlichen Lebens, ja in Deweys Fall sogar der lebendigen Natur überhaupt, zu erklären.4
1 Zur Begriffsgeschichte von »Kritik« vgl. immer noch: Röttgers 1975.
2 Die artikulativ-transformative Auffassung der inquiry ist nicht zu verwechseln mit Brandoms (1994) neopragmatistischer Strategie, bereits logisch wirksame Normen zu explizieren. Das Resultat der inquiry legt keinen verborgenen Gehalt der Erfahrung frei, sondern nimmt, in gebundener Freiheit, Stellung zu ihr. In der inquiry verändert sich sowohl das Bezugsobjekt als auch das Subjekt der Stellungnahme.
3 Hier zeigt sich eine Differenz zwischen Peirce und Dewey, die ich im vorletzten Kapitel ausführlich erläutere. Peirce konzipiert die Praxis der inquiry immer noch empiristisch, insofern er der Wissenschaft das ideale Ziel unterlegt, im unendlichen Forschungsprozess auf eine »ultimate opinion« zu konvergieren – was nichts anderes hieße, als die Diskrepanz von Erwartung und Erfüllung aufzulösen. Obgleich Peirce dieses Ziel als ein Ideal (und dann sogar nur noch als eine Hoffnung) markiert, widerspricht es seiner eigenen rationalitätstheoretischen Einsicht in die intrinsische Spannung von Denken und Erfahrung.
4 Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung einer Habilitationsschrift, die dem Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt wurde. Ich danke diesem Fachbereich sowie allen Kollegen am Institut für Philosophie, die mich in der langjährigen Forschung zu diesem Thema unterstützt und gefördert haben. Auch danke ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung dieses Projektes und dem Meiner Verlag für das freundliche Lektorat. Besonderer Dank geht, in alphabetischer Reihenfolge, an Andreas Antić, Georg Bertram, Fabian Börchers, Maria Buzhor, Stefan Deines, Daniel-Martin Feige, Roberto Frega, Stefan Gosepath, Michael Hampe, Mark Halawa-Sarholz, Hilge Landweer, Jan Müller, Andrew Norris, Dorothea Katharina Ritter, Jan Slaby und Christian Straub. Nicht zuletzt sei Stefanie Volbers & der quirligen Berliner crew gedankt, für so Vieles und noch viel mehr.
Autonomie und Moderne
Die Modernität der kritischen Vernunft
§ 6 Das philosophische Interesse dieser Untersuchung gilt der Frage, wie der Begriff der Erfahrung konzipiert sein sollte, wenn wir die Vernunft als wesentlich kritisch begreifen. Zu diesem Zweck werden drei historische philosophische Positionen näher in den Blick genommen: Die postanalytische Philosophie, der Pragmatismus und der Wiener Kreis. In diesem Kapitel soll der wichtigste Grund für diese Auswahl näher beleuchtet und reflektiert werden. Diese drei Positionen, so lautet die hier zu diskutierende Rechtfertigung für ihre Gegenüberstellung, sind genuin modern, und das in einem sowohl historischen als auch systematischen Sinne.
Modern sind die hier diskutierten Autoren zum einen als Zeitgenossen einer philosophischen (und kulturellen) Moderne, deren allgemeine Konturen, die auch heute noch bestimmend sind, sich im 19. und 20. Jahrhundert ausgebildet haben. Ihre Philosophien entstehen in Zeiten durchgreifender technologischer, gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen, die sie implizit und teils auch explizit reflektieren.5 Ihre Ansätze sind zweitens aber auch inhaltlich genuin modern, da sie ein zumindest im Grundsatz prinzipiell affirmatives Verhältnis zu dieser Moderne einnehmen. Alle drei begreifen Vernunft als wesentlich kritisch, und dies auch in dem weiteren Sinne, dass sie die moderne Wissenschaft als Paradigma einer solchen kritischen Vernunft ansehen. Das kritische Verständnis der Vernunft drückt sich vor allem in der Annahme aus, dass kein Urteil und keine Erkenntnis »immun« ist (wie es Quine ausdrückt) gegenüber dem Druck weiterer Erfahrung und neuer Urteile. Dieses Bild der Vernunft verkörpert sich – so der weitere gemeinsame Gedanke – paradigmatisch in der Praxis der Wissenschaften, die somit als beispielhaft kritisch gelten. Es lässt sich auf diese Weise eine historische und systematische thematische Leitlinie ziehen, die die europäische Moderne, die neuzeitliche Entstehung der erfahrungsorientierten Naturwissenschaften und die Vorstellung, Vernunft sei konstitutiv kritisch, miteinander verbindet.
Diese in vielerlei Hinsicht typisch moderne Konstellation, in der die hier diskutierten Texte stehen, kann jedoch nicht einfach ungefragt vorausgesetzt werden. Dies zunächst deshalb, weil die hier behaupteten Gemeinsamkeiten durchaus auch bestritten werden können. Wir werden uns im nächsten Teilkapitel daher der Frage widmen, wie weit die behauptete Modernität dieser Texte konkret reicht. Es gilt, das selbst charakteristisch moderne Missverständnis zurückzuweisen, wonach einige Texte nur deshalb, weil sie historisch weiter zurückliegen – was vor allem beim Pragmatismus der Fall ist –, im Grunde den Titel einer genuin modernen und kritischen Reflexion auf die Vernunft nicht verdienen. Es wird also darum gehen, den hier behaupteten Kern eines durchgängig modernen Selbstverständnisses, das Vernunft mit Kritik identifiziert, bei allen drei Positionen freizulegen. Sowohl in ihren internen Beziehungen zueinander als auch in ihren Stellungnahmen zur philosophischen Tradition wird dieser Kern bei den hier verhandelten Positionen sichtbar.
Viel wichtiger aber ist noch, diese geteilte Auffassung selbst auch historisch und kritisch zu reflektieren. Gerade mit Blick auf das Leitmotiv, dem zufolge sich diese kritische Vernunft exemplarisch in der Wissenschaft verkörpere, sind nämlich Zweifel anzumelden. Dabei sind die Indizien für dieses moderne Verständnis der Wissenschaft durchaus überzeugend. Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie die Wissenschaft immer wieder ihre eigenen Urteile und Annahmen revidiert hat und somit sich als ein im Kern kritisches Unternehmen ausweist. Phlogiston ist Geschichte, Newtons Gravitationstheorie ist relativiert worden und die Einheit von Quantentheorie und Relativitätstheorie steht noch aus. Das Wissen unterliegt einem ständigen Wandel. Dieser Wandel war immer schon das Grundprinzip aufgeklärter wissenschaftlicher Forschung, die diesem Verständnis nach ja gerade dadurch historisch Fuß gefasst hat, dass sie die tradierten aristotelischen und scholastischen Annahmen über Natur und Kosmos in ihrem Grundsatz revidierte. Die Neuzeit war demnach Zeugin einer »wissenschaftlichen Revolution« (Koyré), in deren Folge unser Welt- und Selbstverständnis gründlich erschüttert und neu justiert worden ist.
Dieses gängige Bild ist wichtig für unsere Untersuchung, denn es verbindet die behauptete kritische Potenz der Wissenschaft mit ihrer systematischen Rücksichtnahme auf die Erfahrung. Autoren wie Bacon, Locke oder Kant sahen die experimentelle Methode als das entscheidende Merkmal der kritischen Wissenschaft. Sie verleiht ihr demnach das bilderstürmerische Potenzial. Indem die Erfahrung als »Prüfstein« (Kant) des Wissens eingesetzt wird, können auch Tradition und eigener Irrglauben einer objektivierenden Prüfung unterzogen werden.
Gerade mit Blick auf die hier behandelten philosophischen Positionen wird jedoch deutlich, dass dieser Zusammenhang zwischen Erfahrung und Kritik nicht so einfach zu haben ist, wie es das verbreitete Bild will. Alle drei Positionen problematisieren diese Verbindung von Erfahrung und Kritik; sie befragen die Rolle, die Erfahrung für das kritische Moment des Denkens spielen kann. So hebt der Wiener Kreis hervor, dass Erfahrungen nur im Rahmen der Theorie sinnvoll interpretiert werden können, wodurch nur noch intersubjektiv logisch nachprüfbare Erfahrungen (ausgedrückt in Protokollsätzen) Gegenstand kritischen Denkens sind. Die nachklassische analytische Philosophie rückt im Anschluss das Problem ins Zentrum, wie Erfahrungen diese korrigierende Rolle überhaupt einnehmen können, ohne dabei in ihrer Funktion als unmittelbar gegebene Evidenz sich auch der theoretischen Korrektur zu entziehen (»Mythos des Gegebenen«). So zweifelt der postanalytische Philosoph Davidson schließlich daran, dass der Begriff der Erfahrung in seinem epistemischen Verständnis überhaupt noch sinnvoll verteidigt werden kann und plädiert für eine Abkehr von dieser langen Tradition. Ähnliche kritische Reflexionen finden sich bei den Pragmatisten. Sie verteidigen zwar ein starkes Verständnis der Erfahrungsbindung des Denkens, sehen sich aber dazu gezwungen, dafür den Erfahrungsbegriff selbst fundamental zu revidieren.6
Diese philosophische Reflexion korreliert mit den Befunden der im weitesten Sinne post-positivistischen Wissenschaftsgeschichte. Sie weist historisch (und nicht nur begrifflich) die Auffassung zurück, die Leistungsfähigkeit moderner wissenschaftlicher Forschung falle ausschließlich »der« Erfahrung zu. Kuhn etwa, um ein bekanntes Beispiel zu nennen, sieht in der sozialen Organisation der Wissenschaft, und zwar in Form der konservativen Beharrungskraft etablierter wissenschaftlicher »Paradigmen«, einen entscheidenden nicht-empirischen Faktor. Und wo Kuhn mit dem Begriff des Paradigmas noch weitestgehend an der Idee der einen Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode festhält, rücken später zunehmend auch die Vielfalt wissenschaftlicher Methoden und ihre Verflechtungen mit der politischen und sozialen Praxis in den Vordergrund.7
Ein weiteres Problem, das wir berücksichtigen müssen, ist das dem Begriff der Moderne eingeschriebene Narrativ eines scheinbar ungebrochenen Fortschritts, der sich in der historisch bewegten Epoche von der Neuzeit bis hin zum 19. Jahrhundert Bahn brach. Dieses Narrativ, das die wissenschaftliche Revolution mit anderen revolutionären Umwälzungen in der Politik oder der Ökonomie verbindet, kann heute nicht mehr ungebrochen fortgeführt werden. Aus den unterschiedlichsten Perspektiven – geschichtlich, philosophisch, wissenschaftshistorisch, postkolonial, begrifflich – ist die Annahme widerlegt worden, die Zeit der »Moderne« lasse sich als eine einheitliche, allein auf Fortschritt und humaner Vernünftigkeit eingeschworene Entwicklung begreifen.8
Wir werden uns im Folgenden also auch dieser Kritik an der Moderne, an ihrer Einheitlichkeit, Kohärenz und Fortschrittlichkeit, zuwenden müssen, um die These der Modernität der hier diskutierten Ansätze nicht nur behaupten, sondern auch einordnen zu können. An dieser Kritik freilich manifestiert sich ein Muster, das selbst wiederum die Moderne als historische Epoche prägt: Wie kaum eine andere Zeit zuvor ist die Moderne mit der Frage konfrontiert, ob es so etwas wie ›die‹ Moderne überhaupt gibt und wie diese Moderne zu verstehen ist. Dieses Denken der Moderne, das sich selbst in Frage stellt, ist charakteristisch für das moderne Denken, wie es hier verstanden wird.
§ 7 Wie muss Kritik aber gedacht werden, wenn die Moderne nicht als ein einfacher Fortschritt hin zu mehr Freiheit, Wissen und Vernunft verstanden werden kann? Diese Frage berührt, wie erkennbar wird, nicht nur das Verständnis der Moderne. Sie berührt auch die Frage, wie die Erfahrung zum kritischen Potenzial der Vernunft beiträgt. Das klassische Fortschrittsnarrativ geht von einer gegebenen Vernunft aus, die endlich die Last von Dogma und Tradition durchbricht, indem sie sich von den Fesseln dieser Autoritäten löst und die Erfahrung an ihrer Stelle sprechen lässt.
In diesem Kapitel soll ein anderes Bild der Moderne gezeichnet werden. Ich werde argumentieren, dass der Begriff der Moderne vor allem als eine historische Antwort zu verstehen ist und daher ein genuin passives Moment aufweist, welches das Fortschrittsmodell übersieht. Am historischen Anfang der Moderne standen demnach historische Entwicklungen, die sich zunehmend als Umbrüche erwiesen, die der Interpretation bedürfen. Im Europa der Aufklärung etablierten sich in so verschiedenen Bereichen wie der Politik, der Wissenschaft, der Ökonomie und der Religion jeweils neue, im Vergleich zur Tradition durchaus stark gewandelte Ansichten, Denkweisen und Institutionen. Das ist die Wahrnehmung, oder besser formuliert: die Erfahrung, auf die der Begriff der Moderne Bezug nimmt. Diese Wahrnehmung eines Bruches verläuft jedoch nicht synchron zu den jeweiligen historischen Entwicklungen. Erst in Folge der gemachten Erfahrung wird erkennbar, dass sich hier ein radikaler Wandel, ein Umbruch, ereignet hat, der kollektiv gedeutet wird. Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung.
Der Begriff der Moderne bringt diese retrospektive Haltung auf den Punkt, indem er die Neuzeit als eine Epoche fasst, deren Wesen darin besteht, sich von der Vormoderne – der »Tradition« – abzugrenzen. Diese Wahrnehmung ist mehr eine Frage als eine Behauptung. Sie fordert dazu auf, näher zu bestimmen, wie dieser Bruch der »neuen Zeit« zu verstehen ist. So überkreuzt sich die historische Perspektive mit dem systematischen Ansatz der hier verfolgten Diskussion. Die philosophische Frage, wie Kritik möglich ist, erweist sich als ein philosophischer Versuch der Deutung dieser tiefgreifenden und weitreichenden modernen Erfahrung. Die Moderne zu affirmieren heißt in dieser Perspektive zunächst vor allem, eben jene fundamentale Irritation der eigenen Maßstäbe zu akzeptieren, mit der die Moderne ihren eigenen Anfang setzt. In eben diesem Sinne sind, wie wir noch genauer sehen werden, alle hier diskutierten Positionen affirmativ modern.
§ 8 Vor dem Hintergrund dieses revidierten Verständnisses der Moderne ist es erforderlich, die hier zur Diskussion stehenden Begriffe so zu fassen, dass eine vorschnelle Gleichsetzung von Kritik und wissenschaftlicher Rationalität vermieden wird. Das problematische Verhältnis von Kritik und Erfahrung muss aus der Scheinalternative entlassen werden, Rationalität orientiere sich entweder kritisch an Erfahrung oder aber verlöre unweigerlich ihre kritische Kompetenz. Mit Blick auf die historischen und soziologischen Einbettungen der Wissenschaften (in ihrer Pluralität) muss zudem Distanz eingenommen werden zu der Annahme, es gebe eine einheitliche Form »der« Wissenschaft, die ihrem Wesen nach das unanfechtbare Paradigma rationaler Argumentation sei. Nicht zuletzt ist eine solche Distanzierung selbst ein Erfordernis moderner Kritik: Nur wenn die Praxis der Wissenschaft und die vernünftige Kritik nicht immer schon zusammenfallen, ist es möglich, auch an der Wissenschaft und ihren Resultaten Kritik zu üben, ohne damit bereits irrational zu sein. Wenn irgendetwas Wahres an der Annahme sein soll, dass die Moderne in einem wesentlichen Sinne mit Kritik verbunden ist, muss dieses kritische Potenzial anders begriffen werden können.
Einen solchen alternativen Zugriff auf die Problematik leistet der Begriff der Autonomie. Er dient der weiteren Bestimmung des Zusammenhangs von Kritik und Erfahrung als Ausgangspunkt. Denken im skizzierten modernen Sinne ist demnach wesentlich kritisch, weil es autonom ist. Nach dieser These hat die Vernunft, oder das vernünftige Denken, vor allem eine irreduzibel reflexive Form. Diese Form ist es, die der Begriff der Kritik zum Ausdruck bringt. Das Denken hat die Kraft, die Möglichkeit und unter Umständen dann auch die Pflicht, sich selbst und die eigenen Inhalte reflexiv zu korrigieren.
Dieses formale Verständnis der rationalen Autonomie lässt offen, welche Gründe »gut« sind oder nicht. Vernunft ist hier weder Lob noch Tadel. Es legt sich nicht darauf fest, ob diese Vernunft eine natürliche Eigenschaft ist, ob sie sich allein in der Logik realisiert oder ob sie die Gestalt einer diskursiven Praxis des Gebens und Nehmens von Gründen annehmen muss. Nicht zuletzt ist im Folgenden ausschließlich von der rationalen Autonomie die Rede, ohne damit bereits auf die praktische Idee der Autonomie als individueller Selbstbestimmung einzugehen. Es geht hier also nicht um Autonomie als Form eines ›gelingenden‹ eigenen Lebens.9
Trotz dieses Abstands zum praktischen Autonomiebegriff führt die formale Bestimmung der Vernunft als Autonomie, wie wir sehen werden, im Verlauf der weiteren Untersuchung zu einer Aufhebung der Idee einer kategorischen Trennung von praktischer und theoretischer Vernunft. Denn gerade in der Fokussierung auf die formale Selbstbezüglichkeit der Vernunft wird deutlich, dass gar nicht klar ist, was es eigentlich heißt, der kritischen Reflexivität eine stabile Form zuzuschreiben. Diese Frage steht im Zentrum der weiteren Detailuntersuchungen zu den hier diskutierten Autoren.
Ist die Form der Vernunft selbst formalistisch zu verstehen, wie es der Wiener Kreis vorschlägt? In diesem Verständnis besteht die rationale Autonomie gerade darin, dass das Denken frei ist von der Welt und ihren Einflüssen. Wir können uns, anders formuliert, immer wieder neu und anders zu ihr verhalten; ein Gedanke, der nicht zuletzt die Geschichte der ständigen Umbrüche der wissenschaftlichen Moderne ernst nimmt und in das Verständnis der Vernunft einschreibt. Eine andere Deutungsmöglichkeit ist, die Freiheit des Denkens als eine intrinsisch mit der Welt verbundene, ja letztlich verwickelte Form zu verstehen. Diese postformalistische Alternative vertreten der Pragmatismus und die postanalytische Philosophie. Bei ihnen ist die Freiheit der Selbstbestimmung eine gebundene Freiheit in der Welt und damit eine Autonomie, die – wie die Moderne selbst – wesentlich mit Momenten der Fremdbestimmung verbunden ist.
An dieser Stelle ist vor allem wichtig, dass beide Positionen die moderne Bestimmung der Vernunft als Autonomie auslegen. Wenn der Begriff der Moderne für die Behauptung steht, das moderne Leben sei durch die Idee der Autonomie geprägt und stehe unter dem Anspruch der Selbstbestimmung und der Selbstkritik, dann ist die kritische Selbstbefragung der Moderne die Frage nach ihrer eigenen Form. In dieser Frage verbindet sich die historische mit der systematischen Dimension der kritischen Vernunft.
Drei Traditionen der Moderne
§ 9 Einige Eckdaten und theoriegeschichtliche Zusammenhänge verdeutlichen die verbindende und zugleich differenzierende Modernität der hier verhandelten Positionen. Chronologisch am Anfang steht der klassische Pragmatismus, zu dem hier die Schriften von Peirce, James und Dewey gezählt werden. Der Pragmatismus hatte in den ersten zwanzig Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts seine Blütezeit. Im Jahr 1907 erschien die wohl bekannteste pragmatistische Schrift, James’ Vorlesungen Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking. Peirce’ heute bekanntesten pragmatistischen Aufsätze erschienen bereits in den 1870er Jahren, erhielten aber erst durch James vermehrte Aufmerksamkeit. »Pragmatismus« wurde zu einem lose mit James, Dewey, Peirce und – heute oft vergessen – F. C. S. Schiller verbundenen Sammelausdruck. Der Pragmatismus stieg zu internationaler Beachtung auf, wurde breit rezipiert und auch kontrovers diskutiert. Das Ende dieser klassischen Zeit markiert die Publikation der beiden wohl bekanntesten Werke von Dewey, Experience and Nature und The Quest for Certainty.10
Danach nahm der Einfluss der Pragmatisten, international wie auf der nationalen Ebene der amerikanischen Philosophie, deutlich ab. Mit der »analytischen« Philosophie, anfangs vor allem verbunden mit Russells Methode der logischen Analyse und dann der Wissenschaftstheorie des Wiener Kreises, etablierte sich eine schließlich weltweit dominierende philosophische Strömung. Die mit ihr verbundene methodische Neuorientierung fiel so umfassend aus, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter pragmatistisch geneigten Autoren immer wieder Klagen finden, die Klassiker des Pragmatismus würden gerade in dem Land, in dem diese Philosophie doch entstanden ist, gar nicht mehr ernsthaft gelesen.11 Spätestens mit der erzwungen Emigration der Mitglieder des Wiener Kreises in die Vereinigten Staaten setzte dann aber auch schon die Phase der kritischen Weiterentwicklung ihrer Ideen ein. Die ursprünglich ausschließlich logische und sprachphilosophische Orientierung wich einer zunehmenden Berücksichtigung von Fragen der Handlungspraxis sowie einer verstärkten Problematisierung der nicht-sprachlichen Kontexte und Bedingungen der Sprache. Aus dieser kritischen Fortentwicklung des ursprünglich idealsprachlichen Ansatzes des Wiener Kreises entwickelte sich die postanalytische Philosophie, die vor allem mit den Namen von Quine, Sellars, Davidson und später Rorty verbunden ist.12
Zwischen Peirce und Putnam liegen also mehr als hundert Jahre, in denen sich der Pragmatismus, der Logische Empirismus und die postanalytische Philosophie entfalten konnten. Wie verhält es sich nun mit der behaupteten inhaltlichen Gemeinsamkeit dieser Ansätze? Von den philosophiegeschichtlichen Rekonstruktionen, die diese Frage an die hier interessierenden Traditionen stellen, sind vor allem zwei Darstellungen hervorzuheben. Sowohl Cheryl Misak (2013b) als auch Richard Rorty (1979) betonen, dass der Pragmatismus und die postanalytische Philosophie übereinstimmend eine fallibilistische Grundhaltung einnehmen und damit das Problem der Kritik in den Mittelpunkt stellen.13 Die Frage ist freilich, wie dieser Fallibilismus einzuordnen ist. Wo nimmt er dieselbe Gestalt an, wo gibt es signifikante Unterschiede? Und vor allem: Wodurch sind Übereinstimmung und Differenzen zu erklären? Die von Rorty und Misak jeweils gegebenen Antworten fallen unterschiedlich aus.
Rortys Narrativ ist das bekanntere. Er schildert in The Mirror of Nature die Geschichte einer zunehmenden Emanzipation der Philosophie von dem Bedürfnis, die Welt in der Reflexion abzubilden; eine Fortschrittsgeschichte, die in die postanalytische Kritik am epistemischen Fundierungsstreben (und damit auch in Rortys eigene Absage an jede Erkenntnistheorie) mündet. Diese Erzählung hat jedoch den Konstruktionsfehler, dass sie allein die postanalytische Philosophie, also Rortys philosophische Gegenwart, als Ausdruck eines adäquaten modernen Fallibilismus – oft auch als antifoundationalism bezeichnet – anzuerkennen bereit ist. Ältere Positionen sind in dieser Perspektive immer schon defizitär. Auch Kant und der Wiener Kreis – zwei wichtige Bezugspunkte postanalytischer Diskussion – begreifen die Vernunft wesentlich kritisch und bekämpfen ein reifizierendes und dogmatisches Denken. Trotz dieser Gemeinsamkeiten werden sie von Rorty aber ausschließlich als Vertreter eines foundationalism gelesen, als zum Scheitern verurteilte Versuche, weiterhin einen privilegierten Standpunkt des Wissens und Erkennens abzusichern. Für Rorty liegt erst in der postanalytischen Philosophie ein intellektuell respektabler antifoundationalism vor, weshalb er in ihren Vorläufern und Einflüssen vor allem die dogmatischen Irrtümer hervorhebt, die dann endlich überwunden wurden. Selbst Dewey, einer der drei »Heroen« in Rortys Narrativ der Emanzipation von der Tradition, wird daher vorgeworfen, sich nicht vollends vom Empirismus Lockes und damit vom foundationalism, gelöst zu haben (Rorty 1982, 81).
Dieses Narrativ einer sukzessiven Befreiung von den Fesseln der abbildenden Erkenntnistheorie ist nicht hilfreich, da es nicht bereit ist, den Fallibilismus der postanalytischen Philosophie als die eigenständige Artikulation eines bereits bestehenden Problems anzusehen. Rorty zeichnet zudem ein nach heutiger Forschungslage eindeutig verzerrtes Bild des Pragmatismus und des Logischen Positivismus (Volbers 2014b). Im Unterschied dazu greift Cheryl Misak historisch deutlich weiter aus. Sie platziert den antifoundationalism, den auch sie als Kern postanalytischen Denkens sieht, bereits an den Anfang einer umfassenden Traditionslinie, die vom Pragmatismus bis hin zur Gegenwart reicht. Sie sieht die Kritik am epistemischen Fundamentalismus entsprechend nicht als eine endlich gefundene Lösung, sondern als das verbindende inhaltliche Problem dieser Debatten. Ihre Leitthese ist, dass diese Ansätze sich bei allen Unterschieden darin einig sind, dass die wissenschaftliche Forschung keinen epistemischen Halt außerhalb der menschlichen Praxis finden kann. Die Herausforderung der Philosophie bestehe entsprechend darin, dass die reflexive Erläuterung jener Standards und Maßstäbe, an denen sich die Vernunft orientiert, selbst bereits auf diese Standards und Maßstäbe angewiesen ist. In Misaks eigenen Worten:
We must try to explain our practices and concepts, including our epistemic norms and standards, using those very practices, concepts, norms, and standards (2013b, 252).
Misaks Feststellung lässt sich unmittelbar als Variation eines klassischen Themas der philosophischen Moderne identifizieren: Die Vernunft – hier in einem Vokabular der Praktiken, Normen und Maßstäbe beschrieben – bleibt in ihrem Geschäft der (kritischen) Reflexion vollends auf sich selbst verwiesen. Diese Kennzeichnung der Philosophie als ein wesentlich reflexives, auf sich selbst zurückgeworfenes Denken ist ein guter Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Misaks chronologisch gereihte Einzelstudien (versammelt in Misak 2013b) zu prominenten Klassikern des Pragmatismus und der postanalytischen Philosophie belegen ausführlich, dass dieses gemeinsame Grundverständnis nicht zuletzt auf einen nachhaltigen (wenn oft auch eher impliziten) Einfluss des klassischen Pragmatismus zurückzuführen ist. Ein prominentes Beispiel dafür ist Quine. Er beschreibt seine äußerst effektive Kritik an den »Dogmen« des Logischen Empirismus explizit als einen Schritt hin zu einem »more thorough pragmatism« (1951, 41), und er lobt Dewey dafür, dass dieser bereits eine antirepräsentationalistische Bedeutungstheorie vertrat, als Wittgenstein noch einer »copy theory of language« (1969, 27) anhing.14
Misaks Darstellung leidet unter der Einseitigkeit, dass sie diese pragmatische Wende der analytischen Sprachphilosophie allein auf den Einfluss der Klassiker des Pragmatismus zurückführt. Für sie liegt hier ein »Amerikanischer Pragmatismus« (so ihr Buchtitel) vor, zu dem nicht nur Peirce, sondern auch Quine und McDowell zu zählen sind. Dieser Versuch, rückblickend eine durchgängige nationale Tradition zu verteidigen, mutet ebenso gewaltsam wie provinziell an. In seiner Fixierung auf nationale Trennlinien wirkt er geradezu bizarr. Neben dem Pragmatismus waren die wichtigsten Einflüsse der »amerikanischen« analytischen Sprachphilosophie der Wiener Kreis, Wittgenstein und die britische Sprachanalyse, mithin tief europäisch verwurzelte Autoren und Traditionen.15 Zudem wirkten diese Positionen wechselseitig aufeinander ein: Der Pragmatist William James bezieht sich positiv und mit Sachkenntnis auf die Wissenschaftstheorien von Ernst Mach und Pierre Duhem; er war – als ein auch in Deutschland ausgebildeter Psychologe – ein Kenner dieser »europäischen« Diskussion.16 Umgekehrt beeinflusste der Pragmatismus, der ja international diskutiert wurde, die Debatten, die im Logischen Empirismus geführt wurden, wie auch Wittgensteins Philosophie (vgl. Goodman 2002). Eine Klassifizierung wie »amerikanische Philosophie« blendet den globalen Charakter aus, den die Philosophie schon damals längst hatte, und erinnert in dieser Hinsicht an die ebenso unhaltbare Trennung zwischen einer analytischen und einer kontinentalen Philosophie.17 Solche Unterscheidungen sind hilfreich, um bestimmte Themen und Diskussionszusammenhänge zu unterscheiden, und zu diesem Zweck werden sie auch in der vorliegenden Untersuchung eingesetzt. Doch sie dürfen nicht den Blick davon ablenken, dass die Unterschiede vor dem Hintergrund gemeinsamer oder zumindest verwandter Fragestellungen und Problemwahrnehmungen stehen.
§ 10 Die Pointe der Zurückweisung von Misaks Strategie der Nationalisierung des Pragmatismus ist, dass der Pragmatismus wie auch die postanalytische Philosophie in einen weiteren Kontext eingebettet werden müssen. Sie sind als Teil der philosophischen Moderne zu verstehen, dessen grundlegendes Problem darin besteht, dass in ihr die Vernunft sich selbst radikal fragwürdig geworden ist. Wir müssen also noch einen Schritt weiter gehen als Misak und die von ihr ›pragmatistisch‹ genannte fallibilistische Einstellung historisch weiter vorverlagern. Für diese Ausweitung bietet es sich an, bis auf die Klassiker der philosophischen Moderne, also zu Kant und die auf ihn folgenden ›postkantischen‹ Debatten, zurückzugehen.18 Misaks Situierung der Philosophie, wonach wir ›unsere‹ praktisch genutzten Begriffe und rationalen Standards nur unter Rückgriff auf diese Begriffe und Standards klären können, formuliert in dieser erweiterten Perspektive ein kantisches Vorgehen pragmatistisch um. Auch wenn Kant mit der Theorie transzendentaler Subjektivität noch versuchte, in der philosophischen Reflexion einen Standpunkt absoluter Notwendigkeit (und Gewissheit) zu gewinnen, erhebt er bereits auf eine äußerst radikale Weise die reflexive Kritik zum Inbegriff dessen, was es überhaupt heißt, vernünftig zu sein. Bereits bei Kant geht es, wie Herbert Schnädelbach formuliert, »um Kritik der Vernunft durch die Vernunft selbst, und nur dadurch beweist sie ihre Vernünftigkeit« (Schnädelbach 2007, 8). Und es ist Hegel, der in kritischer Reaktion auf den kantischen »Kritizismus«, wie er es nannte, bestrebt war, den kantischen Formalismus in dieser Vision der Philosophie zu tilgen – also Kants Annahme, eine solche kritische Reflexion müsste sich auf das Postulat einer transzendentalen, von aller Erfahrung unabhängigen Subjektivität stützen.19
Die Klassiker der Moderne müssen wiederum nicht erst an die hier interessierenden Traditionen herangetragen werden. Ihnen dienten Kant und Hegel als zentrale Bezugspunkte, ob nun als Vorbild oder zur Kritik. So begann sich der klassische Pragmatismus – wie übrigens auch die analytische Philosophie – zu einer Zeit zu formieren, als der Idealismus die dominierende akademische Strömung in den englischsprachigen departments war.20 Dewey fing seine philosophische Karriere als Hegelianer an, und Peirce verstand sein Werk als eine nicht nur kritische Reaktion auf Hegel.21 Auch ist die postanalytische Philosophie bekannt dafür, dass Autoren wie Sellars oder später auch Brandom und McDowell explizit hegelianische Motive in die analytische Tradition einführen. Einige Interpreten sprechen gar von einer postanalytischen »Rückkehr zu Hegel« (Redding 2007). Was den Wiener Kreis betrifft, hebt die neuere Forschung die starke Bedeutung der Philosophie Kants für die Gründungsfiguren des Logischen Positivismus hervor (Friedman 1999). Der lange als dogmatisch geschmähte Wiener Kreis wird heute wieder vermehrt als eine produktive Wiederaufnahme kantischen Denkens diskutiert, die – darin durchaus undogmatisch – versucht, auf die Idee eines synthetischen Apriori vollständig zu verzichten. Damit tritt auch er ungebrochen in den Kreis der modernen Philosophie ein, die versucht, die Vernunft reflexiv mit Blick auf ›unsere‹ gegebenen Praktiken und Standards zu bestimmen.
Moderne als Erfahrung und Interpretation
§ 11 Der Pragmatismus, die postanalytische Philosophie wie auch der Wiener Kreis wurzeln in einem weiten historischen Grund, der über nationale Grenzen ebenso hinausgeht wie über eine progressive Überwindung der Tradition. Alle drei Positionen müssen als Positionen der Moderne verstanden werden, als die Problematisierung einer Vernunft, die prinzipiell und essentiell kritisch zu verstehen ist. Diese »Moderne« gilt es nun näher zu bestimmen.
Als Ausgangspunkt kann uns die bereits einleitend in diesem Kapitel vorgestellte Beobachtung dienen, dass der Begriff der Moderne untrennbar mit der Idee eines starken, ja revolutionären Bruches verbunden ist. Je nachdem, welcher Bereich genau in den Blick genommen wird, ergeben sich dabei abweichende Auffassungen des Beginns »der« Moderne.22 Der demokratische Umbruch lässt sich auf das 18. Jahrhundert datieren, gestützt auf die französische und die amerikanische Revolution. Wesentlich für diesen Umbruch sind das Ideal nationaler Selbstbestimmung sowie die Abschaffung der aristokratischen Herrschaft. Die industrielle Revolution markiert einen radikalen Umbruch in der Produktionsweise und die Einführung effektiven kapitalistischen Wirtschaftens, wie wir es heute kennen. Dies ist der Beginn der ökonomischen Moderne mit ihrer ständigen Steigerung der Produktivität und einer zunehmenden technischen Beherrschung der Natur und des Menschen. Sie tritt vor allem im 19. Jahrhundert in aller Deutlichkeit zutage. Die wissenschaftliche Revolution schließlich steht für den im 17. Jahrhundert begonnenen Aufbau der modernen, experimentell arbeitenden Wissenschaften und ihre institutionelle Etablierung in den Universitäten. Sie gilt als eine »radikale geistige Revolution, deren Wurzel und zugleich Frucht die moderne Naturwissenschaft ist« (Koyré 2008, 11).
Diese Veränderungen in der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Wirtschaft in Europa (und weltweit) motivieren ganz wesentlich zu diesem falliblen und selbstkritischen Bild der Vernunft, das hier im Zentrum steht. Wenn wir verstehen wollen, was mit der modernen Diskussion der Erfahrung und der Vernunft im Grunde auf dem Spiel steht, ist es hilfreich, sich diesen außerphilosophischen Kontext zu vergegenwärtigen. Doch der Rückgriff auf »die Moderne« kann hier nicht stehen bleiben. Auch das wurde bereits erwähnt: Dieser Epochenbegriff ist viel zu kontrovers, um heute noch einfach so übernommen werden zu können. Es ist eine zu grobe Vereinfachung, so zu tun, als seien in historischen Geschichtsereignissen mit einem Male die modernen Naturwissenschaften, die Demokratie und die moderne Ökonomie in die Welt getreten, um fortan eine ungebrochene und irreversible Dominanz auf das menschliche Denken und Handeln auszuüben. Doch diese Kritik darf nicht dazu verleiten, in ihr Gegenteil umzuschlagen. Weder kann so getan werden, als könne die Moderne einfach rückgängig gemacht werden, noch ist mit der bloßen Negation des bestimmenden Narrativs der Moderne begrifflich etwas gewonnen.
§ 12 Die moderne Vernunft, so stellt es ein pointiert formulierter Buchtitel dar, muss offenbar sowohl gegen ihre modernekritischen »Verächter« als auch gegen ihre »Liebhaber« verteidigt werden, die zu schnell die Moderne kritiklos affirmieren.23 Wie ist dieser ambivalente Bezug auf »die Moderne« zu verstehen? Die Moderne, so die hier verfolgte These, lässt sich am besten als eine historisch entstandene Ausdeutung konkreter geschichtlicher Entwicklungen begreifen. Es geht nicht darum, sich für oder gegen die Moderne zu positionieren – sondern spezifisch modern ist dieser widersprüchliche Streit darum, wie diese Entwicklung, und damit die eigene historische Position, zu verstehen ist.24
Mit diesem Ansatz folge ich einem methodischen Vorschlag des Soziologen Peter Wagner (2009). Er verzichtet bei der Behandlung des Themas der Moderne auf jede immanente Fortschrittserzählung, ohne jedoch die Idee eines markanten (wenn auch schwer zu benennenden und zu identifizierenden) Umbruchs fallen zu lassen.25 Am Anfang der Moderne stehen für Wagner demnach Geschichtsmomente (Wagner 2009, 16), also markante Ereignisse und Vorgänge. Diese Entwicklungen in der Wissenschaft, der Politik und der Ökonomie aber, so Wagner, verstehen sich nicht von selbst. Sie sind Erfahrungen, die, in sich gleichsam ungesättigt, der Interpretation bedürfen und erst durch kollektive Deutungen ihre spezifische Gestalt annehmen. Dieses Schema einer wechselseitigen Bestimmung von Zukunft und Vergangenheit dynamisiert die Moderne. Was die Erfahrungen bedeuten, welche Fragen sie aufwerfen und welche Antworten zu geben sind, bleibt demnach konstitutiv offen und kontrovers.
Dieser methodische Zugriff bricht keineswegs vollständig mit dem klassischen Narrativ. Er übernimmt die Annahme, dass sich mit der Moderne ein starker erklärungsbedürftiger Bruch mit der Tradition etabliert hat – die Trennung von Moderne und Vormoderne.26 Doch er geht auf den kritischen Einwand ein, dass dieser Bruch nicht mehr als ein einmaliger zeitgeschichtlicher Einschnitt hingestellt werden kann, durch den die Vormoderne Vergangenheit wird. Denn darin liegt ein ganz wesentliches Problem im Umgang mit Zuschreibungen wie ›modern‹ und ›Moderne‹: Die geradezu selbstgefällige Beschreibung der historischen Veränderungen als eine unvermeidlich auf den Fortschritt zielende ›Modernisierung‹ sowie das modernistische Vokabular der ›Revolution‹, das ja auch auf die moderne Wissenschaft und die Industrialisierung angewendet wird, unterstellen der Geschichte eine unvermeidbare Logik, die weder umgekehrt noch sinnvoll bestritten werden kann. Das Adjektiv ›modern‹ ist in diesen Verwendungsweisen, wie Bruno Latour kritisch festhält, »doppelt asymmetrisch: Es bezeichnet einen Bruch im regelmäßigen Lauf der Zeit, und es bezeichnet einen Kampf, in dem es Sieger und Besiegte gibt« (Latour 2008, 19).
Der klassische Begriff der Moderne fasst die Geschichte als einen Prozess, in dem sich bestimmte Werte und Institutionen – vor allem Freiheit, objektive Wissenschaft und Demokratie – Bahn brachen und ihre Überlegenheit demonstrierten. Und genau dieses asymmetrische Narrativ wird von den Kritikern der Moderne – ihren »Verächtern«, wie es in dem oben zitierten Buchtitel zuspitzend heißt – in Frage gestellt. So beschreibt Latour die Moderne als das Projekt einer »großen Reinigung«, das zur Verteidigung und Weiterführung des Fortschritts Natur und Geist säuberlich zu isolieren versucht. Richtig aber wäre es, so Latour, die Kontinuitäten und Verwicklungen dieser Seiten (die »Mischungen«, wie Latour sie nennt) anzuerkennen. Ähnlich weisen Autoren wie Foucault und Derrida kritisch darauf hin, dass sich die Idee eines »reinen Wissens« oder einer »reinen Bedeutung« nicht aufrechterhalten lässt. Wissenschaft ist demnach immer auch eine diskursive, sich über Ausschlüsse stabilisierende Praxis; scheinbar selbstpräsente Bedeutungen verweisen in einer differentiellen Drift immer wieder auf ihr supplément.27 Die historische Asymmetrie von Moderne und Vormoderne korrespondiert mit einer epistemischen und bedeutungstheoretischen Asymmetrie, und beide sind abzulehnen.
Diese Kritiken stärken noch einmal den Punkt, dass die historischen Umbrüche der Moderne nicht so verstanden werden können, als würde sich in ihnen ein reines, unverfälschtes Prinzip anzeigen – der Dreiklang von Freiheit, Wohlstand, Demokratie –, das gleichsam nur noch auf den (geistigen) Begriff gebracht werden muss. Eben das hebt auch der Nexus von Erfahrung und Interpretation hervor, den Wagner einführt: Sowohl das kulturell etablierte Verständnis als auch ihre historischen Bezüge ergeben sich in einem wechselseitigen Deutungsprozess, der sich gerade dadurch als genuin modern erweist, dass er immer wieder auch mit Alternativen konfrontiert wird.
§ 13 Besonders deutlich wird die Fruchtbarkeit dieser Kritik einer asymmetrischen Moderne im Fall der sogenannten wissenschaftlichen Revolution. Dieser Begriff wurde unter anderem stark von Alexandre Koyré geprägt, der in den 1950er Jahren davon ausging, dass das 17. Jahrhundert Zeuge eines revolutionären Ereignisses wurde, in dem sich »die« moderne Naturwissenschaft gegen den Widerstand des Aristotelismus etablierte und den Sieg davon trug. An die Stelle des kosmischen Bildes einer »geschlossenen Welt« trat demnach die abstrakte Leere des »unendlichen Universums« der modernen Physik. Hier zeigt sich deutlich die doppelte Asymmetrie, von der Latour spricht – die Revolution als Ereignis und als Triumph des Wissens. Spätere Wissenschaftshistoriker freilich konnten den Glauben an eine solche Revolution immer weniger teilen.28 So bemerkt Steven Shapin, mit ironischer Distanz an der Schwelle zum 21. Jahrhundert stehend:
Some time ago, when the academic world offered more certainty and more comforts, historians announced the real existence of a coherent, cataclysmic, and climactic event that fundamentally and irrevocably changed what people knew about the natural world (Shapin 1998, 1).
Wir können Koyrés Gedanken nicht mehr aufrechterhalten, mit der modernen Wissenschaft breche sich eine einheitliche moderne Weltsicht Bahn, in der »die« wissenschaftliche Methode endlich zu sich selbst komme und althergebrachte Überzeugungen für immer widerlege. Dagegen betont die heutige Wissenschaftsforschung die Diversität der kulturellen Praktiken, in deren unsystematischen Verflechtungen sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ausbilden und verbreiten. So zeichnen Shapin und Simon Schaffer in ihrem Klassiker über »Leviathan & the Air Pump« (2011) die Beziehungen von Politik und Wissenschaften nach und heben hervor, dass die Idee objektiver experimenteller Evidenz eng mit einer klaren politischen Vision der richtigen gesellschaftlichen Ordnung verflochten war. Diese historisch detaillierte Analyse der Entstehung der Experimentalwissenschaft im 17. Jahrhundert führt vor, dass die Wissenschaften keineswegs eine autonome Manifestation unabhängiger Rationalität sind. Die Grenzen zwischen dem, was als »Wissenschaft« gilt und von ihr auszuschließen ist, waren und sind immer fließend. Sie bilden einen Gegenstand von Aushandlungen, aber auch von Kämpfen, Setzungen und Zufällen.29
Die Pointe dieser Kritik ist nicht, dass Wissenschaft, oder wissenschaftliches Forschen und Argumentieren, keinen Wert hat. Sie weist vielmehr darauf hin, dass bestimmte Werte des Wissens sowie bestimmte Leitvorstellungen dessen, was ›vernünftig‹ ist, in einem so starken Maße auf Idealisierung beruhen, dass sie besser nicht (mehr) ungefragt angenommen werden sollten. Die klassisch modernistischen Vorstellungen der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Vernunft lassen sich nicht (mehr) ungebrochen übernehmen.
Auf ein aktuelles Beispiel für die große Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit weisen Shapin und Schaffer gegen Ende ihrer Studie hin. Dem Idealbild zufolge sollte modernes Wissen öffentlich und transparent sein – Gegenstand eben ständiger Kritik und Neuperspektivierung, wie sie auch hier thematisch ist. Faktisch aber wird das Wissen – so die Autoren im Jahre 1985 – nur von einer verschwindend kleinen Elite verstanden und diskutiert. Wir leben, wie es die Soziologie später formulierte, in einer »Wissensgesellschaft«, ohne jedoch recht über die Mittel zu verfügen, das Wissen wirklich für alle zugänglich und damit auch kritisch revidierbar zu halten.30 »A form of knowledge that is the most open in principle has become the most closed in practice« (Shapin und Schaffer 2011, 343). An dieser Diskrepanz zeigt sich exemplarisch die Bedeutung der Modernekritik: Eine Demokratie, die sich programmatisch auf ein solches Wissen stützt und nicht sieht, dass dieses Ideal keinen Platz in der Wirklichkeit hat, verschließt sich faktisch gegenüber ihren Mitgliedern.
§ 14 Die Kritik der Moderne ist als der Hinweis zu lesen, dass das klassische moderne Selbstbild eben nicht das letzte Wort sein kann zu der Frage, wie Natur, Geist, Freiheit oder Wissenschaft zu verstehen sind. In diesem Sinne ist die Moderne, wie Lyotard es prominent behauptet hat, eine Metaerzählung, die durch solche Kritiken nicht widerlegt oder ausgehebelt, sondern neu geschrieben (»réécrire«) wird (Lyotard 1988). Es geht darum, die Einseitigkeiten des klassischen Narrativs aufzubrechen. Zumindest diese Intention ist wiederum selbst klassisch modern: Es geht um die Kritik eines Selbstbildes, das sich als dogmatisch einseitig und unsensibel gegenüber neuen begrifflichen, historischen und empirischen Befunden erwiesen hat.
Eine solche Sensibilität fängt Wagners Auffassung der »Moderne als Erfahrung und Interpretation« gut ein. Spezifisch modern ist nach diesem Verständnis nicht das Ereignis, d. h. der Umbruch, der sich durchaus über Jahrzehnte hinweg entwickeln kann und erst im Rückblick deutlich abgrenzbare Konturen annimmt. Spezifisch modern ist vielmehr die in konkreten Institutionen, Begriffen und Werten verkörperte Form, die die Deutung dieser historischen Erfahrungen annimmt. Auf diese Weise lässt sich die Rede von der Moderne lokalisieren und versachlichen. Sie ist ein Streit um die Deutungen dessen, was in den modernen »Revolutionen« eigentlich geschehen ist – und damit zugleich auch ein Streit darüber, was unsere Gegenwart mit diesen Geschichtsmomenten verbindet. Jede der vorgeschlagenen Deutungen ist dabei, wie Wagner betont, »von Anbeginn umstritten« und wird »im Lichte weiterer Erfahrungen und deren Konsequenzen weiterhin der Revision ausgesetzt« (Wagner 2009, 17).
Autonomie
§ 15 Der übergreifende Vorschlag dieses Kapitels ist, die theoretischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts vor dem weiten, aber eben doch historisch konkretisierbaren Horizont der Moderne zu lesen. Erst so nimmt das leitende Problem der Kritik Kontur an. Wagners Modell der »Moderne als Erfahrung und Interpretation« stellt nun einen allgemeinen Rahmen zur Verfügung, in dem sich diese Problematisierung der kritischen Vernunft produktiv situieren lässt. Wagner schlägt nun im Weiteren vor, die Besonderheit der Moderne darin zu sehen, dass sie die Fragen, die sie sich stellt, unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt zu beantworten und zu diskutieren versucht – unter dem Eindruck eines umfassenden Ideals der Autonomie im Denken und Handeln.31 Modern ist demnach die Ansicht, dass sich das menschliche Handeln und Denken zur Selbstbestimmung »verpflichtet«, wie es Wagner formuliert, und sich in diesem allgemeinen Sinne das eigene Gesetz selbst aufzuerlegen versucht:
Das heißt einerseits, dass moderne Antworten auf diese Fragen nicht mit Bezug auf externe Autoritätsquellen gegeben werden können. Andererseits impliziert dies, dass jede vorgeschlagene Antwort der Kritik und Infragestellung ausgesetzt ist (Wagner 2009, 15).
Der Gedanke der Autonomie fasst den modernen Gedanken eines Bruchs mit der Vormoderne, der zugleich eine Kritik und eine Korrektur der traditionellen Positionen und Verhaltensweisen sein soll, auf seinen logischen Punkt zusammen. Die Vorgaben der Tradition, der Offenbarung, des Glaubens oder der Natur müssen auch dann, wenn sie richtig sein sollten, von der Vernunft selbst noch geprüft und anerkannt werden. Verweise auf solche Vorgaben sind freilich weiterhin möglich. Sie haben jedoch keine abschließende Autorität. Auch das scheinbar Selbstverständliche muss unter modernen Bedingungen noch reflexiv gerechtfertigt werden: Es muss aufgezeigt werden können, dass der Verweis auf die Autorität, auf die Tradition oder auf empirische Evidenzen auch wirklich ein Grund für bestimmte Konsequenzen ist. Die Moderne muss ihre »orientierenden Maßstäbe«, wie es Habermas formuliert, mit den Mitteln kritischer Reflexion vollständig »aus sich selber schöpfen« (Habermas 1985, 16).
Der Autonomiegedanke bringt die allgemeine Form der Antworten zum Ausdruck, die, unter dem Eindruck der zeithistorischen Umbrüche der Wissenschaft, der Politik und der Ökonomie, als »modern« gelten können. Wagner unterscheidet zwischen der »politischen«, der »wirtschaftlichen« und der »philosophischen« Moderne. Hier werden jeweils Problemkomplexe behandelt, die durchaus auch schon vor der Moderne diskutiert wurden: In politischen Debatten steht die Freiheit im Vordergrund, in der Ökonomie die Verteilung von Gütern und die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse und in der epistemisch orientierten Philosophie die Möglichkeit verlässlichen Wissens. Für die Moderne erweist sich in all diesen Problemkontexten die Forderung nach einer Autonomie sichernden Lösung als bestimmend: Gesucht wird nach einem Verständnis, das der menschlichen Selbstbestimmung möglichst großen Raum gibt.
Es ist ratsam, noch einmal zu betonen, dass diese »moderne« Auffassung eine Perspektive darstellt, ein prägendes Selbstverständnis, und keineswegs die einzige, zu einer bestimmten Epoche historisch wirkliche Position. Völlig zu Recht spitzt Wagner seine methodische Position auf die Aussage zu, dass »modern« und »Modernität« als eine »Anschauungsweise« zu entziffern sind, nach der »Menschen ihr Leben verstehen« (Wagner 2009, 15). So können, wie Wagner gleich hinzufügt, auch bestimmte Aspekte des antiken griechischen Selbstverständnisses als »in vielerlei Hinsicht hochmodern« (2009, 17) gelten. Trotz dieser Beweglichkeit ist die Verbreitung dieser Auffassung in der Neuzeit kein Zufall. Das moderne Selbstverständnis, dem zufolge das menschliche Denken und Handeln sich keiner fremden Autorität zu beugen hat und sich wesentlich selbst bestimmt, hat in den drei bereits erwähnten historischen Umbrüchen konkrete institutionelle Gestalt gewonnen: in der Demokratie, in der Wissenschaft und in der kapitalistischen Produktionsweise. In ihnen verkörpert sich die typisch moderne »interpretative Beziehung zur Welt«, die unter dem Stichwort der Autonomie »eine Reihe von Problematiken offenlegt oder vielleicht eher: hervorbringt« (Wagner 2009, 363).
§ 16 An der Geschichte des Autonomiebegriffs lässt sich Wagners Feststellung bestätigen, dass hier eine ›Anschauungsweise‹ zum Ausdruck kommt, die sich auch unter anderen historischen Bedingungen zumindest teilweise entfalten konnte. Der Begriff der Autonomie bezeichnet ursprünglich die Forderung antiker Stadtstaaten nach politischer Selbstverwaltung und Unabhängigkeit (Ritter 1971). Diese antike Bedeutung wurde in der Neuzeit neu aufgegriffen und damit auch transformiert. In den politischen und juristischen Debatten gewann die Autonomieforderung die aufklärerische Prägung, dass sich nicht nur ein politisches Gemeinwesen, sondern auch das Individuum möglichst selbst regieren sollte, ohne sich einem fremden Souverän zu unterwerfen.32 Wie kein anderer Philosoph vor ihm hat dann schließlich Kant die Selbstreflexion und Selbstbestimmung des Individuums auch explizit an das Grundprinzip der Autonomie gebunden. Seine Philosophie überträgt den politischen Leitgedanken der Selbständigkeit in das praktische und theoretische Feld: Aus der legislatorischen Selbstverwaltung wird bei Kant die subjektiv-rationale Selbstgesetzgebung des Handelns sowie die Selbstbestimmung der Vernunft. Im Opus Postumum bringt Kant seine Philosophie ganz auf den Begriff der Autonomie: »Die Transscendentalphilosophie ist Autonomie« (Kant 1963, 57).
Kant brachte mit der Verbindung von Vernunft und Autonomie ein bereits bestehendes Ideal der Aufklärung auf den Punkt. Es artikuliert sich beispielsweise in Descartes’ radikalem Zweifel, mit dem die Meditationen beginnen. Dort nimmt Descartes sich vor, »Alles zu verwerfen, wo ich irgendeinen Grund zum Zweifel antreffen werde« (Descartes 1992, 1). Bemerkenswert ist vor allem, dass Descartes den Zweifel methodisch nutzen will, um zu sicherem Wissen zu gelangen. Dieses Vorgehen impliziert, was der Autonomiebegriff auf den Punkt bringt: Die Vernunft kann für »Alles« einen Grund einfordern und trägt daher, wenn es nötig erscheint, den Zweifel sogar von außen – »methodisch« – an die Sache heran, um sie kritisch zu prüfen.
Descartes zählt nicht zur Moderne, wie sie hier verstanden wird. Er sucht ein Fundament des Wissens und räumt der Kritik somit nicht den obersten Rang ein, der hier als kennzeichnend für die Moderne genommen wird. Gleichwohl zeichnet seine Philosophie, an der Schwelle zur Moderne stehend, bereits den starken modernen Begriff der Autonomie vor. Descartes beschreibt das umfassende kritische Potenzial der Vernunft, indem er ihr die Autorität zuspricht, methodisch alles in Zweifel zu ziehen. Diese umfassende Autorität koppelt Descartes jedoch an einen Grundbegriff, der für die spätere philosophische Diskussion der Moderne dann auch wesentlich prägender wurde als der Autonomiebegriff: das Subjekt.
Erneut gelesen, fällt am bereits zitierten Anfang der Meditationen auf, dass Descartes alles verwerfen will, »wo ich irgendeinen Grund zum Zweifel antreffen werde« (Descartes 1992, 1, meine Hervorhebung). Descartes radikalisiert den sokratischen Gedanken der vernünftigen Selbstprüfung, indem er dieser mit dem Subjekt einen privilegierten Ort zuweist. Denn das Subjekt ist vor allem ein topologischer Begriff: Mit ihm wird alles zum Gegenstand kritischer Prüfung und Reflexion, sofern