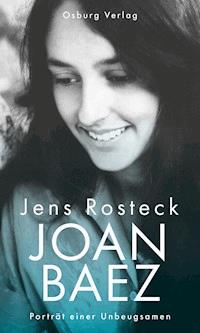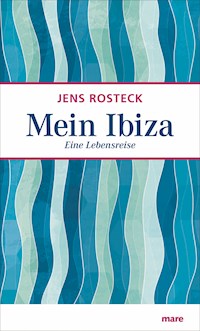16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die größte Freiheit ist, man selbst zu sein." Jeanne Moreau Jeanne Moreau prägte die Leinwand und das internationale Kino des 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere Schauspielerin ihrer Ära. Sie wird in einem Atemzug mit Romy Schneider, Catherine Deneuve oder Brigitte Bardot genannt und wurde von Orson Welles als Ausnahme-Mimin verehrt. Jeanne Moreau drehte mit den großen Regisseuren der Nouvelle Vague und des Autorenkinos wie Louis Malle, François Truffaut, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni, Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders. Sie war eng befreundet mit Marguerite Duras und die Geliebte von Peter Handke. Jens Rosteck zeichnet das faszinierende Porträt dieser verwegenen Künstlerin, die vielen Frauen mit ihrer Unabhängigkeit als Vorbild diente: emanzipiert, weise, abgründig, aufmüpfig, majestätisch und in höchstem Maße erotisch. Eine Legende des europäischen Films.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Jens Rosteck
Jens Rosteck, 1962 geboren, lebte viele Jahre in Paris und an der Côte d’Azur, wo er begann, eine Reihe von literarischen Biographien zu verfassen, etwa über Lotte Lenya und Kurt Weill, Oscar Wilde, Bob Dylan, Édith Piaf, Jacques Brel und Marguerite Duras. Zuletzt publizierte er die weltweit ersten, viel beachteten Monographien über Hans Werner Henze und Joan Baez. Der promovierte Musikwissenschaftler, Kulturgeschichtler, Übersetzer, Autor und Pianist wohnt heute im Badischen.Mehr zum Autor unter www.jensrosteck.de
Informationen zum Buch
»Die größte Freiheit ist, man selbst zu sein.« Jeanne Moreau
Jeanne Moreau prägte die Leinwand und das internationale Kino des 20. Jahrhunderts wie kaum eine andere Schauspielerin ihrer Ära. Sie wird in einem Atemzug mit Romy Schneider, Catherine Deneuve oder Brigitte Bardot genannt und wurde von Orson Welles als Ausnahme-Mimin verehrt. Jeanne Moreau drehte mit den großen Regisseuren der Nouvelle Vague und des Autorenkinos wie Louis Malle, François Truffaut, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni, Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders. Sie war eng befreundet mit Marguerite Duras und die Geliebte von Peter Handke. Jens Rosteck zeichnet das faszinierende Porträt dieser verwegenen Künstlerin, die vielen Frauen mit ihrer Unabhängigkeit als Vorbild diente: emanzipiert, weise, abgründig, aufmüpfig, majestätisch und in höchstem Maße erotisch. Eine Legende des europäischen Films.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jens Rosteck
Die Verwegene Jeanne Moreau
Die Biographie
Inhaltsübersicht
Über Jens Rosteck
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Verstörende – Eine Frau mit tausend Gesichtern
Die Nachtwandelnde – Mit Miles Davis auf den Champs-Élysées
Die Ungewollte – »Ich bin niemandes Tochter«
Die Ehrgeizige – Eine Ohrfeige von Jean Gabin
Die Abgründige – Ein Abschiedsbrief für Marcello Mastroianni
Die Schwankende – Auf Rachefeldzug – mit Pfeil und Bogen
Die Ausgelassene – Auf Beutejagd mit Jean-Paul Belmondo
Die Begehrte – Auge in Auge mit Orson Welles
Die Etablierte? – Eine Rumba mit Marguerite Duras
Die Störrische – Beim Austernschmaus mit Gérard Depardieu
Die Königin – Zweihundert weiße Rosen von Rainer Werner Fassbinder
Die Unbekümmerte – Jeanne Moreau als Chanson-Interpretin
Die Experimentierfreudige – Applaus für die Grande Dame des Autorenfilms
Anhang
Ausgewählte Literatur und Quellen
Publikationen von Jeanne Moreau
Biographien, Monographien, Werkschauen und Sonderhefte zu Jeanne Moreau
Bücher zum zeit-, literatur- und filmgeschichtlichen Umfeld, Sammelbände und Anthologien, Romane und Memoiren
Aufsätze, Artikel, Würdigungen, Hommagen, Nachrufe, Reportagen und Interviews
Filmographie
Zeittafel: Theatrographie und Auszeichnungen
Diskographie
Solo-Alben
Soundtracks & einzelne Film-Chansons
Außerdem
Zusammenstellungen & Cover-Versionen
Hörbücher
Danksagung
Bildteil
Bildnachweis
Impressum
»Die größte Freiheit ist, man selbst zu sein.«
JEANNE MOREAU
»Das Bett ist doch der letzte Ort,
an dem man keinen Vorschriften folgen,
keine Bedingungen stellen muss,
bis die Kirchglocken läuten
und das Krustenbrot mit dem weichen Ziegenkäse
vor der Tür steht.
Jeanne Moreau, die Zigarette danach –
Was waren das für Siegeszeichen aus einer Welt,
die sicher sein konnte,
dass nur die Sonne Zeuge war
und sonst niemand.«
SIMON STRAUSS,SIEBEN NÄCHTE
»Die morbide Zierlichkeit Jeannes [zieht] manchen sehnsüchtigen Blick auf sich. Bisweilen gibt sie einen davon seelenvertieft zurück; sie kann ihre Augen aufschluchzen lassen, wenn sie will; es ist entwaffnend und rührt an das Gefährlichste in uns: die Zärtlichkeit.«
GREGOR VON REZZORI
Die VerstörendeEine Frau mit tausend Gesichtern
»Ich unterwerfe mich gern, aber ich suche mir aus, bei wem.«
Seit Jahrzehnten wird Jeanne Moreau, die erst vor Kurzem hochbetagt in Paris verstorben ist, in einem Atemzug mit zwei Handvoll anderer großer französischer Schauspielerinnen und Filmstars genannt: Wie Danielle Darrieux, Michèle Morgan, Arletty, Simone Signoret, Romy Schneider und Annie Girardot – unter den bereits Verflossenen – und wie Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Anouk Aimée, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Juliette Binoche und Fanny Ardant – unter den noch Lebenden – zählt sie zu den Legenden des »cinéma français«. Zu jener kleinen Gruppe markanter, ja mythischer und vor allem unverwechselbarer Darstellerinnen aus Frankreich, die weit über ihr Heimatland und über Europa hinaus dem Kino jenseits des Rheins zu Weltgeltung verhalfen.
Wie die Vorgenannten besaß sie – Inbegriff der vollendeten Charakterschauspielerin – ein wahrhaft einzigartiges Gesicht samt nuanciertem Ausdrucksspektrum, bot Züge dar, die sich für alle Zeiten einprägten, verfügte über eine Gestik, Mimik, Grazie und Schauspieltechniken, die nur ihr allein zu gehören schienen. Hinzu kamen eine außergewöhnliche Intelligenz und Eleganz sowie eine raue, eher spröde Schönheit. Man rechnete sie von Anfang an zu den sogenannten belles laides, mithin zu jenen nicht wirklich Gutaussehenden, dafür umso mehr Faszinierenden, die »ein Touch interessanter Hässlichkeit« auszeichnet. Ferner prägte sie eine gewisse kontrollierte und dennoch reizvolle Art sich zu bewegen, mit der sie unbeirrt durch sieben Dekaden der Filmgeschichte schritt, zeichnete sie eine intellektuelle Verführungskunst ohnegleichen aus, eine ureigene Ironie und Laszivität. Mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein, gepaart mit Nonchalance, wartete sie auf, mit einem wissenden, zuweilen verächtlichen Lächeln.
Weitere Zutaten: eine Prise Arroganz, ein Quäntchen Übermut. Der Begriff Souveränität schien für sie allein erfunden worden zu sein. Ihr gefeierter »asymmetrischer Lippenschwung« trug des Weiteren zu ihrem Ruhm bei. So wie ihre hohe, gewölbte Stirn, ihre hellbraunen Augen, ihre abwärts weisenden, tieftraurigen Mundwinkel, ihre »zu kurz geratene« Oberlippe und ihre immer ein wenig umschatteten Augen. Genauso wie ihre unvergessliche, suggestive und dunkel-sinnliche Stimme, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht: erst, bis in die frühen Siebziger Jahre, munter und kokett, ab und an gehaucht, aufreizend und verheißungsvoll, später zusehends heiser und rauchig, ein bisschen verrucht, am Lebensende dann dämonisch, ja elektrisierend. Eine Stimme mit Suchtpotenzial.
Schon bald, kaum dass ihr »Entdecker« Louis Malle sie so zu zeigen verstand, dass sie endlich alle Register ihrer Kunst ziehen konnte, nahm »la Moreau« eine herausgehobene Stellung ein, setzte sich ab, wurde zu etwas Besonderem. »Une actrice pas comme les autres«, ganz anders als andere Schauspielerinnen, war sie bereits als Endzwanzigerin: eine zutiefst ungewöhnliche Darstellerin. Unretuschierbar. Ohne Vorbild, ohne Nachfolgerin. Mit schneller Auffassungsgabe gesegnet. Keinem Trend verpflichtet. Eigensinnig, versonnen. Sphinxhaft. Nicht zu vereinnahmen und kaum klassifizierbar.
Weniger Diva als ausgereifte Persönlichkeit, manchmal Femme Fatale, selten Göttin, nie auf ihre körperlichen Vorzüge beschränktes Püppchen oder gar vordergründige Sexbombe, war sie – und das schon gleich zu Beginn ihrer Laufbahn – ein echter Magnet. Und außerdem eine eher trügerische Projektionsfläche für maskuline Begierden. Die Männer in ihren Filmen mühten sich redlich ab. Lagen ihr zu Füßen, fraßen ihr aus der Hand, ließen sich von ihr um den Finger wickeln oder redeten sich um Kopf und Kragen. Umgarnten sie vergeblich, nahmen Erniedrigungen hin. Selbst ein Beau, ein Charmeur oder ein Charismatiker hatte bei ihr keine echte Chance. Besitzen konnten sie die stolze Einzelgängerin, die, im »richtigen Leben«, noch im hohen Alter ausschließlich als »Mademoiselle Moreau« angesprochen werden wollte, niemals. Oder nur für die Dauer einer Liebesnacht, einer Filmsequenz.
Im selben Moment, wo eine Kamera auf sie gerichtet war oder sich der Bühnenvorhang für sie hob, war die Aura der Moreau allgegenwärtig, kam ihre Magie mit aller Macht zum Tragen. Diese grazile, im Alltag eher unauffällige Pariserin, der man schon bald die »Ausstrahlung einer Löwin« nachsagte, entstammte einer französisch-britischen Mésalliance. Mit einem kunstfeindlich eingestellten Vater aus der Auvergne, dem das Glück als Gastwirt am Montmartre nicht lange hold war, und einer sich in Frankreich kaum jemals heimisch fühlenden englischen Mutter, die ihrer ältesten Tochter wegen eine Laufbahn als Tänzerin und Revuegirl frühzeitig abbrach, waren die Startbedingungen im Elternhaus, noch dazu in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit, alles andere als günstig. Von Kindesbeinen an vertraute sie, eine Außenseiterin par excellence, daher allein ihrer Intuition, kam ohne Hilfe und Unterstützung aus, legte eine Kämpfernatur an den Tag. Sie entfaltete eine Willenskraft, die ihresgleichen suchte. Auch von Widrigkeiten und Widerständen ließ sie sich nicht aufhalten, mobilisierte beachtliche Energien, setzte sich letztlich durch. Und, mit Anfang Dreißig, als sie fast am Ziel ihrer Karriereträume angelangt war, hatte sie es erst recht nicht mehr nötig, sich in erster Linie auf gefällige Weiblichkeit, auf ihr Dekolleté, ihren Hüftschwung oder auf den vordergründigen Glamour von Hollywood oder Cannes zu verlassen – wenngleich sie auch ihn gelegentlich einzusetzen wusste, obschon sie auch dort ein wenig mitmischte.
Bereits in ihren Anfängen verweigerte sie sich dem gängigen Beuteschema der Mittfünfziger und frühen Sechziger, ließ sich nicht auf den in jenen Jahren sehr geschätzten Typus Busenwunder (einfältig plappernd, infantil, unbedarft) reduzieren. An ihr war nichts Nymphenhaftes. Die von ihr verkörperten Lebedamen, Fräuleins, Liebhaberinnen und Gattinnen waren, im Gegenzug, durchweg smart, clever und hellsichtig. Verstanden sich aufs Nachdenken wie Pläneschmieden. Verhielten sich uneindeutig statt zweideutig. Zwar ließen sie sich zum Schein auf so manchen Flirt ein, drehten dann jedoch den Spieß nach Belieben um und gingen einfach selbst auf die Jagd – nach Begleitern, nach schnellem Geld, nach Glück, nach Ideen und Lebensinhalten. Nach wirklich bedeutsamen Veränderungen. Auf diese Weise hatten die gebannten Zuschauer in jener künstlerisch aufregenden Epoche mit ihr eine mal distanzierte, abweisende und rätselhafte, mal gleichgültig-desinteressierte, dann wieder ausgekochte, spöttische und bisweilen beinahe perverse Frauengestalt vor sich.
Jeanne Moreau, Jahrgang 1928: eine verwundbare, seltsam somnambule und zugleich machtbewusste Frau, die einfach zwingend auf die Leinwand und in die Kinosäle zu gehören schien, wo sie Menschen auf dem gesamten Globus, allein mit ihrem Gang und ihren Blicken, unmittelbar zu hypnotisieren, zu verwirren und zu fesseln verstand. Ab den späten 1940er Jahren bis in ihr neunzigstes Lebensjahr. Von ihren ersten filmischen Gehversuchen beim Gangster-Dramolett Wenn es Nacht wird in Paris über ihren Theatertriumph in Kleists Prinz von Homburg bis zu Luc Bessons Kassenerfolg Nikita. Von ihrem spektakulären Durchbruch mit Fahrstuhl zum Schafott bis zu ihren Starrollen auf dem Höhepunkt ihres Wirkens, als sie etwa als launenhafte Eva in Joseph Loseys gleichnamiger Verfilmung brillierte. Von ihren Ausflügen in den Historienfilm (The Great Catherine) über ambitionierte Literaturverfilmungen (Moderato cantabile; Der Prozess; Falstaff) bis zu den Hommagen, die ihr Fassbinder in Querelle und Wenders in Bis ans Ende der Welt zuteil werden ließen. Von der Ära des Film noir, der B-Movies und der Nouvelle Vague über wenige Verlegenheitswerke der Achtziger und Neunziger bis in unsere Tage.
***
Einordnen ließ sie sich nur schwer. Viele Rubrizierungsversuche schlugen fehl, wiesen in die Irre. Schlagworte wurden in Umlauf gebracht, darunter einige wirklich schöne Bonmots: »Frankreichs Bette Davis«, »belle dame sans merci«, »die Sarah Bernhardt ihrer Generation«, »the Garbo of the ›in‹-movie crowd«, »die Katzenhafte«, »Leinwandgöttin ohne Lippenstift«, »die Frau, die immer erst im Morgengrauen nach Hause kommt«, »Marilyn Moreau«. Griffige und im Kern auch stimmige Formulierungen, mit denen man, sah man einmal genauer hin, doch immer nur einem Einzelaspekt gerecht wurde und nicht der »ganzen Frau«. Moreau scherte sich wenig um solche Etikettierungen.
Sie, die von einem Genie wie Orson Welles, das nur selten anderen Mitstreitern Qualitäten zubilligte, als Ausnahme-Mimin bewundert und verehrt wurde, drehte, als wäre es das Normalste auf der Welt, mit den ganz Großen unter den Regisseuren des 20. und 21.Jahrhunderts: neben Welles und Elia Kazan mit Luis Buñuel, Theo Angelopoulos und Wim Wenders, mit Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni und François Ozon, mit Louis Malle, François Truffaut und Joseph Losey, mit Marguerite Duras, Jean-Luc Godard und André Téchiné, mit Bertrand Blier, Tony Richardson, Amos Gitai und Marcel Ophüls, um nur die prominentesten zu nennen. Eine erstaunliche, noch in der Rückschau kaum glaubhafte Galerie.
Und sie spielte in deren Streifen – unter ihnen zahlreiche Klassiker und Meilensteine der Filmgeschichte, wenig Mittelmäßiges, aber auch schwer Zugängliches und in Maßen Avantgardistisches – fast ausnahmslos Hauptrollen. Enigmatische, stolze und abgründige Protagonistinnen, sachlich-kühle und kluge Bürgerinnen, doppelbödige und dominierende Charaktere, mokante und manipulierende Damen, unbarmherzige Sadistinnen, fragile und berührende Mädchen. Immer wieder Mondäne und Großspurige. Am liebsten aber unberechenbare, herausfordernde Menschen. Amoralische, heimtückische und verdorbene Frauen. Müde, Lebensmüde und Gierige. Grenzgängerinnen und Überforderte. Verwöhnte und Verwüstete. Komplexe Chaotinnen. Männermordende und Verschlagene. Gnadenlose und Skrupellose. Beherrschte und Herrschsüchtige. Seelisch Beschädigte, die sich nicht scheuen, ihrerseits anderen Schaden zuzufügen. Jägerinnen, die nicht um Erlaubnis bitten, sich ihre Beute zu schnappen. Bis hin zu Vamps und weiblichen Vampiren.
Dass die so überaus wandlungsfähige und sich ununterbrochen perfektionierende Moreau, zeitweilig »die« Muse der Nouvelle-Vague-Rebellen und Bilderstürmer, die verständige Komplizin eigenwilliger, ja obsessiver Regisseure sowie eine der Galionsfiguren des frühen europäischen Autorenkinos, auch über lange Jahre hin eine herausragende Theaterdarstellerin gewesen ist, geriet, bei all ihren Kino-Aktivitäten, phasenweise fast in Vergessenheit oder aus dem Blickfeld. Man denke nur an ihre bemerkenswerten Auftritte als jugendlicher Theaterzögling neben dem unvergessenen Gérard Philipe, an ihre Erscheinung als Sphinx in der Pariser Inszenierung von Jean Cocteaus Höllenmaschine an der Seite von Jean Marais oder an ihr aufsehenerregendes Spiel in Tennessee Williams’ – damals als Schocker empfundenem – Drama Die Katze auf dem heißen Blechdach. Oder an ihre eindrucksvolle, überall sofort akklamierte Darbietung auf den Bühnen Europas als alternde, Selbstgespräche führende Magd Zerline nach Hermann Broch. Geschult hatte sie sich als noch ganz junges, vielversprechendes Talent aus eigenem Antrieb: sowohl an der altehrwürdigen Comédie-Française als auch am experimentellen Théâtre National Populaire unter Jean Vilar. In Paris wie in Avignon. Shakespeare, Beaumarchais und Feydeau, Shaw, Molière und auch Kleist schauten ihr über die Schulter, wie sie sich – hochbegabt, zielstrebig, systematisch – ihre Sporen verdiente.
Umso präsenter ist Jeanne den Filmfans und Nachgeborenen als extravagante Sängerin (auch in etlichen Film-Chansons zu hören), als kecke Liedinterpretin und frivole Chansonette. Als prägnante Stimme aus dem Off und Voice-Over, als versierte Récitante und als begnadete Erzählerin – mit »näselnd-kratzigem«, ja liebenswert kratzbürstigem Timbre, an dem ihr unablässiger Zigarettengenuss nicht ganz unschuldig ist. Umso präsenter ist heutigen Cinéasten ihre fortwährende Verdrossenheit, ihre schnippische Attitüde und ihr berühmter »Flunsch«, den sie mit einem sekundenlangen Lächeln im Nu wegzuzaubern vermochte. Legendär wurde ihr oft undurchschaubares Schmollen und undurchdringliches Vor-sich-hin-Starren. Mitsamt einem überdeutlich zur Schau gestellten Ennui. Nicht zuletzt erinnert man sich freilich gern an sie als darstellerisches Alter Ego einer ihrer engen Freundinnen, der so unbequemen wie anziehenden Schriftstellerin Marguerite Duras. Unbequem und anziehend, rebellisch und herablassend, elegisch und unabhängig, brandgefährlich und respekteinflößend: das sind die Wesensmerkmale der Duras. Und eben auch jene Attribute, die sowohl auf die Debütantin Moreau als auch auf die Greisin Moreau zutreffen. Mit denen man sie augenblicklich assoziiert. Derentwegen man für sie schwärmt.
Gleich ihr zweiter großer Film, Louis Malles Les Amants (Die Liebenden), wuchs sich zu einem handfesten Skandal aus. Aufgrund einer unerhörten, einstmals berüchtigten Szenenfolge: einer nie expliziten, doch ausführlich dargebotenen und poetisch gestalteten Liebesnacht, in der eine wohlhabende Gelangweilte sich einer männlichen Zufallsbekanntschaft hingibt. Ein kühner Fremder vermag es, bei diesem Luxusgeschöpf endlich echte Begierde zu wecken und ihr, einer freudlos Verheirateten, grenzenlose Lust zu verschaffen. Mit ihm entdeckt sie – in ihrem eigenen Haus, unter dem Dach ihres düpierten Ehemannes – nie gekannte Empfindungen wie Zärtlichkeit und Vertrauen. Binnen weniger Stunden vollzieht sich eine tiefgreifende Wandlung – die Beobachterin wird zur Handelnden. Ein Befreiungsschlag: Aus einer belanglosen Existenz macht sie, mit Hilfe ihres neuen Geliebten, eine sinnerfüllte. Dass diese einstmals verwöhnte, jetzt befreite Gattin mit einem Nobody in der Schlusssequenz durchbrennt und, urplötzlich liebesfähig, damit aus dem Gefängnis ihrer Ehe entflieht, stellte für viele Zuschauer bereits eine gewagte Wendung dar. Dass sie dann auch noch ihr (Film-)Kind im Stich lässt, fand man empörend und unerträglich. Und setzte, wie so oft in der Geschichte des Kinos, Rolle und Interpretin in eins. Fortan eilte der Moreau ein zweifelhafter Ruf voraus: der einer moralisch Fragwürdigen. Der einer Unanständigen.
Zwischenzeitlich war sie somit – womöglich länger, als es ihr guttat – auf den Part der frustrierten Gattin, die aus einer Wohlstandsehe auszubrechen versuchte und den lähmenden Status quo der Konventionen um jeden Preis überwinden wollte, wie abonniert. Schien beim Casting auf die Rolle der Ehebrecherin, die ihre sexuellen Eskapaden mit Hingabe auskostet, festgelegt. Auf das Image einer Frau, hinter deren bourgeoiser Fassade es gehörig brodelt, die notfalls auch vor der Anstiftung zu einer Bluttat nicht zurückschreckt – und der selbst ein Marcello Mastroianni oder ein Oskar Werner nichts mehr bieten kann. Die Lustlose und Lethargische, ihrer Zwänge Überdrüssige und sich nach Exzessen förmlich Sehnende – vorübergehend ihre Paraderolle. Auch in die Schublade der Vernichtenden und Grausamen, der Zerstörerischen, Mitleidlosen und Demütigenden versuchte man sie zu sperren. Als Inkarnation des Bösen, als Racheengel. Dabei lagen ihr Freizügigkeit und Anarchie wie keiner Zweiten, gehörten disziplinierte Anmut, unverhohlener Sarkasmus wie kompromisslose Professionalität zu ihren Kardinaltugenden, ging sie bei der Gestaltung ihrer Charaktere mit untrüglichem Instinkt zu Werke. Rasch emanzipierte sie sich von Klischees, erweiterte ihr Spektrum, gab sich ungestüm und temperamentvoll, überraschte ihre Anhänger wie sich selbst, gewann – als Inbegriff der ausgefuchsten Komödiantin – selbst im hohen Alter noch an Reife hinzu. Und an Natürlichkeit.
Unübersehbarer Ehrgeiz und extreme Widersprüchlichkeit, Feinfühligkeit und Differenziertheit, unerbittliche Würde und innere Zerrissenheit, erschreckende Boshaftigkeit und verblüffende Selbstbestimmtheit – mit solchen Zuschreibungen und Gegensatzpaaren sind bereits ihre zentralen Facetten benannt. Im Laufe der Jahre, im Laufe der Filme wurde Jeanne zum Prototyp einer Anstößigen, die ihren unbeherrschbaren Impulsen und verborgenen Lüsten allmählich das Vordringen an die Oberfläche ihres Handelns ermöglicht, um sie, sobald spürbar geworden, augenblicklich wie eine Selbstverständlichkeit zu behandeln und damit alles potenziell Schockierende so präzise wie berechnend darzubieten.
Dabei blieb sie stets klar und eindeutig im Ausdruck. Ihre mimischen wie sprachlichen Mittel setzte sie durchweg gezielt und subtil ein. Was insbesondere in der ersten Hälfte ihres Schaffens, als sie vornehmlich in Schwarz-Weiß-Filmen eingesetzt wurde, trefflich zur Geltung kam. Ihr konzentriertes, effektives Mienenspiel etwa – ein kaum merkliches Heben der Augenbrauen, ein herzloses Zucken der Mundwinkel, ein durchdringender, völlig leerer oder vielsagender Blick, eine kurze Bewegung der Schultern, ein unvermitteltes Rucken des Kopfes, ein schlaues Lächeln, eine geringfügig veränderte Körperhaltung, eine bestimmte Art und Weise, den Raum zu durchmessen – wies sie als eine Meisterin der Zwischentöne aus. Ihre Diktion schwankte, je nach Erfordernis, zwischen geheimnisvollem Raunen, kaum hörbarem Wispern und verschwörerischem Flüstern, gedankenverlorenem Parlando, arglistiger Schmeichelei und schneidendem Befehlston.
»Sympathisch« zu sein oder einfach nur nett und liebenswürdig, besaß für sie keinen großen Stellenwert. Freundlichkeit oder Nettigkeit war für sie kein Wert an sich. Und wirklich charmant, ausschließlich naiv, schalkhaft und vergnügt oder ausgesprochen hysterisch trat der Weltstar Moreau freilich so gut wie nie vor ihre Fans. Mit vier gewichtigen Ausnahmen: als verspielte Catherine und lachende Dritte in Truffauts Jules et Jim, als spitzbübische Cathy in Marcel Ophüls’ Peau de banane, als mal revolutionäre, mal angriffslustige Striptease-Erfinderin in Malles Mexiko-Burleske Viva Maria! und als giftige, schimpfende und gichtig am Strand entlang staksende Lady M. in Laurent Heynemanns gezielt obszöner Komödie Die Dame, die im Meer spazierte.
***
Es wird, wie ich finde, höchste Zeit für ein detailliertes Porträt dieser ungemein fleißigen Künstlerin, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang die wohl bedeutendste Vertreterin französischer Filmkunst war: dem Urteil namhafter Kritiker zufolge und auch hinsichtlich der Treue und Gunst des Publikums. Nicht weniger als 135 Filme drehte sie, »la femme aux milles visages«, war noch im hohen Alter als Sprecherin, TV-Akteurin und Interviewgast aktiv, bis sie Ende Juli 2017 als 89-Jährige starb. Neben dieser Arbeitswütigen glänzten Granden des Weltkinos wie Jean Gabin und Fernandel, Jean-Paul Belmondo und Anthony Perkins, Gérard Depardieu und Brigitte Bardot, Alain Delon und Marion Cotillard, Tony Curtis und Lino Ventura, Alida Villa und Lucia Bosè in weiteren Hauptrollen. Doch war es zumeist ihr Name, der zuerst auf den Schautafeln und Plakaten prangte und auch als erster im Vorspann genannt wurde. Und man hatte, selbst wenn die Moreau lediglich für eine kurze Szene oder Einstellung auf der Leinwand erschien, Augen nur für sie. Ihr künstlerisches Herz schlug indessen keinesfalls für Mainstream-Produktionen. Für Tastversuche von Debütanten war sie sich ebenso wenig zu schade wie für hoffnungslos unterfinanzierte, waghalsige Kinoexperimente.
Nahezu »nebenbei« spielte sie ein halbes Dutzend Alben ein, lieh literarischen Gestalten in Audiobooks und Radiofeatures ihre Stimme, unterwarf sich in Film und Fernsehen der Regie von Egozentrikern und Eintagsfliegen, und ihre Mitwirkungen in hochkarätigen Theater-Inszenierungen, in Stücken von Frank Wedekind, Heiner Müller, Tennessee Williams, Peter Handke, Jean Genet oder Prosper Mérimée sind Legion. In Deutschland genießen die Moreau und ihre Darstellungskunst seit Jahr und Tag hohes Ansehen. Und schon recht früh auf ihrem Parcours wurden ihr in ihrer französischen Heimat wie im internationalen Ausland viele Ehrungen zuteil (Ehrendoktorwürden und Mitgliedschaften in Akademien, Theater- und Filmpreise: Césars, Oscar, Molière).
Noch wichtiger: Vielen ihrer Generationsgenossinnen diente sie als Vorbild und ist seither auch, durch ihre Arbeitsauffassung und ihr Spiel, durch ihre unnachahmliche Präsenz und Genauigkeit und durch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, für ein sich wandelndes Bild und Verständnis von Weiblichkeit verantwortlich: autonom, emanzipiert, amüsiert und gelassen, in Ansätzen weise, gelegentlich aufmüpfig, eigentlich immer kettenrauchend, ja zigarettenverschlingend, oftmals hinreißend inkonsequent, nicht selten majestätisch und dennoch in höchstem Maße erotisch. Ihr Radius reicht weit über Frankreich oder den westlichen Kulturkreis hinaus – und das, obwohl sie Welten von einer Monroe und einer Loren, von einer Bardot oder einer Lollobrigida trennten.
An ihrem Verhalten und Auftreten, an ihrer Wortwahl und Gestik, an ihrem Erscheinungsbild und auch an ihrem Modebewusstsein ließen sich die Entwicklungsstufen moderner Frauen von den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg über die biederen Fünfziger, die vorlauten, ausgeflippten Sechziger, die knallbunten Siebziger und die wohlständigen Achtziger bis in die Jetztzeit geradezu idealtypisch ablesen. Analysierte man, wie Jeanne je nach Filmstil, Ästhetik und Dekade agierte und changierte, registrierte man, was sie trug, so war es, als blickte man in einen Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. So nahm man sie zwar durchaus auch als Ikone wahr, modellhaft und tonangebend, als Repräsentantin eines rasch wechselnden Lebensstils. Weitaus häufiger wirkte sie auf ihre Umgebung hingegen als »Frau von heute« – eine Frau, die Signale aussendet und anderen Frauen etwas mitzuteilen hat. Oder als jemand, der dem Zeitgeist vielleicht doch einen winzigen, wichtigen Schritt voraus ist. Ihr »Typus« wirkte immer auch wie ein Gradmesser für die jeweilige gesellschaftliche Befindlichkeit.
Wer, von ihr an die Hand genommen, durch die europäische Filmlandschaft von 1949 bis 2015 wanderte – und in dieses fabelhafte Abenteuer stürzten sich Generationen von Kinogängern, ohne extra dazu überredet werden zu müssen –, der durfte die Jahrhundertschauspielerin Moreau in den unwahrscheinlichsten Posen, Rollen und Kostümen erleben. In so unterschiedlichen Kinowerken wie Gilles Grangiers Gas-oil und John Frankenheimers The Train. Als platinblonde Sünderin etwa, die Schicksal und Glück beim Roulette in den Casinos von Nizza und Monte-Carlo aufs Spiel setzt (in Jacques Demys Die Engelsbucht). Als vom Hass zerfressene Witwe und diabolische Rächerin in Truffauts Die Braut trug schwarz. Als Arglosigkeit vortäuschende, in Wahrheit destruktive Dorflehrerin auf den Spuren von Jean Genet (Mademoiselle). Als raffinierte Intrigantin, Seite an Seite mit dem nicht minder maliziösen Gérard Philipe (Gefährliche Liebschaften). Als mal todgeweihte, mal liebestolle Mittvierzigerin in Bertrand Bliers provokativem Roadmovie Die Ausgebufften. Als Selbstzitat in Paul Mazurskys Alex in Wonderland. Als in die Jahre gekommene, abgehalfterte Bordellwirtin in Fassbinders künstlichem Schwulenparadies Brest (Querelle). Als leidende, an ihrer Liebesfähigkeit zweifelnde Gattin eines versnobten Bestsellerautors (La Notte). Als Frau eines Verschwundenen in Theo Angelopoulos’ so ultralangsamer wie beeindruckender Studie Der schwebende Schritt des Storches. Und, last but not least, als unwirsche, trotzdem verständnisvolle Großmutter, deren Einstellung zum Lebensende zwischen Gebrochenheit und Zynismus schwankt: in François Ozons Die Zeit die bleibt.
Zu sehen war sie aber auch in Peter Handkes Die Abwesenheit und, erkennbar für Eingeweihte, mit zwei flapsigen Cameo-Auftritten, in Truffauts Sie küssten und sie schlugen ihn und Godards Eine Frau ist eine Frau. Und zu hören in Jean-Jacques Annauds Duras-Bearbeitung des exotischen Indochina-Klassikers Der Liebhaber sowie in Ophüls’ schockierender Kriegsgräuel-Dokumentation Hotel Terminus: als Meisterin der Off-Monologe. Zu bestaunen war sie als Filmpartnerin etwa von Louis de Funès, Madeleine Renaud und Monica Vitti, von Romy Schneider und Bernhard Wicki, von Michel Piccoli, Burt Lancaster und Robert de Niro. Ferner konnte man die Moreau, in weniger bekannten Streifen, in recht aparten Rollen erleben: als Krankenschwester im Dienst von Albert Schweitzer, als schillernde Spionin Mata Hari, als glaubensstrenge Karmelitin in den Revolutionswirren, als Prostituierte in Brasilien sowie, als Rolls-Royce-Insassin und Ehefrau von Rex Harrison, beim Seitensprung auf der Limousinen-Rückbank. Noch den unsympathischsten Figuren vermochte sie dabei Leben einzuhauchen und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Und darüber hinaus trat sie, eher unvermutet, als Regisseurin von drei eigenen, recht anspruchsvollen Filmen in Erscheinung. In denen sie sich mit den Bedingungen des Filmemachens, der Schauspielerei und des Starkults auseinandersetzt, das Gefühlsleben einer Heranwachsenden seziert oder einer Leinwandgöttin aus der frühen Ära des Kinos ihre Reverenz erweist.
Bei diesem furiosen Tempo mitzuhalten, gelang wohl nur den wenigsten unter ihren Mitmenschen und Verehrern. War bei einem solchen Pensum überhaupt noch Zeit und Platz im Leben der Moreau für Austausch und Gemeinsamkeiten, für eine echte Partnerschaft? Als Ruhepol dienten ihr zum einen ihre Domizile: ihr Anwesen im Westen der Côte d’Azur, im Hinterland von Saint-Tropez, sowie ihre verschiedenen Pariser Wohnsitze, beiderseits der Seine. Und zum anderen die Männer: So soll auch die Moreau als »privat« Liebende in meinem Porträt nicht zu kurz kommen. Von ihrer früh beendeten ersten Ehe mit dem Drehbuchautor Jean-Louis Richard, von ihrem komplizierten, nahezu gescheiterten Muttersein (wovon ihr Sohn Jérôme ein Lied singen kann), von ihrer Liaison mit Louis Malle, von ihrer Affäre mit dem Filmemacher Tony Richardson wird ebenso die Rede sein wie auch von ihrer zweiten Ehe mit dem US-Regisseur William Friedkin nebst ihrer überraschend stabilen Partnerschaft mit dem visionären Modeschöpfer Pierre Cardin und ihrer Beziehung zu dem österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Einer dritten Hochzeit, mit einem gewissen Teodoro Roubanis, »entging« sie, Mitte der sechziger Jahre, in buchstäblich letzter Minute, indem sie die Trauung durch Nichterscheinen einfach platzen ließ.
***
So ziemlich alle Zeitgenossen waren sich in einem Punkt einig: Bei Jeanne Moreau wusste man – egal, ob vor oder hinter der Kamera, im Alltag wie auf der Leinwand – zeit ihres Lebens nie so richtig, woran man war. Man ahnte nur, was hinter ihrer blassen Stirn vorging. Vieles an ihr blieb vage. Wann immer sie konnte, leistete sie der Unbestimmtheit Vorschub. Dass nichtsdestoweniger stets etwas Beunruhigendes, Überlegenes und Erregendes von ihr ausging, dass sich Attraktivität, bezwingende Autorität und Unkontrollierbarkeit bei ihr die Waage hielten, machte sie unwiderstehlich. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang.
Somit stellt sich allein die Frage nach der angemessenen Beschreibungsmethode: Wie nähert man sich einer Unnahbaren? Wie definiert man eine schillernde Persönlichkeit, wie lässt sich eine notorisch Ambivalente einkreisen? Wie tastet man sich an das Bild einer Frau und Schauspielerin heran, die den meisten Erklärungsmustern und Deutungsversuchen bislang geschickt ausgewichen ist? Ich möchte bei meiner Nachzeichnung ihres Werdegangs einerseits der Schilderung von Momentaufnahmen den Vorzug geben – filmischen und biographischen. Standbilder sozusagen, die für die Dauer eines Kapitels »eingefroren« werden. Und andererseits Schritt für Schritt überprüfen, ob sich die Eigenschaften, mit denen man sie bisher besonders häufig in Verbindung gebracht hat, sinnvoll auf sie anwenden lassen.
Zweimal war es mir in der Vergangenheit gelungen, dicht an die Moreau heranzurücken: zunächst, Ende der achtziger Jahre, in der restlos ausverkauften Berliner Schaubühne am Lehniner Platz. Mit etwas Glück hatte ich, wenige Minuten, bevor die Lichter ausgingen, doch noch einen frei gebliebenen Platz in der ersten Reihe ergattert. Dort beherrschte sie als Magd Zerline, nur wenige Zentimeter von mir entfernt, den großen Raum und rezitierte – unaufgeregt, beiläufig, mit halblauter Stimme. Viel kleiner als erwartet kam sie mir vor. Mit lockigem, in einer Steckfrisur gebändigtem Haar, weißem Rüschenkragen und weißer Schürze, artigem Zofenkostüm und Schnürstiefeln. Ich hätte, wie man so sagt, einfach nur die Hand ausstrecken müssen und sie berühren können. Und tat es natürlich nicht. Anderthalb Stunden lang stand ich unter dem Bann ihrer Performance, einem zum Einakter umgearbeiteten Romanmonolog Brochs, und war erst einmal sprachlos. Der von ihr mit kalkulierten Pausen durchsetzte melodische Sprachfluss, mühelos und gelassen dahinströmend, hatte mich gefangengenommen und bezirzt. Ihr Vortrag hallte noch eine Weile in mir nach.
Und dann sah ich sie in meiner späteren Wahlheimat Nizza, im Rahmen einer Moreau-Retrospektive, in Jacques Demys wunderschöner Côte-d’Azur-Hommage La Baie des Anges überraschend wieder. Einem Film aus den frühen Sechzigern, der eben Nice selbst zum Schauplatz hat. Mit Jeanne als weißblond gefärbter Wiedergängerin von Jayne Mansfield und Marilyn Monroe. Mit Jeanne als Todesengel in der Engelsbucht. Als durchtriebene, pathologische Spielerin Jackie steht sie dort, in »meiner Stadt«, im Mittelpunkt des Geschehens. Als reife Mittdreißigerin, die am sonnenüberfluteten Kieselstrand der südfranzösischen Meeresmetropole ihrem jungen Geliebten und Glücksbringer Jean einen kurzen Besuch im Freien abstattet, bevor es sie wieder in die tabakgeschwängerte, stickige Luft der Casinos und an die Roulette-Tische zieht. Ausgerechnet an jenem Strandabschnitt vor den Toren der italienisch geprägten Altstadt, zwischen Oper, Blumenmarkt und Schlosshügel, wo ich mich selbst besonders gern für ein kurzes Bad oder zur Lektüre niederließ! An einen bloßen Zufall mochte ich nicht glauben.
Der Himmel in Nizza ist wolkenlos an diesem Kino-Sommertag, die Wellen locken, und die von Michel Legrands spritziger Begleitmusik verführerisch angereicherte Ferienatmosphäre lädt zum dolce far niente ein. Nichts läge näher für die Moreau und ihren Co-Star, als sich augenblicklich ins kühle Nass zu stürzen. Doch ihre Filmfigur Jackie, im eleganten hellen Cardin-Kostüm und auf Stöckelschuhen unter lauter halbnackten Badegästen und Müßiggängern ein Fremdkörper, verspürt wenig Neigung, sich auf ein Sonnenbad einzulassen oder gar schwimmen zu gehen. Ihr kribbelt es stattdessen in den Fingern. Die Aussicht auf den nächsten Coup, den nächsten Einsatz, die nächste Gelegenheit, die Croupiers auszutricksen, wirkt wie eine Droge auf sie. Mit ihrem neuen, unerfahrenen Freund, der, nur mit einer Badehose angetan, auf seinem Handtuch ruht, spielt Jackie Katz und Maus, tänzelt so lange nervös vor ihm auf und ab, bis sie ihn dazu bringen kann, sich rasch anzukleiden, eine Krawatte umzubinden und ihr, die schon in Richtung Casino davongestakst ist, wie ein dummer Junge hinterherzueilen. Vom gleißend hellen Strand direkt in die dunkle Lasterhöhle – ein Kameraschwenk genügt.
So kokett und aufgekratzt, so bezaubernd und intrigant hatte ich die Moreau noch nie gesehen oder erlebt. Wie ein schon etwas älteres amerikanisches Pin-up-Girl wirkt sie in Demys Film, wie das Abziehbild einer oberflächlichen Salonlöwin. Hinter der Fassade der tänzelnden Schickeria-Blondine verbirgt sich jedoch Verunsicherung und mangelnde Stabilität, tun sich menschliche Abgründe auf. Dem Naivling Jean – alles andere als ein Playboy oder Bonvivant – wird es eine Filmminute weiter gelingen, Jackie wieder einzuholen und ihr, von Glückssträhne zu Pechsträhne taumelnd, liebevoll eine Schulter zum Anlehnen anzubieten. Als Zuschauer ahnt man bereits jetzt, dass sie ihm stets aufs Neue entwischen wird, dass auch ein Hauptgewinn sie nicht zum Bleiben bewegen kann. Zu weit ist ihre Abhängigkeit schon fortgeschritten, ein Dasein in normalen Bahnen unmöglich geworden. Sogar ein kurzes Innehalten wird zum Ausnahmezustand. Jackie entzieht sich dem Besitzstreben ihres jugendlichen Kavaliers, nimmt Verluste in Kauf. Ehe er sich’s versieht, hat sie schon wieder die Flucht ergriffen, hat die Gelegenheit, Vertrauen zu entwickeln, rücksichtslos ausgeschlagen, hat die Chance auf Liebe oder auch nur ein wenig Zuneigung unwiderruflich verspielt.
Wie also kann man sich einer Unnahbaren nähern? Wie kann man einen Hauch Nähe herstellen und sie ein wenig zu sich heranholen? Indem man mit einer Kamera dicht und immer dichter an sie heranfährt und zoomt. Indem man sich für eine Großaufnahme entscheidet, aus der sie sich – für die Dauer einer Einstellung – vorerst nicht befreien kann. Indem man ihr Gesicht, ihre Züge und ihre Regungen in den Blick nimmt. Nichts als ihr Gesicht.
Die NachtwandelndeMit Miles Davis auf den Champs-Élysées
»Es heißt von mir, ich sei nicht artig.«
In den ersten Wochen des Jahres 1958 kam ein aufwühlender, dialogarmer Schwarzweißfilm in die französischen Filmtheater, in dem aus heiterem Himmel vieles, was bis dahin im europäischen Genre-Kino maßstabsetzend war und wie selbstverständlich zu gelten schien, radikal in Frage gestellt wurde. Angefertigt hatte ihn der gerade mal fünfundzwanzigjährige Louis Malle, für den es – nach der Mitwirkung an einem sogleich preisgekrönten Dokumentarfilm über den legendären Meeresforscher Jacques Cousteau – erst die zweite Regiearbeit war. Und zugleich die erste für einen Spielfilm. Malles ausgeprägter Stilwillen ließ augenblicklich aufhorchen, genauso wie seine Originalität und der spielerische, zitathafte Umgang mit Motiven der US-Filmtradition und des Gangster-Genres.
Reißerisch an diesem neuen Werk des Quasi-Debütanten war lediglich sein Titel: Ascenseur pour l’échafaud. Direkt übernommen von der Romanvorlage eines bulgarischen Exilanten, Noël Calef, der sich als Krimiautor in Frankreich hervorgetan hatte. Fahrstuhl zum Schafott, so seine deutsche Entsprechung, das klang vielversprechend und blutrünstig genug, um die Pariser Kinogänger in Scharen in die Kinos zu locken. Was sich also zunächst durchaus halbseiden und unseriös anhörte, wurde durch die souveräne und erstaunlich reife künstlerische Umsetzung aber rasch Lügen gestraft.
Auf den ersten Blick handelt es sich um einen raffinierten und unterhaltsamen Thriller mit starken Anklängen an die Tradition des Film noir, in dessen Zentrum eine verwickelte, spannende Ehebruchsgeschichte mit verbotener Liebe, einem geschickt ausgetüftelten Mord, schicksalhaften Ereignissen und zahlreichen Verwechslungen steht. Ein zweit-, wenn nicht drittklassiger Plot. Ein Groschenroman, dessen Versatzstücke durch die filmische Bearbeitung sozusagen geadelt werden. Amoralisch, kühl und, nur gelegentlich von schnellen Schnittfolgen unterbrochen und aufgelockert, merkwürdig langsam, ja von geradezu aufreizender Trägheit. Zwischen Expressivität, dokumentarischer Großstadtschilderung und Anklängen an den italienischen Neorealismus angesiedelt. Von einer Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben erzählend und vom tragischen Misslingen dieses schönen Plans aufgrund unglücklicher Umstände – die Chronologie eines Scheiterns, durchsetzt von kaltblütig ausgeführten Bluttaten. Extravagant und schonungslos.
Auf den zweiten Blick hat man es mit einem der ersten Vorläufer der Nouvelle Vague zu tun, zu deren mit einigen Konventionen und Standards der Filmkunst brechenden Vertretern der junge Malle, anfangs eher ein Außenseiter, auch später nicht notwendigerweise zählte. Auf den dritten Blick wird uns eine explizite Hommage an den Jazz dargeboten, bestimmt doch der ungewöhnliche und auch verführerische Soundtrack das Tempo und die Atmosphäre des Films. Coole, laszive Trompeten-Soli des seinerzeit gerade in Paris residierenden Ausnahme-Interpreten Miles Davis bilden die akustische Grundlage des Streifens, so dass die teils modalen, teils tonalen Einsprengsel dieser gestopften Trompete, kleinen Auftritten gleich, der Musik gewissermaßen die zweite Hauptrolle zuweisen. »Was [Miles Davis] machte«, so Malle, der den Musiker in einem Studio zu den bereits fertiggestellten, direkt vor ihm projizierten Filmsequenzen »live« improvisieren ließ, »war einfach verblüffend. Er verwandelte den Film. Ich erinnere mich [noch gut], wie er ohne Musik wirkte; als wir die Tonmischung fertig hatten und [Davis’] Musik hinzufügten, schien der Film plötzlich brillant.« Von einer Vertiefung der Emotionen, wie sie »Bilder und Dialog« vermittelten, durch die Jazzkommentare mochte Malle nicht sprechen, eher von einem anti-naturalistischen Effekt: Miles’ Einwürfe wirkten »kontrapunktisch, elegisch und irgendwie losgelöst«.
Auf den vierten Blick liegt ein bemerkenswertes, nüchternes Paris-Porträt vor, das mit »amerikanischen« Zutaten wie Hochhaus- und Büro-Szenen, grell ausgeleuchteten Lokalen, leergefegten, verwaisten Straßen, schicken Straßenkreuzern, Stadtautobahnen und sogar einem Motel aufwarten kann. Ein betont modernes Paris-Bild, das meilenweit entfernt ist von der so vertrauten, aber längst zum Klischee erstarrten Notre-Dame-, Montmartre- oder Eiffelturm-Romantik. Nichts mehr erinnert an den Moulin-Rouge-Kitsch der Vorgängerjahre, an die Valse-Musette-Seligkeit, an die unvermeidlichen Bootstouren auf der Seine oder an den noch immer weltweit die Vorstellungswelt beherrschenden Naturalismus von Pigalle, das raue Milieu der Édith-Piaf-Chansons oder an die Proletarier-Tristesse der Jean-Gabin-Vorstädte: Malles Paris ist eine entmenschlichte, kalt und emotionslos inszenierte Großstadt-Einöde. Ein Moloch ohne Seele. Aus dem nur eines von Beginn an prägnant hervorsticht und ihm eine zutiefst menschliche Note verleiht: das Gesicht von Jeanne Moreau – ein Gesicht, das man als Antlitz bezeichnen kann. Ein Gesicht, das vom Regisseur und seinem phänomenalen Kameramann Henri Decaë, einem Meister seines Fachs, manchmal minutenlang präsentiert, studiert, in all seinen Nuancen ausgeleuchtet und erschöpfend gefeiert wird. Dieser Film, so könnte man es zugespitzt formulieren, ist nicht mehr und nicht weniger als Malles gefilmte Aufforderung, in Jeanne Moreaus Gesicht spazieren zu gehen, es von Grund auf kennenzulernen und sich darin umzuschauen – eine Einladung, sich einzig und allein auf sie zu konzentrieren (wofür der Plot letztlich nur einen Vorwand liefert). Und gleichsam ein Befehl, in ihrer verstörten und bald auch zerstörten Seele wie in einem offenen Buch zu lesen. Mürrisch, schwermütig und sinnlich bietet es sich, bietet sie sich uns dar.
Der noch weitgehend unbekannte Louis Malle hatte Jeanne Moreau, damals in erster Linie eine versierte und auch in Fachkreisen angesehene Theaterschauspielerin, in der von dem britischen Avantgarde-Regisseur Peter Brook inszenierten, umstrittenen und heiß diskutierten französischen Erstaufführung von Tennessee Williams’ Katze auf dem heißen Blechdach im Pariser Théâtre Antoine in der Rolle der Maggie erlebt und ihr, auf der Stelle, die Hauptrolle in seiner Calef-Verfilmung angetragen. »Er schrieb mir einen Brief, in dem er mich bat, in einem Thriller mitzuwirken. Ich traf mich mit ihm.« Moreau hörte ihm aufmerksam zu und wurde neugierig auf sein Projekt. Ihr promptes Einverständnis überraschte sie dann selbst. »Ich wusste sofort, dass ich die Rolle annehmen musste.« Einwände und Vorbehalte von Ratgebern und Kollegen schlug sie in den Wind, ignorierte die Warnungen ihres wütenden Agenten, der der Meinung war, diese Kooperation mit einem Unbekannten würde ihrer Karriere schaden: »›Welche Karriere?‹, erwiderte ich und nahm mir einen anderen Agenten.« Sie ließ sich, trotz der prekären Finanzierungsbedingungen für den Film und der relativen Unerfahrenheit des Regisseurs, mit ihrer Zusage spontan auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang ein – von einer angemessenen Gage ganz zu schweigen.
Die Rechnung ging denn auch, allerdings auf ganz andere Weise, auf: Moreaus Gesicht wirkte in der Tat neu, frisch, unverbraucht, überraschend – wohl nur eingefleischte Filmliebhaber, die sich für Krimis und auch für B-Movies erwärmen konnten oder die ein Faible für gut gespielte Nebenrollen hatten, würden sich an sie, die schon in wenigen guten, meist aber in einigen mittelmäßigen, kurzlebigen Streifen auf der Leinwand zu sehen gewesen war, überhaupt erinnern. Denn als Malle sie für seinen Fahrstuhl-Thriller besetzte, 1957 also, konnte sie zwar bereits auf knapp zwanzig Filme zurückblicken, in denen sie Stichwortlieferantinnen, »flotte Bienen«, Gangsterbräute und austauschbare Charaktere gespielt hatte. Keinen einzigen Part aber konnte sie vorweisen, der ihrer außerordentlichen Begabung, die immer auch ihre Persönlichkeit gewesen war, in vollem Umfang entsprochen hätte. Und sie war auch noch auf keinen Spielleiter gestoßen, der sie und ihr Talent mit Leib und Seele gefordert hätte. Dagegen war ihre Theaterlaufbahn schon von vielen (Achtungs-)Erfolgen gekrönt gewesen.
Nun aber prangte ihr Konterfei, eine Woche nach ihrem dreißigsten Geburtstag, auf einmal von den Werbetafeln der Pariser Großkinos. Und wurde, während sich die Zuschauer noch verwundert die Augen rieben, von einem Teil der Kritik enthusiastisch gefeiert. Wie das Opus selbst. Malle wollte die Filmwelt herausfordern und um jeden Preis Aufsehen erregen, und es war ihm aus dem Stand heraus gelungen – mit einer kühnen Ästhetik, in der Authentizität, Schock und Satire gleichermaßen ihren Platz hatten, mit einem Blickwinkel der Verengung, wobei die Kamera bevorzugt eingesperrte oder unerfüllt Liebende in all ihrer Hoffnungslosigkeit zeigt, indem sie durch Schächte oder Gitter späht, mit einer streckenweise realistischen, dann wieder verfremdeten Sittenschilderung und einer kleinen Portion Gesellschaftskritik. Ohne dabei gewisse Vorbilder und Einflüsse zu verleugnen. Geschickt und intelligent kalkuliert, mit einem Beinahe-Justizirrtum als finaler Pointe. Und mit einer durch und durch glaubwürdigen Protagonistin, Jeanne eben, die hier Florence heißt und den Film mit einem erotisch gehauchten »Je t’aime, Julien« in Großaufnahme eröffnet.
»Das Gesicht von Jeanne Moreau«, so brachte es der unvergessene deutsche Filmkritiker Michael Althen vor langer Zeit einmal auf den Punkt, »erzählt die ganze Geschichte« von Mord, Betrug und Verwechslung »als Dialog mit einem abwesenden Geliebten. Ihr Gang auf den regennassen Straßen, ihre Haltung in den neongrellen Cafés, ihre tragisch geschwungenen Züge im Licht der fernen Schaufensterauslagen, das wirkt wie die Idee einer Frau, zusammengesetzt aus Linien, Formen und Bewegungen, die traumverloren ihren Platz in dieser Tragödie sucht.«
Schon in der ersten Einstellung wird das sichtbar: Die später dann recht agile Kamera Decaës ruht zu Beginn, so als machte sie es sich für längere Zeit bequem, auf Moreaus Zügen und nimmt sie neugierig unter die Lupe. Präsentiert erst ihre geschlossenen Lider, dann ihre vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen, die bebende Nase, die eindringliche, konzentrierte Mimik und ihren erregten Mund. Einen unruhigen Mund, dem wir beim Murmeln und Stammeln zusehen dürfen. Einen sanften Mund, dem sich nach emphatischen Liebesschwüren, Befehlen und Beteuerungen (»Ich werde dich nie verlassen«) gleich mehrfach magische Formeln der bevorstehenden gemeinsamen Freiheit entringen. Begleitet von einem »Es muss sein – es muss!« Ein Mantra der Utopie – eine Verheißung. Und ein deutlicher Beleg für ihre große Ungeduld. Erst als die Kamera allmählich von ihr abrückt und langsam, sachte zurückgezoomt wird, bis ihr Kopf, mit frisch ondulierten blonden Locken, und ihr Oberkörper auf der Leinwand auftauchen, erkennt der Zuschauer – sobald ein Hörer am Ohr am Bildrand auftaucht –, dass er gar nicht einem direkten Gespräch zwischen zwei Liebenden beigewohnt hat, sondern einem wichtigen Telefonat. Der entscheidenden Verabredung zwischen der reichen, begehrenswerten und gelangweilten Florence, Ehefrau eines alternden Rüstungsunternehmers, die ihren inzwischen als unerträglich empfundenen Mann mit Hilfe ihres Geliebten Julien beseitigen will. Und eben dieser Julien, der wiederum ein Angestellter ihres Gatten ist und hier nur kurz im Gegenschnitt zu sehen, ist längst bereit, aus Liebe zu ihr diesen ungeheuerlichen Akt zu vollziehen und die Tötung auszuführen. Der Name Julien fällt, aus Florences Mund, Dutzende Male in diesem Film, so auch hier; ihr eigener Vorname hingegen so gut wie nie. Stattdessen tauschen die beiden Verschworenen gewichtige Sätze wie: »Wenn ich deine Stimme nicht hören würde, wäre ich verloren in einem Land der Stille« (er), »Ich bin es, die das alles nicht länger aushalten kann« (sie) oder »Mutig ist sie nicht, die Liebe« (wieder er). Das Telefonat ist somit der Startschuss zum Mord; die beiden Akteure sprechen sich Mut zu und sind zugleich beklommen, fühlen sich denkbar unwohl. Wohl fühlt sich allein die Kamera, die ihnen bei ihrem suggestiven Anfeuerungsdialog zuschaut.
Es hat sich um die entscheidende Unterredung der beiden Komplizen gehandelt. Sie haben sich gegenseitig angestachelt und aufgeputscht, sich ihrer Zuneigung versichert und ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen: Direkt nach dem erfolgten, perfekt arrangierten – und als Suizid getarnten – Mord werden sie, ihrem Plan zufolge, sich in wenigen Stunden treffen und die so lange ersehnte, gemeinsame Freiheit in vollen Zügen genießen können. Der deutlich jüngere, gutaussehende Julien scheint bereit, dafür bis zum Äußersten zu gehen. Ob er, als ehemaliger Fallschirmspringer der Fremdenlegion und Veteran der Algerien- und Indochina-Kriege ein echter Draufgänger, nur Mittel zum Zweck ist oder ob Florence wirklich echte, tiefe Leidenschaft für ihn empfindet, die sie nicht allein zur Mitwisserin, sondern sogar zur Anstifterin zum Mord werden lässt, diese Frage stellt sich der Betrachter zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht.
Florence-Jeanne, alles andere als ein Dummerchen, ist somit eine so schöne wie unzufriedene, so wohlhabende wie selbstsüchtig agierende Verbrecherin. Was sich nun in den nächsten Minuten und Stunden während der Mordnacht abspielt, malt sie sich einerseits nur aus (in ihrer inneren Vorstellungswelt, als eine Art Voyeurin des Imaginären), sofern es die ursprünglich geplanten Handlungen betrifft, andererseits bleibt sie von den tatsächlichen Begebenheiten für lange Zeit ausgeschlossen. Und viel zu spät muss sie erkennen, dass sie durch ein nicht vorhersehbares taktisches Missgeschick selbst in der Falle sitzt, was immense Verzweiflung bei ihr hervorrufen wird.
Die Zuschauer sind Jeannes Wissensstand stets um Längen voraus, und darin liegt der große Reiz des Films: Sie erleben direkt mit, wie der vermeintlich Überstunden ableistende Julien – durch ein wasserdichtes Alibi, die Präsenz seiner Sekretärin im Vorzimmer nämlich, gedeckt – am frühen Abend zu Werke geht. Sehen, wie er sich über den Balkon, durch Einsatz eines Wurfankers und eines Seils, an der Fassade des Bürogebäudes emporschwingt und so unbemerkt zum Arbeitsraum seines Vorgesetzten vordringt. Der eigentliche Mord an seinem Chef Carala, als fingierte Selbsttötung gekonnt in Szene gesetzt, wird dabei gar nicht gezeigt. Die Zuschauer sehen ebenfalls dabei zu, wie Julien in aller Seelenruhe, in Begleitung von Sekretärin und Hausmeister, mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss fährt, sich zu seinem vor einem Blumenladen parkenden Auto begibt und sich anschickt, loszufahren. So weit ist alles nach Plan gelaufen. Da erst, als Julien das Dach seines Cabriolets geöffnet hat, fällt sein Blick auf das versehentlich an der Fassade zurückgelassene Seil – ein fatales Indiz. Schnellen Schrittes kehrt er ins Hochhaus zurück, fährt mit dem Fahrstuhl wieder nach oben, doch zeitgleich sperrt der Hausmeister die Stromzufuhr und verriegelt den Büroturm. Julien, von Maurice Ronet mit beklemmender Intensität gespielt, ist, wohl oder übel, die ganze Nacht über im Fahrstuhl gefangen und wird nicht rechtzeitig am verabredeten Treffpunkt erscheinen können. Schlimmer noch: Das Seil bleibt auch weiterhin sichtbar; die Tötung des Firmenchefs kann jederzeit auffliegen. Und er vermag Florence von diesem Zwischenfall noch nicht einmal in Kenntnis zu setzen. Oder sie zum Eingreifen zu bewegen.
Draußen, im vorabendlichen Paris, wo alle übrigen Bürger dem Nachtleben entgegenfiebern, überschlagen sich derweil die Ereignisse: Eine für Julien schon seit Langem schwärmende Blumenhändlerin namens Véronique, vor deren Geschäft sein geöffneter Sportwagen bei noch immer laufendem Motor geparkt ist, hat sich mit ihrem Freund Louis, einem kleinen Ganoven und Taugenichts, getroffen. Beide sind um die Zwanzig. Aus einer Laune heraus stehlen sie Juliens Auto, entdecken darin seinen Trenchcoat, einen Fotoapparat und einen Revolver, machen sich zu einer Spritztour auf, durchqueren die Stadt und steuern auf die Autobahn zu. Die kommenden Stunden durchlebt das aufmüpfige Gespann, in seiner Unbeschwertheit ein ironisches Spiegelbild des am Ausbruch gehinderten Paares Julien/Florence, wie die durchgeknallten Hauptdarsteller in einem schrägen Roadmovie – gipfelnd in einem verrückten Wettrennen mit einem schicken Mercedes auf der Fahrt in die Provinz, mit dessen Insassen, einem ausgesprochen gut gelaunten deutschen Ehepaar, sie sich anfreunden. Gemeinsam übernachtet das bizarre Quartett in einem Motel (von Malle vom Drehort Ärmelkanalküste kurzerhand in die nähere Umgebung von Paris »verlegt«). Es kommt zu einem Besäufnis und wenig fruchtbaren politischen Diskussionen, wobei die Youngsters mächtig angeben und schwindeln. Sogar ihre Identität fälschen sie. Schließlich fotografiert man sich gegenseitig und champagnerselig. Als der Jüngling, mitten in der Nacht, aus lauter Übermut nun auch noch den Mercedes des älteren Deutschen entwenden will, dabei aber unvorsichtig vorgeht und von den Besitzern ertappt wird, kommt es zum tödlichen Drama: Bei einem Handgemenge werden die beiden Reisenden von Louis erschossen, und in Panik kehren die Missetäter in Juliens Wagen zurück nach Paris. Dort überlassen sie das Auto sich selbst, verstecken sich in Véroniques Wohnung und erwägen nun ihrerseits, mit ihrem Freitod den Konsequenzen des Doppelmordes zuvorzukommen.
Was einem wie eine üble und vor allem ziemlich wirre Räuberpistole vorkommen mag, tangiert die vom Fortgang des Geschehens unberührte Florence Carala vorerst nicht. Zum Warten verurteilt, seltsam unbeteiligt und zur Untätigkeit verdammt, flaniert, driftet, streunt sie des Nachts ziellos durch ein unwirkliches, ein hell erleuchtetes Paris. Dass Julien sich nicht einfindet, verwundert und beunruhigt sie; als sie dann auch noch, aus nächster Nähe, seinen Sportwagen vorbeifahren sieht, dessen Fahrer sie nicht richtig erkennen kann, und dabei eine lachende junge Frau auf dem Beifahrersitz, die ihr Gesicht zum Fenster herausstreckt, wahrnimmt, bringt sie auf den irrigen Gedanken, ihr Liebhaber habe sie womöglich getäuscht und für immer verlassen. An ihr nagt der Zweifel, sie sei nun ihrerseits einem Betrug zum Opfer gefallen. Sie fühlt sich düpiert und aller Perspektiven beraubt.
Genau diese Situation der Hilflosigkeit und der Konfusion, der Enttäuschung und des Ausgeliefertseins interessiert Malle – der nach eigenem ironischem Bekunden bislang lediglich »Fische« in Szene gesetzt habe und filmische Personenführung erst noch lernen müsse – ungemein: Er zeigt uns eine mit sich hadernde Florence. Die banalen Umstände der »Haupthandlung« werden in seiner Filmerzählung zu Nebensächlichkeiten degradiert. Lieber führt er uns eine Somnambule vor. Jeanne Moreaus Schatten werfende Silhouette, mal im Profil gezeigt, dann wieder von vorn, duettiert dabei mit Miles Davis’ meisterhaften Trompeten-Phrasen. Vergeblich betritt die elegante Erscheinung Cafés, Kneipen mit Glücksspielautomaten, vornehme Hotels, fragt Wirte, Gäste und Portiers nach ihrem verschwundenen Hoffnungsträger und bekommt lediglich Verneinungen und ratloses Achselzucken als Antwort. Hektisch eilt sie umher, zuerst mit abrupten, schnellen Schritten – an größeren hindert sie ihr enger Rock. Autos müssen vor ihr bremsen und ausweichen, so nervös, abgelenkt und unaufmerksam ist sie, wenn sie die Haupt- und Nebenachsen der Metropole überquert. Dann wird ihr Gang fahriger, schweift sie ab, verfällt in Trippelschritte. Willenlos taumelt und stolpert sie vorwärts, unschlüssig streift sie durch die schicken Arrondissements, im Rhythmus ihrer Schultern.
Nun führt sie Selbstgespräche, die einem verbalen Kopfschütteln gleichkommen (wir Zuschauer bekommen nur ihre sich fast unmerklich bewegenden Lippen zu sehen), versucht, in einem inneren Monolog, der als Voice-Over-Kommentar hörbar wird, sich über ihre neue Lage klarzuwerden, gerät mehr als einmal an den Rand des Wahnsinns. Passanten drehen sich nach ihr um; allen fällt auf, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Als dann auch noch der Regen einsetzt, nehmen Passivität und Lethargie überhand, sucht sie erst gar nicht an einem trockenen Plätzchen Schutz, sondern lässt auch diese Demütigung über sich ergehen – so als würde sie sie gar nicht mehr bemerken. Moreau trägt kaum Make-up bei diesem Nocturne, bei diesem verlangsamten, einsamen Paris-Tanz, und wird unbarmherzig, ohne zusätzliche Kunstgriffe der Aufhellung oder »Verschönerung«, ausgeleuchtet, wobei der Kameramann sie – oftmals aus der Froschperspektive, aber immer ganz dicht an sie herangerückt, in einem Kinderwagen vorausfahrend – nie aus den Augen lässt. Ihr schwarzes Kostüm mit dem doppelten, aufgestellten hellen Kragen verliert seinen straffen Sitz, ihre vormalige Lockenpracht löst sich beim Regenguss auf, bis ihre nassen Haare sich wie ein Kranz um ihren Kopf und ihr trauriges, zunehmend mutloses und verstörtes Gesicht legen. Ab und zu flackern Lichter auf, wird ihre Miene von Leuchtreklamen erhellt, dann schreitet sie wieder im Halbdunkel weiter. Und streichelt zerstreut die Kotflügel der parkenden Autos, beobachtet schön gekleidete, glücklich wirkende Damen, die Limousinen entsteigen und von ihren Männern in Restaurants geführt werden. Um sie kümmert sich niemand.
Jeanne entwirft in diesen denkwürdigen Minuten, deren »inhaltsfreier« Ablauf Filmgeschichte schreiben wird, mit großem Können das Porträt einer Frau, die binnen weniger Momente ihren Halt verliert, zerbrechlich wird und sich auflöst. Deren Fassade zusammenstürzt. Die an sich und ihren Utopien, die bloße Hirngespinste geblieben sind, irre wird. In ihren Zügen spiegeln sich Lähmung und erloschene Hoffnung. Orientierungslos und in sich zusammengesackt lässt sie sich über die Avenuen treiben – anfangs noch gedankenverloren, versonnen und träumerisch, dann abdriftend und zunehmend verzweifelt. Wir bekommen ein komplexes, keine Subtilität aussparendes Psychogramm geliefert. Und sehen dabei zu, wie sich die Champs-Élysées, wie durch Zauberhand und auch dank des jazzigen Soundtracks, in einen Sunset Boulevard verwandeln. Alle Masken fallen, und wie wir bereits wissen, steht die Aufdeckung ihrer verbrecherischen, egoistischen Absichten ja kurz bevor, das »Schafott« wartet schon. Dass die Liebe sie noch retten könnte, denn an den Gefühlen des im Fahrstuhl eingekerkerten Julien für sie hat sich ja noch gar nichts ändern können, kann sie nicht einmal ahnen. Julien ist zwar da, ganz in ihrer Nähe sogar, ebenso isoliert und handlungsunfähig wie sie (seine abenteuerlichen Befreiungsversuche aus dem Lift wirken wie der edle Auftakt zu einer später sehr beliebten »Mode« von eher banalen Fahrstuhl-Horrorfilmen), aber Julien ist auch bereits aus ihrem Dasein getilgt worden. Anarchie der Emotionen. Bis zum Ende des Films werden Julien und Florence in keiner einzigen Szene gemeinsam zu sehen sein, beide sind und bleiben für immer allein.
Miles Davis’ melodiöse Floskeln, kurze Interjektionen und nur angedeutete Kantilenen, von denen man gar nicht genug bekommen kann, machen, über den gesamten Film verteilt, stattliche achtzehn Minuten aus. Doch liefern sie – und darin liegt die Tragik von Florence begründet – ebenso wenig wie ihre Suche nach dem Verbleib ihres Partners und Komplizen eine befriedigende Antwort auf ihre bohrenden Fragen, auf ihr erst verzagtes, dann anklagendes »Pourquoi?« Von ihrer anfänglichen Begierde und Unerschrockenheit ist im Grunde nur wenig übrig geblieben. So will man, als heutiger Zaungast dieser fortschreitenden Desillusionierung, gar nicht wissen, wie es weitergeht im Text, man möchte keine schnelle Lösung, man folgt der Moreau nur allzu gern auf ihrem Irrweg der Schwerelosigkeit. Auch wir heutigen Zuschauer lassen uns nun gern treiben, schweben gemächlich vorwärts. Lassen uns auf ihren schwingenden Gang und ihre vorwurfsvollen, stummen Blicke ein. Purer Jazz. Schicker Existenzialismus. Schmerzhaft schön improvisiert, melancholisch gehaucht, in dunkle Farben getaucht. Solistisches Blechblasinstrument, begleitendes Saxophon, Besen, Snare-Drum, Bass, diese Mischung genügt vollauf. Eine Melange von Film und Musik, mit einer Partitur aus Licht und einem Antlitz als Dreh- und Angelpunkt. Ein Loblied auch auf eine berückend emotionale Frau, der mittlerweile jegliche Kontrolle entglitten, jegliche Nonchalance abhanden gekommen ist.
»Ich glaube«, so erinnerte sich Louis Malle an die Dreharbeiten mit Jeanne, »das war das Klügste, was ich tun konnte: Ich nahm sie so, wie sie war. Und ich zeigte das, was faszinierend an ihr war. Sie konnte von unglaublicher Schönheit sein. Aber in der nächsten Einstellung, im nächsten Augenblick veränderte sie sich vollständig. Sie besaß dabei eine Wahrhaftigkeit. Sie war eine komplexe Frau – und plötzlich war sie für alle eine Offenbarung.« Die Moreau – fürwahr eine Offenbarung. A star is born.
Der nächtliche Spaziergang wird damit, obwohl oder gerade weil er ereignislos daherkommt, zum Höhepunkt des Films. Der Showdown selbst ist relativ schnell erzählt: Die beabsichtigte Selbsttötung von Louis und Véronique kommt nicht zustande; die verständnislose Florence erfährt, als sie von der Polizei aufgegriffen wird, dass man nach ihrem Geliebten in ganz Frankreich absurderweise wegen eines Doppel-Mordes an zwei deutschen Touristen fahndet, und Julien kann sich am nächsten Morgen, als die Stromversorgung wieder gewährleistet ist, endlich aus dem Fahrstuhl befreien und genau in jenem Moment aus dem Gebäude flüchten, als Kriminalbeamte das Büro seines getöteten Arbeitgebers stürmen. (Das verräterische Seil hängt indessen immer noch an Ort und Stelle.) Nun ist es an ihm, sich auf die Suche nach Florence zu machen. Lange währt die wiedergewonnene Freiheit nicht: Zeitungsberichte und Denunziationen bringen ihn, kaum dass er ein Café betreten hat, schnurstracks zur Strecke. Er wird auf der Stelle festgenommen und muss sich nun für eine Tat verantworten, die er gar nicht begangen hat, während das eigentliche Verbrechen (noch) nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht wird.
Doch damit nicht genug der haarsträubenden Wendungen: Florence stellt die jungen Verbrecher in ihrer Pariser Liebeslaube und zeigt sie bei der Polizei an, ohne ihre eigene Identität preiszugeben. Lediglich die am Vortag angefertigten Fotos könnten nun noch Belege für die »echte« Schuld liefern. So beginnt ein abenteuerlicher Wettlauf mit der Zeit um Juliens Kamera und deren Inhalt. Denn nur mittels Vernichtung des darin befindlichen Films lässt sich der Entwicklung der kompromittierenden Negative noch rechtzeitig zuvorkommen. Alle Beteiligten – Florence und Louis treffen fast zeitgleich im Motel, am Schauplatz des Unheils ein – verlieren diesen Wettlauf: Im Fotolabor, wo sich die von einem Inspektor geführte Mordkommission bereits vorsorglich eingefunden hat, werden sowohl Louis und Véronique als auch Florence und Julien, anhand der soeben aus dem Wasserbad beförderten Bilder, einwandfrei überführt. Immer deutlicher hervortretende Konturen geben preis, dass die Jugendlichen die Touristen, mit denen sie noch Stunden zuvor gefeiert hatten, auf dem Gewissen haben, und sie entlarven auch das zweite Tandem, indem mit früheren Aufnahmen offengelegt wird, dass Florence und Julien schon seit Langem eine glückliche Beziehung geführt haben. Seitensprung und damit auch Tötungsabsicht liegen offen zutage.
Die Würfel sind gefallen, die Beweise zahlreich; der Kommissar – gespielt vom Kino-Urgestein Lino Ventura, schon damals eine verlässliche Casting-Größe – kann den Fall abschließen; Mordanklage und Hinrichtung sind nur noch eine Frage der Zeit. Ein ernüchterndes Finale. Florence, die glaubte, alles »richtig« gemacht zu haben und doch nur einem grausamen Impuls gefolgt war, ist auf ganzer Linie gescheitert. Und auch ihre große Liebe zu Julien, die die Fahrstuhlnacht ja gottlob unbeschadet überstanden hat (wie sie erst jetzt, mit nur vorübergehender Erleichterung, immerhin zu erkennen imstande ist), vermag sie nicht mehr zu retten. Oder auch nur zu trösten.
Das mörderische Liebeskomplott ist aufgeflogen, Florence ist am Ende. Büßen und bezahlen wird sie müssen, und zwar bald. Der Kommissar deutet an, dass sie von allen Beteiligten wohl am härtesten bestraft werden wird, dass die Geschworenen in ihrem Fall keine Gnade walten lassen werden. Und da Jammern und Betteln weder helfen noch Teil ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, hält sie sich gar nicht erst mit Abstreiten und Ausflüchten oder mit dem Heischen nach Mitleid auf. Alles Eitle und Selbstverliebte ist aus ihren Zügen gewichen, und sogar Trauer und Niedergeschlagenheit haben sich verflüchtigt: Ihr Gesicht ist nun vollends leer, jeglicher Ausdrucksfähigkeit beraubt. Nichts Erbarmungswürdiges ist mehr an ihr. Aber auch nichts Erbärmliches.
***
Drei Szenenfolgen lediglich gibt es in diesem Film, in denen Florence wirklich »spielt« und aktiv an der Handlung partizipiert. Zuerst im Polizeirevier in der Ausnüchterungszelle, wenn sie einem geschwätzigen Saufkumpanen ihres Geliebten als Stütze dient und zeitgleich den Beamten, ohne es wirklich zu wollen, kompromittierende Informationen über den »falschen« Julien in die Hände spielt. Da sie für die Polizisten aber in erster Linie Madame Carala, die Frau eines stadtbekannten, einflussreichen Mannes ist, lässt man sie vorerst laufen. Danach, wenig später, wenn sie, mit zurückgebundenem Haar und in ein noch engeres, diesmal helles Kostüm gezwängt, nach nur kurzem Schlaf mit einem wichtigen Mitarbeiter in der Firma ihres Gatten interne geschäftliche Details bespricht, um das künftige Schicksal des Unternehmens zu regeln (und dabei keine Sekunde lang wie eine trauernde Witwe wirkt, sondern beherrscht und entscheidungsfreudig – die perfekte Chefin eben). Schließlich, wenn sie in der bescheidenen Unterkunft der jungen Ganoven und vermeintlichen Selbstmörder auftaucht, wenn sie die beiden, im Befehlston, zur Rede stellt, sie in ihrem Zimmer einschließt und draußen auf der Straße, von einer Telefonzelle aus, mit einem anonymen Anruf die Polizei verständigt, um sie auf die Spur des Paares zu bringen und Julien wieder ein Alibi zu verschaffen.
Alle anderen Florence-Sequenzen tragen sich in einer irrealen Zwischen- und Traumwelt zu. Ob die Verlassene nun von einem Mann im Café angesprochen wird, der ihr Komplimente über ihre schönen Augen macht, ob sie in einer Bar auf einen Spiegel zutritt, ob sie vereinsamt durch den Regen läuft: Jedes Mal senkt sie ihre Lider und blendet das »Außen« aus, flüstert, lauscht ihren eigenen Sätzen aus dem Voice-Over (»Julien hat nicht gewagt, glücklich zu sein«, »er war zu feige«) oder spricht ihren abwesenden Geliebten direkt an (»in dieser Nacht habe ich dich verloren, Julien«, »Julien, jetzt habe ich dich wirklich überall gesucht«). Standhaft verweigert sie sich auf diese Weise der allzu schmerzlichen, unbarmherzigen Realität. Sie flüchtet sich gewissermaßen in einen Wachschlaf. Besonders deutlich wird das bei der Konfrontation mit dem Kommissar im Fotolabor, als die verräterischen Bilder ihres kurzen Glücks zutage gefördert werden: Malle und Decaë setzen Weichzeichner ein, die konkrete Umgebung verschwindet in der Dunkelheit, die bedrohlichen Worte des Beamten treten in den Hintergrund, und wir werden einmal mehr mit dem Gesicht der Moreau allein gelassen. Und setzen uns erneut dem beschwörenden Gemurmel von Florence aus dem Off aus: Mit den Fingern streichelt sie die Fotos im Entwicklerbad, deren Umrisse allmählich sichtbar werden, rückt die Bilder – die letzten Belege harmonischen Zusammenseins – zurecht, fährt an ihren Rändern entlang. Ihr eigenes Spiegelbild wird in der Flüssigkeit sichtbar und zittert darin. »Ich werde schlafen – und allein wieder aufwachen«, sagt sie, im Voice-Over, zu niemand Bestimmtem. Und dabei malt sie sich die Jahre der bevorstehenden Trennung aus: »zehn … – zwanzig … da werde ich uralt sein«, um zu einer Art imaginären Schlussansprache an »ihren« Julien zu gelangen: Nie habe sie nur an sich selbst gedacht, sie habe ihn wirklich geliebt. Und jetzt, Bezug nehmend auf die Doppelporträts der Verliebten vor ihren Augen und in ihren Händen, wird für sie der negierte Ausgang der Geschichte zu einer absurden Gewissheit: »Aber hier« – auf diesen Bildern – »sind wir zusammen und vereint.« Die Moreau blickt jetzt unverwandt und direkt in die Kamera. Ihre Utopie wird und wirkt glaubhaft. Nichts und niemand kann, in der Phantasie von Florence, Julien und sie zukünftig noch trennen.
***
Wenn es Nacht wird in Paris … So hat einst einer ihrer frühen Filme, Touchez pas au grisbi von 1954, in dem sie als Starlet, an der Seite von Altstar Jean Gabin, die Nachtklubsängerin Josy gab, im deutschen Verleih geheißen: reichlich poetisch, denn »Hände weg vom Zaster!«, eine Spur derber also, wäre die sinngemäße Übertragung gewesen …
»Wenn es Nacht wird in Paris«, das könnte aber auch der heimliche Untertitel von Malles frühem Meisterwerk sein. Wer die Moreau damals im Kino sah, bald schon etwa in dessen zweitem Streich, Die Liebenden, oder sie in Hauptrollen in den Filmen von Brook, Antonioni und Truffaut zu Gesicht bekam, verdienter Lohn für diese frühe Ausnahme-Leistung, der vergaß ihre Erscheinung nie wieder. Weder ihre beredte Körpersprache noch ihre mit Lust an der Fatalität zelebrierte Erschöpfung, ihren Lebensüberdruss. Viele ihrer künftigen Filmfiguren besitzen das Mienenspiel und Ausdrucksspektrum dieser so reichen wie armseligen Florence. Deren nächster Schritt oder nächster Gedanke sich weder ahnen noch voraussagen lassen. Einige von diesen Figuren sind sogar direkte Fortsetzungen von Florence. Das meiste von dem, was Jeanne später auszeichnen, wofür sie später berühmt sein würde, hatte sie im »Fahrstuhl«-Film bereits erfolgreich erprobt. Nunmehr sollte es um die darstellerischen Verfeinerungen und Verästelungen gehen. Damit würde sie in den Sechzigern veritable Triumphe feiern.
»Hinreißend und auf fatale Weise mit