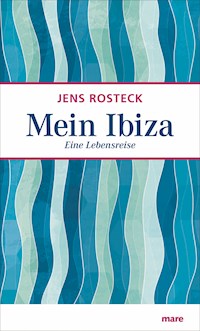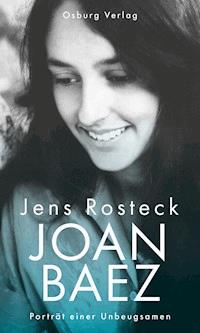
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die beispiellose Laufbahn von Joan Chandos Baez, der musikalischen Galionsfigur der Bürgerrechtsbewegung, des konsequenten Pazifismus und der US-amerikanischen Gegenkultur, umspannt mittlerweile annähernd sechs Jahrzehnte. Die Ikone des Protestsongs präsentierte ihre Vision einer gewaltfreien Weltordnung beim Marsch auf Washington und in Woodstock. Sie kämpfte an der Seite von Martin Luther King für die Überwindung der Rassentrennung, ergriff für Kriegsdienstverweigerer Partei und engagierte sich gegen den Vietnamkrieg. Der Musikwissenschaftler und erfahrene Biograf Jens Rosteck legt mit seinem ebenso kenntnisreichen wie einfühlsamen Porträt der Königin des Folk die erste umfassende Auseinandersetzung mit der unbequemen Songwriterin seit Jahrzehnten vor. Er schildert den abenteuerlichen Lebensweg der Weltbürgerin, Bob-Dylan-Weggefährtin und Amnesty-International-Preisträgerin von den Studenten-Cafés der Ostküsten-Boheme über die Festivals der Blumenkinder bis hin zum Widerstand gegen den Irakkrieg und gegen Trump. Parallel dazu geht Rosteck den stilistischen Merkmalen, ästhetischen Besonderheiten sowie der politischen Dimension von Baez' wichtigsten Liedern, Hymnen und Alben nach – wobei er neben den Klassikern und Hits manch überraschenden Titel zutage fördert. Das längst überfällige, fundierte Lebensbild der barfüßigen Madonna wird sowohl Zeitzeugen der friedensbewegten Sixties wie auch Baez-"Einsteiger" begeistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens Rosteck
JOAN BAEZ
Porträt einerUnbeugsamen
Erste Auflage 2017© Osburg Verlag Hamburg 2017Alle Rechte vorbehalten,insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortragssowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systemeverarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Lektorat: Michael Assmann, Darmstadt;Bernd Henninger, HeidelbergUmschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, HamburgSatz: Hans-Jürgen Paasch, OesteDruck und Bindung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN 978-3-95510-142-8eISBN 978-3-95510-149-7
I am less than the song I am singingI am more than I thought I could be.
It’s the strength that you share when you’re growingThat gives me what I need most of all.
Für Maria Ossowskiund für Beate Köhn
Inhalt
Streitbare Nachtigall
Daumenkino: »Nur ich und meine Gitarre«
Nowhere Girl
Lady Madonna
Mit (einem) Gott auf ihrer Seite: Baez singt Dylan
Peacenik, Häftling, Troubadour
Joan, Juliane und The Band: The Night They Drove Old Dixie Down
Die im Dunkeln sieht man doch: Come From The Shadows
Die Verzweiflung überwinden: Where Are You Now, My Son?
Love Song To A Stranger
Gracias a la vida
Botschafterin des Gewissens
Unbestechlich sein und anständig bleiben
Wege zur Wahrhaftigkeit: Klassiker und Standards
Kollektive Emphase: Hymnen, Sing-Along-Lieder und Slogan-Songs
Aufrichtig leben: Liebeslieder und Selbstporträts
Nicht einmal im Traum: Überraschendes und Kuriositäten
Kleine Siege und große Niederlagen
Zeittafel
Ausgewählte Literatur und Quellen
Diskographische Empfehlungen
Zitatnachweise der Motti
Bildnachweis
Personenverzeichnis
Sie wollte weniger sein als jedes unter den vielen Liedern, das sie gerade sang. Und genau damit wurde sie zu einer größeren Persönlichkeit, als sie zuvor je gedacht hätte. Lediglich im Teilen ihrer Stärken wurde ihr, während sie künstlerisch noch im Wachsen begriffen war, auch all das zuteil, was sie am meisten benötigte.
Hoyt Axtons Country-Klassiker Less Than the Song, den ich hier paraphrasiert habe und dem auch das Motto dieses Buches entlehnt ist, spielte Joan Baez noch in dessen Entstehungsjahr 1973 ein. Damit gab die Zweiunddreißigjährige, wohl ohne es zu beabsichtigen, gleich eine perfekte Selbstbeschreibung ab, lieferte eine vorläufige, doch schon sehr treffende Definition von sich.
Streitbare Nachtigall
Es passiert mir oft, dass Leute in Geschäften zu mir kommenund mir ins Ohr flüstern: »Ich bin auf Ihrer Seite!«Ich sage dann immer: »Danke, freut mich,aber dann sagen Sie’s bitte etwas lauter,damit es alle hören können.«
Als blutjunge, engagierte Studentin stand sie auf den kleinen Bühnen der Ostküstenstädte der USA, beteiligte sich an alternativen Festivals, machte an progressiven Unis von sich reden und spielte als vielversprechendes Folk-Talent bereits ihre ersten Platten ein. Sie lehnte sich, eher im Stillen, gegen die Bequemlichkeit und den Konformismus einer passiven, schweigenden Mehrheit auf, indem sie ein paar jahrhundertealte, melancholische Balladen ausgrub und in Coffeeshops zum Besten gab. Sie wurde kurzerhand zum Star erklärt, nachdem sie an einem regnerischen Juli-Tag, mit nassem Haar und schlammbedeckten Füßen in »Gladiatoren«-Sandalen, vor dreizehntausend Menschen einige Lieder sang. Sie wandte sich, als sei es ihre Bestimmung, ihr ganzes weiteres Leben lang friedenshungrigen Menschen zu, und sie wandelte sich bereits zur künstlerischen Aktivistin, als der Beat noch in den Kinderschuhen steckte, die Geburtsstunde der Fab Four und der Rolling Stones auf sich warten ließ und kein Ende des Kalten Krieges abzusehen war.
Die rebellischen, unangepassten und antiautoritären Sixties prägte sie maßgeblich als Wortführerin und Mahnerin, als Songpoetin und Pasionaria – wie außer ihr nur noch Bob Dylan, dessen Karriere sie nachhaltig förderte und dem sie auch privat sehr nahekam. Dieser so überaus kreativen und experimentellen, obrigkeitskritischen und vor allem politisch brisanten Dekade, deren Akteure sich die kühnen, provokativen Forderungen des Anti-Establishments wie auch die naiven, hedonistischen Träume der Blumenkinder-Generation auf die Fahnen geschrieben hatten, lieh sie eine markante, einzigartig schöne und noch dazu unverwechselbare Stimme. Und sie schenkte diesem Jahrzehnt schon damals eine Handvoll Lieder (»im Volkston«), deren Kultstatus inzwischen unangefochten ist und die sie mit kultiviertem, schnörkellosem Gesang, betörender Lauterkeit und großer Ernsthaftigkeit einem immer größer werdenden Publikum vortrug.
Sie stellte sich in den Dienst ihrer Texte. Ihre Konzerte verstand sie weniger als Entertainment denn als Aufruf zu geschärftem Bewusstsein und zu absoluter Gewaltlosigkeit, als aktiven Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung. Als Appell an wirklich mündige Bürger.
In den Siebzigern gestattete sie sich, längst zum Idol erklärt und mit stetig wachsendem Repertoire, Ausflüge in Richtung Country und Pop. Und reifte rasch zur ernstzunehmenden, vielseitigen Musikerin, ja zur Liedermacherin der Sonderklasse und zur international gefeierten Berühmtheit, deren aufrüttelnden Botschaften man Gehör schenkte – zumal, wenn sie als furchtlose Friedensbotschafterin in Hanoi inmitten verheerender Luftbombardements durch ihre eigenen Landsleute große Gefahren auf sich nahm. Oder wenn sie den Völkermord in Bangladesch wie die Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Regierung Vietnams ohne Rücksicht auf nationale Empfindlichkeiten schonungslos anprangerte.
Zeitlebens zeigte sie Solidarität, etwa bei ihrem Auftritt beim legendären Marsch auf Washington, bei der Verteidigung schutzloser schwarzer Schulkinder oder bei der Unterstützung inhaftierter Kriegsdienstverweigerer. Und sie stellte wieder und wieder ihren Mut unter Beweis, als sie Arm in Arm mit Martin Luther King im Bundesstaat Mississippi staatlichen Autoritäten die Stirn bot oder, als Vorkämpferin für die Aufhebung der Rassentrennung, Seite an Seite mit James Baldwin und Harry Belafonte an den Märschen von Selma nach Montgomery teilnahm.
Mit derselben Selbstverständlichkeit setzte sie sich für Lech Wałęsa und streikende kalifornische Bauern ein wie für zu Unrecht Inhaftierte, für Hungerstreikende, Revolutionäre oder für die unterversorgte kambodschanische Landbevölkerung. Sie hatte sich dafür gewappnet: Ihre Munition war die hochkarätige Lyrik ihrer Vorbilder und Mitstreiter; als Arsenal standen ihr, mit Folksongs aus den Appalachen und den bewährten, von Francis James Child gesammelten Balladen aus früheren Epochen,1 qualitativ hochrangige Americana und die gesamte englisch-schottische Volksliedtradition zur Verfügung. Ihre Schlachtfelder waren öffentliche Diskussionen, Demos und Musikbühnen, die Schulhöfe der Südstaaten, Gefängnistore, Flüchtlingslager und die Straßen der USA. »Pazifist zu sein bedeutet, aktiv und aggressiv zu sein«, über »eine Kämpfernatur« zu verfügen, so definierte sie ihre Haltung unmissverständlich – Pazifismus bedeute aber nichts weniger als Passivität. Baez wünschte stets all das einzusetzen, was sie auch beherrschte: »vom kühlen Verstand bis zum Humor«. Ihre Gabe, wie sie die Natur ihr verlieh – ohne eigenes Zutun – ist zugleich ihre schärfste Waffe: »Ich mache von meiner Stimme Gebrauch.«
Politische Führungs- und Ausnahmegestalten wie Václav Havel und François Mitterrand brachten ihr, dieser streitlustigen Amazone im Gewand einer Sängerin, auch öffentlich, größte Bewunderung entgegen, und sie zollte ihrerseits monumentalen Persönlichkeiten der Zeit- und Musikgeschichte wie Nelson Mandela oder Mercedes Sosa Respekt. Jimmy Carter schickte auf ihr Geheiß eine ganze Flotte der US Navy ins Südchinesische Meer und brachte sie in Stellung, um Menschenleben zu retten. Sämtliche Begegnungen mit den Großen dieser Welt absolvierte sie mit frappierender Souveränität und ohne Minderwertigkeitskomplexe. Ohne auch nur im Geringsten aufzutrumpfen, gelang es ihr im Verlauf ihres Bühnenlebens und ihrer politisch aktiven Phase, (Willens-)Stärke und Authentizität, Kultur und Charakterstärke, Esprit und Feminität glaubwürdig in einer Person zu vereinen.
Und selbst heutzutage – in einer Zeit, da die Studentenbewegung, die guten alten Ideale von Love & Peace und der Vietnamkrieg längst der Vergangenheit angehören, in einer im Medienstrudel und Dauerchat versinkenden Welt, die um David Bowie trauert und vor Donald Trump zittert, die Hunderttausenden von Flüchtlingen kein sicheres Zuhause bieten kann und zugleich von Terrorattacken nie gekannten Ausmaßes erschüttert wird – zieht sie auch weiterhin mit ihrer Gitarre und ihren zeitlosen Songs von Freiheit, Frieden und sozialer Gerechtigkeit unbeirrt von Land zu Land. Und erweist sich damit als Garantin.
Nie ließ sie sich vereinnahmen, nie gab sie sich parteiisch, nie saß sie – die »Stimme des Protests« schlechthin – einer Ideologie auf. Nie wurde sie müde, ihre Maxime »Ich trage keine Scheuklappen« zu wiederholen, angesichts der Anfeindungen durch hartnäckige Kritiker. Man warf ihr Blauäugigkeit und politische Ahnungslosigkeit vor; man beschuldigte sie, sich im Blitzlichtgewitter internationaler Kriegsschauplätze zu sonnen und sich an Stätten des Leidens wirkungsvoll in Szene zu setzen. Man konnte ihre Kompromisslosigkeit gelegentlich mit Starrsinn oder Besserwisserei verwechseln. Auf solche Anwürfe antwortete sie mit noch mehr Präsenz. Mit Gelassenheit und mit weiteren sozialkritischen Liedern. Sie war sich ihrer Sache sicher. Glaubte standhaft an die Macht der Töne. Als Heilige wurde sie verehrt, als Heulsuse geschmäht.
Einigen war ihr Gesangsstil, der sich eher an den Tugenden klassischer Liedsängerinnen und Opernsoprane orientierte als am rauen Sound von Bluesinterpretinnen oder dem virtuosen Scat synkopierender Jazz-Diven, zuwider – zuweilen wurde ihr Dauer-Vibrato oder vorgeblich »permanentes Tremolieren« gar als »Geplärre« herabgesetzt. Doch Anfeindungen, seien sie nun ästhetischer Natur oder dogmatisch begründet, wie übertriebener Starkult oder Vergötterung beeindruckten sie kaum. Alles, was letztlich zählte, war ihr Einsatz für die Benachteiligten dieser Erde, bedingungslose Friedfertigkeit ihr wichtigstes Anliegen – und ein immerwährender, unermüdlicher Kampf um dessen Durchsetzung. Ausnahmslos mit rein künstlerischen Mitteln ausgefochten. Denn schließlich hatte sie schon als Schülerin und Jugendliche Prinzipien des zivilen Ungehorsams zur Tugend erhoben.
Die beispiellose Laufbahn von Joan Chandos Baez, der musikalischen Galionsfigur der Bürgerrechtsbewegung, der moralischen Geradlinigkeit, des uneingeschränkten Pazifismus und der US-amerikanischen Gegenkultur, umspannt mittlerweile annähernd sechzig Jahre, und unlängst, am 9. Januar 2017, mit erstaunlich geringem Medienecho auf beiden Seiten des Atlantiks und auch hierzulande, vollendete sie ihr 76. Lebensjahr.
Allein das wäre schon Grund genug, sie, die Grande Dame des Protestsongs, die Unbestechliche und Unbequeme, die Vokalistin mit dem kristallklaren Timbre und die Jahrhundertfigur mit den aparten mexikanisch-indianischen Zügen, ausgiebig zu beleuchten, angemessen zu würdigen und, in einem umfassenden Lebensbild, auch kritisch zu betrachten, mit der notwendigen Distanz einzuordnen.
Doch kommt noch hinzu, dass dieser veritablen Ikone des Folk, der zugleich bekanntesten Songwriterin überhaupt, bislang unverständlicherweise erst ein Mal eine detaillierte Darstellung durch einen deutschsprachigen Autor zuteilgeworden ist – und das vor bereits dreißig Jahren. Auch in Amerika selbst oder England und Frankreich sucht man aktuelle Monographien vergebens. Diese Lücke möchte ich mit meinem Lebensbild der 1941 geborenen Amnesty-International-Preisträgerin, die man oftmals auch emphatisch als Königin des Folk, als barfüßige Madonna des Civil Right Movement, als neuzeitliche Jeanne d’Arc oder einfach nur als »das Gewissen« bezeichnet hat, um sie dann wieder als »Phoanie Joanie« zu verunglimpfen, gerne schließen.
Auch ihr Werk soll, gleichrangig mit der Betrachtung ihres so überaus ereignisreichen Lebens, im Vordergrund stehen: Den verschiedenen Kategorien, Sparten, Themenbereichen und Rubriken ihres Songkatalogs, einzelnen, wirklich herausragenden Chansons und Alben sowie Schwerpunkten ihres Schaffens widme ich zehn gesonderte Kapitel und Untersuchungen. Sie sollen Lust machen und Neugier wecken auf bereits vertraute und auch auf weniger bekannte Facetten ihrer Platten und ihres Live-Repertoires. Ihnen kann man sich losgelöst vom chronologischen Zusammenhang zuwenden; es handelt sich um Einladungen, sich eingehender mit politischen und ästhetischen Details des künstlerischen Universums von Joan Baez zu beschäftigen.
Baez’ faszinierender Parcours vom Folk-Festival in Newport bis zu den Live Aid Konzerten der 1980er, vom Gefängnis Sing Sing bis zu Dylans Rolling Thunder Revuen, von Woodstock bis Prag, von ihrem Debüt im Club 47 in Cambridge bis zum kriegszerstörten Sarajevo, wo sie 1992/93 mit Straßenkünstlern musizierte, beginnt zweifellos in ihrem stark christlich geprägten Elternhaus, in dem sozial verantwortliches Handeln tatsächlich gelebt wurde und das ihren späteren Werdegang entscheidend beeinflussen sollte. Etliche Umzüge und die damit verbundene Konfrontation mit anderen Lebensformen, Religionen und Moralvorstellungen, vom Irak nach Kalifornien, von Rom nach Boston, gehören zum Alltag der amerikanisch-schottisch-mexikanischen Familie mit den Eltern Albert Baez und Joan Bridge und den Töchtern Pauline, Joan C. und Mimi – die letztgenannte, ebenfalls talentierte Schwester wird als Mimi Fariña, Ehefrau und Muse des hochbegabten Interpreten und Autors Richard Fariña, später ebenfalls zu einer engagierten Musikerin. Und für Joan zu einer »Schwester im Geiste«.
Joan, als mittlere Tochter eines Mexikaners und Gegners der Rüstungsindustrie, der für die UNESCO arbeitete und seine Kinder bei seinen Auslandsaufenthalten mit der grimmigen Realität einer orientalischen Großstadt wie Bagdad konfrontierte, kommt früh mit der Philosophie und Denkweise Mahatma Gandhis in Berührung. Ihr Mentor Ira Sandperl, ein jüdischer Pazifist, unterweist sie in der Lehre Gandhis und schafft so schon sehr früh die Grundlagen für Joans künftiges Wirken. Parallel dazu hadert sie mit Weltanschauungen und Bräuchen der Quäker, zu deren Versammlungen sie ihre Eltern schleppen. Bereits zu Schulzeiten lehnt sie sich gegen autoritäre Strukturen und kriegsbejahende Aktionen auf.
Mit ihrem exotischen Äußeren eckt sie, eine dunkelhäutige und auch dunkelhaarige Schönheit, oftmals an. Und dennoch erfolgt ihr Durchbruch sehr früh, ziert schon 1962 ihr Konterfei das Cover des renommierten Time Magazine. Kurzzeitig ist sie in der Ostküsten-Boheme der späten 1950er und frühen 1960er Jahre verankert. Mit Anfang zwanzig ist sie ganz Amerika ein Begriff, zeitweise ist sie auch kommerziell höchst erfolgreich. Man bescheinigt ihr eine bemerkenswerte Frühreife. Man huldigt einer »engelhaften« Erscheinung und preist ihre makellose, ungekünstelte »Sopranstimme von fast schmerzhafter Reinheit«. Zu weiteren Markenzeichen werden ihr inbrünstiger, aber keineswegs frömmlerischer Vortragsstil, ihr »leicht tragischer Touch« sowie ihr selbstbewusstes, ruhiges und bestimmtes Auftreten – Einschüchterungsversuche ignoriert sie. Sanfte Beharrlichkeit, gepaart mit überraschender Widerborstigkeit, zeichnet sie aus.
Jegliche divenhafte Attitüde ist ihr bis heute fremd. Und einen echten Starkult, einen »Rummel um Baez« oder eine Baez-Hysterie hat es tatsächlich bislang noch nie gegeben.
Baez’ Vita wird bestimmt von den Wechselbädern der internationalen Politik, von internen Konflikten, gesellschaftlichen Trends und von dem sich so stark wandelnden Bild der Vereinigten Staaten in den siebzig Jahren zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Jetztzeit. Und ihre unprätentiösen Songs prägt eine gewisse Spielart der amerikanischen Musik – Folk, Traditional, Country, Protestsong, Arbeiterlied, »Anthem« –, wie sie auch in Europa zum Vorbild für eine ganze Generation von Liedermachern werden sollte. Songs, deren auf Plattenhüllen abgedruckten Texte man mitlas, auswendig lernte, guthieß, weitertrug und verinnerlichte. Musik in Form von Parabeln und Moritaten. Kurz, »music that matters« – Musik, die etwas bedeutete; Musik, auf die es wirklich ankam.
Wer Baez-Platten erwarb, jagte nicht irgendwelchen schnelllebigen Hits und musikalischen Eintagsfliegen hinterher, sondern kaufte Alben. Ihre Alben waren es, die man ausgiebig studierte, die sich auf den Plattentellern der Studentenbuden und Intellektuellen-Haushalte drehten und mit deren wechselnden Konzepten man sich kritisch auseinandersetzte. Ihre Alben waren es, die sich mal monate-, dann sogar jahrelang in den Charts hielten; ganz selten nur gelangen ihr vergleichbar nachhaltige Erfolge mit ihren Single-Auskopplungen.
Rasant war ihre Entwicklung von der Folk-Heroine und brillanten Fingerpickerin über das Sprachrohr der flower-power-Ära zur angesehenen Liedermacherin, zum rock singer und zur genuinen Songwriterin verlaufen – von traditionals über Standards bis hin zu selbstverfassten Miniatur-Kunstwerken und deklamierter Prosa bot sie ihren Hörern in sechs Schaffens-Jahrzehnten so ziemlich alles.
Inspiriert von Pete Seeger stand Baez, künstlerische Weggefährtin von Bob Gibson, Carolyn Hester oder Odetta, an der Spitze einer Bewegung in den USA und England, an der Peter, Paul & Mary, das Kingston Trio oder The Mamas & the Papas etwa, Phil Ochs, Donovan oder Melanie einen gewichtigen Anteil hatten. Viele dieser Interpreten sind, mitsamt ihrem musikalischen Vermächtnis, heute Geschichte. Nur Baez ist, wie ihr einstiger Liebhaber, Sangesbruder, ehemaliger Rivale und distanzierter Begleiter Bob Dylan, immer noch da und so präsent wie eh und je.
Dylan und Baez, der »Hobo« und seine »Johanna« – das ist ein Kapitel für sich. Ihre komplexe und oft komplizierte, wechselseitig stimulierende und phasenweise aber auch stark desillusionierende Beziehung hinterließ bei ihr Narben, die nur langsam verheilten, befeuerte allerdings ihre Kreativität zusätzlich. Wie überhaupt sehr unterschiedliche Männerfiguren in ihrem Leben eine bedeutende Rolle spielen: Dylan eben, dessen Faszinationskraft auf sie im Grunde bis heute anhält, und ihr Ehemann David Harris, ein überzeugter und mutiger Aktivist, ihr Vater Albert und ihr Sohn Gabriel Harris, ihr inspirierender Seelenverwandter und geistiger Wegbegleiter Ira Sandperl, ihr erster langjähriger Freund Michael New und nicht zuletzt der spätere Apple-Chef Steve Jobs, mit dem sie eine Liaison verband.
Zahlreiche Bilder von ihr sind um die Welt gegangen: Baez, wie sie im Lauf einer Tournee mit dem Beatnik-Poeten Allen Ginsberg ausgelassen quer durch Amerika tanzte. Baez als mysteriöse »Woman in White« in Dylans experimentellem, kontrovers diskutiertem Spielfilm Renaldo and Clara. Baez, wie sie in der Fußgängerzone des kriegsumtosten Sarajevo mit ergreifender Eindringlichkeit Amazing Grace sang. Baez, die Flüchtlingslager in Thailand und Malaysia besuchte, die in Kalifornien wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt gleich zweimal verhaftet wurde und die in Argentinien die verzweifelten Mütter der während der Militärdiktatur »verschwundenen« Kinder traf.
Baez, die sich mit Udo Lindenberg und Frank Zappa, mit Carlos Santana und Konstantin Wecker, mit Judy Collins und Bettina Wegner, mit Wolf Biermann und Paul Simon, mit Gianna Nannini und Gisela May, mit Santana und Franz Josef Degenhardt, mit B. B. King und Kris Kristofferson, mit Emmylou Harris und Jackson Browne die Bühne teilte. Baez und Leonard Cohen, beide im Schneidersitz. Eine enthusiastische Baez, auf dem Gipfel ihrer Popularität, eine unüberschaubare Menge aus Aficionados mit Charme und Charisma um den Finger wickelnd, vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame und auf der Place de la Concorde.
Eine mädchenhafte, langhaarige Baez, die mit Jimi Hendrix herumalberte, sich mit den Beatles traf und auch Mick Jagger Gesellschaft leistete, erscheint vor unserem geistigen Auge; eine kurzhaarige Baez, die gemeinsam mit Jack Nicholson den Vorhang für einen globalen Konzert-Event hob und wenig später mit Sting und Bono, mit Bryan Adams und Lou Reed andernorts eine Pressekonferenz gab, gleichermaßen. Baez ließ sich mit ihrer Songwriter-Kollegin Joni Mitchell in Big Sur ablichten und posierte, ganz entspannt, Jahrzehnte später in der Krone ihres kalifornischen Baumhauses. Weiterhin bietet sich eine prominente Baez, ihren frühen Ruhm genießend und Grimassen schneidend, bei einer späteren Ausgabe des Festivals von Newport den Betrachtern dar und, so aufmüpfig wie elegant, auf Plakaten die jungen amerikanischen Männer zum Ignorieren ihrer Einberufungsbefehle herausfordernd. Eine hoffnungslos verliebte, anmutige Baez, die einem auf der Schreibmaschine Songtexte tippenden Dylan von hinten die Augen zuhält, und eine von ihm auf seiner England-Tour ausgebootete, demoralisierte Baez, auf dem Rücksitz eines Taxis lustlos an einer Banane kauend. Baez – fürwahr eine omnipräsente Persönlichkeit der Kultur- und Zeitgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ob bei Open-Air-Darbietungen oder in Haftanstalten, ob im Bombenkeller oder in einem unbedeutenden Country-Club irgendwo im Mittleren Westen, sie trat so unbeirrt wie konsequent für die Sprachlosen und die Unsichtbaren, für Justizopfer und Unterprivilegierte ein. Ihren Prominenten-Status instrumentalisierte sie gezielt für aufsehenerregende politische Publicity, mutete ihren Fans dabei durchaus so manchen »heilsamen Schock« zu.
Die Bandbreite ihrer musikalisch-politischen Aktionen reicht vom Kampf gegen Todesstrafe, Armut, Militärdiktaturen, LGBT-Diskriminierung, den Einsatz von Landminen und den Irakkrieg über Plädoyers für den Umweltschutz, für Abrüstung und die vietnamesischen boat people bis zur offenen Unterstützung für Barack Obama im US-Wahlkampf. Darüber hinaus fungiert sie, die schon als ganz junge Frau im kalifornischen Carmel Valley das Institute for the Study of Nonviolence gründete, noch heute als Sponsorin des Zentralkomitees amerikanischer Kriegsdienstverweigerer. Selbst ein Award ist nach ihr benannt. Baez – auch ein Inbegriff von Seriosität.
Das Blatt wendete sich für sie – freilich nur kurzfristig – in den Achtzigern. Lediglich in der restaurativen Reagan-Ära war kaum noch Platz für Aktivisten und Persönlichkeiten ihres Ranges, war ihre kritische Stimme weniger gefragt, schien man in den USA auf ihre Präsenz getrost verzichten zu können. Nicht einmal ein Plattenvertrag war für sie in der amerikanischen Heimat seinerzeit in Sicht, obwohl sie zeitgleich in Europa auf zahlreichen Tourneen gefeiert wurde. Sie schien den Zenit ihrer Beliebtheit und Wirkungskraft erreicht und auch schon überschritten zu haben.
In den vergangenen drei Jahrzehnten ließ sie es dann etwas ruhiger angehen: Ab den Neunzigern war sie wieder zurück im öffentlichen Bewusstsein, publizierte neue Platten, wenn auch in größeren Abständen. Auch nach dem Jahrtausendwechsel hielt sie in den USA mit ihren eigensinnigen, originellen Statements nicht hinterm Berg. Heute – die Vollendung ihres achten Lebensjahrzehnts steht unmittelbar bevor – vergeht kaum ein Jahr ohne ausgedehnte Baez-Tournee, sowohl zu Hause als auch in Europa, äußert sie sich zu allen zentralen Fragestellungen unserer Zeit, ist bei Occupy ebenso präsent wie bei den Women’s Marches, macht sich weiterhin für bedrohte Menschengruppen und aktuelle Ziele stark. Erläutert interessierten Nachgeborenen mit großer Geduld ihre Beweggründe für ihre unablässige Bereitschaft, Widerstand zu leisten. Noch hat es nicht den Anschein, als sorge sie sich um die Gestaltung »der Zeit danach«. Comebacks waren bisher nicht nötig.
Im Mai 2015 wurde Baez die bis dato größte Ehrung zuteil: In Berlin verlieh man ihr den prestigereichen Ambassador of Conscience Award. Ihre Laudatorin Patti Smith titulierte die Ausgezeichnete bei der Preisverleihung als »kleinen schwarzen Schmetterling«. Gleichwohl ein Schmetterling mit beträchtlicher Kraft und Energie. Bewegt sein wirkungsmächtiger Flügelschlag doch bereits seit 1959 die Herzen, Seelen und Hirne von Millionen ihrer Anhänger.
Drei Joans in unterschiedlichen Lebensabschnitten begegnen uns in den Medien und in Dokumentarfilmen, auf Plattenhüllen, auf Fotos und bei Konzertmitschnitten seit Langem schon auf Schritt und Tritt: drei beeindruckende Erscheinungen und doch drei Ausprägungen derselben Künstlerpersönlichkeit. Das junge, langhaarige Mädchen mit der indianischen Ausstrahlung und einer phänomenalen Stimme, das noch etwas linkisch in die Kameras strahlt, aber bereits große Kunst produziert und ihr Publikum für sich einzunehmen vermag. Die gewinnend auftretende, mit großer Verve agierende junge Frau und Aktivistin auf den Bühnen und Kriegsschauplätzen gleich mehrerer Kontinente, für deren Erscheinung Wolf Biermann das schöne Bild von der »streitbaren Nachtigall« gefunden hat. Und die große alte Dame mit dichtem grauem Kurzhaar, trotz ihrer zierlichen Statur und offenkundigen Verletzbarkeit so respekteinflößend und unnachgiebig, so aufmerksam und interessiert, so beherzt und eigenwillig wie eh und je. Eine moralische Instanz, an der niemand vorbeikommt.
Längst stellt diese Dreifach-Joan natürlich viel mehr als die Summe aller Lieder dar, die sie jemals dargeboten hat. Ihr stets an den Tag gelegtes Understatement entspricht ihrer schon sprichwörtlichen Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit, doch fraglos haben wir es bei diesem »Engel der Friedensbewegung« inzwischen mit einer Gigantin zu tun. Nicht mit übertriebener Ehrfurcht sollte man ihr aber begegnen, sondern mit zwei Eigenschaften, wie sie sie schon immer ausgezeichnet haben: Offenheit und Neugier.
Als literarisch-musikalischer roter Faden möge mir daher eine unfreiwillige Selbstdefinition der noch ganz jungen Baez dienen, die, bei einer Pressekonferenz im Umfeld eines Auftritts, den Ansturm allzu vorwitziger und vorschnell urteilender Reporter wirkungsvoll abwehrte. Nur zu gern hätten sie der unbeugsamen Bürgerrechtlerin einen Empfang als Star bereitet – »Star«, das war jedoch genau jene Schublade, in die sie sich nicht stecken lassen wollte.
»Wenn man schon Etiketten für mich braucht«, so wies sie die Journalisten so amüsiert wie schlagfertig zurecht, »dann zuerst bitte ›menschliches Wesen‹, gefolgt von ›Pazifistin‹, und wenn immer noch eins benötigt wird, na gut, meinetwegen ›Folksängerin‹.«
In dieser Reihenfolge ein geradezu idealer Leitsatz für mein Baez-Porträt.
1Bei der umfangreichen und einzigartigen, vom US-amerikanischen Volkskundler Childs (1825–1896) zusammengetragenen und ab 1857/58 in Einzelbänden publizierten Anthologie von mehr als dreihundert Titeln handelt es sich um die Aufzeichnung amerikanischer Varianten vormals englischer und schottischer Balladen – im Vergleich mit den Originalen. Nicht zuletzt durch ihre stilistische Vielfalt, ihre melodische Bandbreite, ihren populären Tonfall und ihren thematischen Facettenreichtum lieferten sie, als wahre Fundgrube, eine der Grundlagen für das Folk Revival, wie es Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzte. Interpreten wie etwa Burl Ives (um 1949), Ewan MacColl (1956), John Jacob Niles (1960) und Baez (auf ihren ersten Alben und bei ihren frühen Auftritten) sorgten dafür, dass ein neuzeitliches Publikum mit den attraktiven – und dabei teils archaischen, teils düsteren, teils noch immer einen Aktualitätsbezug aufweisenden Balladen – Bekanntschaft schließen konnte.
Um 1960.
Daumenkino:»Nur ich und meine Gitarre«
Singen heißt Lieben und Zustimmen, Fliegen und Schweben.Singen heißt in die Herzen der Zuhörer findenund ihnen klarmachen,dass das Leben gelebt werden muss,dass es Liebe gibt,dass nichts versprochen ist,dass aber die Schönheit existiertund aufgespürt und entdeckt werden will.
Anfeuern
Crawford in Texas, August 2005: Mitten im Hochsommer campen bei brütender Hitze Hunderte von Kriegsgegnern, Oppositionellen und Friedenskämpfern in einem provisorischen Zeltlager an der Zufahrtsstraße zur Prairie Chapel Ranch, dem Ferien-Wohnsitz von US-Präsident George W. Bush. Zeitgleich ist die Besetzung des Iraks, die sich 2003 nahtlos an die völkerrechtlich fragwürdige Militärinvasion der Alliierten und den Sturz von Saddam Hussein anschloss, in vollem Gange. Täglich sterben im Irak auch weiterhin Dutzende von Menschen dies- und jenseits der Fronten qualvolle Tode, und ein Ende des Elends ist nicht abzusehen.
Die empörten Aktivisten, von denen einige schon seit Wochen ausharren, möchten von ihrem Staatsoberhaupt endlich wissen, wie lange der Konflikt mit seinem sinnlosen Morden noch weitergehen soll und warum ihre Söhne, Väter und Brüder entweder im Kampf oder bei »Friedens«-Missionen im Irak umgekommen sind. Sie zählen die Toten, dokumentieren das Grauen und verzeichnen diese Statistiken auf ihren Pappschildern, Plakaten und Fahnen; sie wollen dem Konflikt auf der anderen Seite der Weltkugel unverzüglich Einhalt gebieten. Sie möchten verhindern, dass die Jüngsten und Besten der Nachwuchs-Generation in eine mörderische Falle geschickt werden. Bush, der nur wenige Kilometer vom Camp entspannt einen fünfwöchigen Urlaub verbringt und bei jedem Ausflug mit seiner Wagenkolonne an den johlenden Protestlern vorbeifahren muss, kann ihnen keine befriedigende Antwort auf ihre bohrenden Fragen geben. Einige von ihnen hat er schon empfangen und ihnen etwas über »die noblen Gründe« erzählt, die angeblich auch künftig die Präsenz von amerikanischen Soldaten rechtfertigen würden. Abgenommen haben sie ihm das nicht. Während er fischen geht und sich auf seiner Ranch erholt, sterben – so sehen seine zornigen Zaungäste die Lage – durch seine Politik stündlich Zivilisten und Besatzer.
Allen voran zweifelt Cindy Sheehan, die Mutter des 24-jährigen Casey, am Sinn des Irak-Krieges und seiner unheilvollen Folge-Aktionen; auch hegt sie Zweifel an den wahren Beweggründen für die Invasion und die andauernde westliche Präsenz. Casey, stationiert in Sadr City, einem Vorort von Bagdad, war im April 2004 gefallen, als er verwundete Militärangehörige in Sicherheit bringen wollte. Sheehan kann seinen Tod weder begreifen noch hinnehmen. Sie wird solange die Zufahrtsstraße blockieren und immer mehr fröhliche Picknicker und aufgebrachte Mitstreiter aus allen Landesteilen in ihrem Camp um sich versammeln, bis Bush einlenkt und sie zu einer persönlichen Unterredung empfängt. Sie verlangt, dass er ihr seine Meinung ins Gesicht sagt. Von ihm möchte sie hören, wer genau oder welche Staatsräson ihren Sohn auf dem Gewissen hat. Noch hat er ihrem Gesuch nicht stattgegeben. Dass Sheehan sich stur zeigt und zum Bleiben entschlossen ist, macht die Regierung zunehmend nervös. Die mediale Präsenz steigt täglich an, auch internationale Reporter sind inzwischen vor Ort; die Temperaturen überschreiten bereits morgens die 40-Grad-Grenze; die Spannung ist unerträglich, und dennoch herrscht fast so etwas wie Partystimmung. Abends wird gegrillt; tagsüber sucht man Abkühlung; nachts zieht man sich in behelfsmäßige Unterkünfte zurück. Alle tragen Trägerhemden und kurze Hosen; einige fürchten gar einen Hitzschlag. Slogans werden skandiert und Petitionen herumgereicht, Getränke werden verteilt, und man tauscht sich, mehr oder weniger aggressiv, mit den Bush-Befürwortern auf der anderen Seite der Straße aus. Im Fernsehen spricht man von nichts anderem mehr als dem »Camp Casey« und seiner mutigen, dickköpfigen Peace Mom.
Sheehan reichte die stille Trauer nicht. Mit Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit gab sie sich nicht zufrieden. Sie verwandelte ihren ohnmächtigen Schmerz in Tatkraft. Sie gründete eine Zeltstadt und kommunizierte mit Bush, auf virtuelle Weise, mithilfe der Journalisten aus allen Landesteilen. Sie begab sich auf Konfrontationskurs. Ließ hier, unweit einer verschlafenen texanischen Ortschaft »in the middle of nowhere«, Kreuze aufstellen, auf denen die Namen der Kriegstoten zu lesen waren. Mahnmale in leuchtendem Weiß. Und jetzt bekommt sie, aus heiterem Himmel, doch noch prominenten Besuch. Nicht der Präsident ist es freilich, der Cindy aufsucht und sich im stickigen Zelt den Leuten zuwendet, die sich unterhalb einer improvisierten Bühne mit erwartungsvollen Blicken versammelt haben. Joan Baez ist da und hat ihre Gitarre mitgebracht. Zu Bagdad und dem Irak hat sie seit ihrer Kindheit ein enges Verhältnis. Was dort geschieht, betrifft sie unmittelbar. Auch sie ist nur leicht bekleidet und schwitzt wie alle anderen. Sie setzt einen weißen Cowboyhut auf, steht für Fotos zur Verfügung, lässt sich von Sheehan in den Arm nehmen. Sie sucht das offene Gespräch, unterhält sich mit Veteranen, Müttern und Kindern, schüttelt Hände, umarmt Untröstliche. Gibt Interviews, spricht Trost zu, hat für jeden ein freundliches Wort, hält inne, um das weit ausgedehnte Feld aus weißen Kreuzen zu betrachten – eine Armee stummer Ankläger. Viele drängen sich an sie heran; Soldatenwitwen, Veteranen und Mütter von Kriegsopfern suchen den Kontakt mit ihr.
Und dann singt die damals Vierundsechzigjährige, selbstverständlich gratis, ein halbes Dutzend Lieder, auf die alle gewartet haben, die in dieser schweren Zeit passen wie die Faust aufs Auge und die alle so gut kennen, dass sie gleich mit einstimmen können: Joe Hill und Gracias a la vida, Where Have All The Flowers Gone? und Last Night I Had The Strangest Dream. Swing Low, Sweet Chariot trägt sie allein, ganz ohne Begleitung vor, hebt die Hand und dirigiert ihr ergriffenes Publikum, findet mit den uralten Strophen instinktiv die richtigen Worte für die zwischen Wut, Desillusionierung und Verzweiflung schwankenden Aktivisten. Ausgerechnet bei ihrer eigenen Nummer, dem berühmten Diamonds & Rust, geht ihr auf einmal eine Textzeile verloren, fehlen ihr dann, für wenige Takte nur, die Worte. Eine Zuhörerin hilft ihr aus der Patsche, Baez nimmt die Leerstelle – in der es bezeichnenderweise um Erinnerung, Vergegenwärtigung und Vagheit geht! – mit Humor. Die Luft ist wie zum Schneiden unter der dünnen Plane, Baez bald am Ende ihrer Kräfte, aber die Menschen im Zelt sind glücklich, ja euphorisiert – und fühlen sich endlich von jemandem ernst genommen.
Als sie im klassischen Protestsong Last Night einen utopischen Traum schildert, in dem alle Machthaber auf dieser Erde sich auf einen dauerhaften Waffenstillstand einigen und das Ende aller Kämpfe verkünden, wird es noch eine Spur stiller unter dem sonnendurchglühten Zeltdach. Wie die Menschen in Ed McCurdys bekanntem Lied würden auch die Bush-Gegner von Crawford am liebsten augenblicklich einen Freudentanz aufführen, Kopien eines historischen Friedensvertrages verteilen und Gewehre, Schwerter wie Uniformen ein für alle Mal zu Boden schleudern. Für die Dauer des kleinen Konzertes, das die schmächtige grauhaarige Frau ihnen zu Ehren gerade aufführt, mögen sie beinahe im Ernst daran glauben. Baez verkörpert Zuversicht und Freude; ihr Vortrag wirkt anstachelnd und vermittelt den Campern das Gefühl, etwas Richtiges, Konstruktives und Zukunftsweisendes in Gang gebracht zu haben.
Baez, die hier lediglich eine von ihnen sein möchte, bezeugt durch ihren historischen Stellenwert die Glaubwürdigkeit ihres Unterfangens. Sie verscheucht Schwarzseherei und Mutlosigkeit. Sie leuchte noch immer wie von innen, konstatiert ein anwesender Spiegel-Reporter. Erst in Baez, mit ihrer unnachahmlichen Präsenz und Ausstrahlung, hat Sheehan ihre ideale Unterstützerin und Fürsprecherin gefunden. Die Bewunderung ist gegenseitig: Sheehans Widerstandsgeist hat Baez in die Einöde von Camp Casey geholt. Der Protest der Mutter sei für sie »die letzte Träne gewesen«, die das Fass zum Überlaufen gebracht habe, und »fließendes Wasser kann man einfach nicht aufhalten«. Baez zeigt sich auch beeindruckt vom Ausmaß der Bewegung – für den ersten Friedensmarsch gegen den Vietnamkrieg, an dem sie sich seinerzeit beteiligt hatte, seien gerade einmal zehn Demonstranten erschienen. Hier nun sind es mehrere hundert Idealisten, die eine Blockade aufrechterhalten und den Verkehr rund um Bushs Ranch lahmlegen.
Baez’ solidarische Visite bringt die Leute keineswegs dazu, ihr gegenüber in Ehrfurcht zu verharren. Aber ihre Lieder nehmen ihnen eine große Last von den Schultern, stärken sie für die noch vor ihnen liegenden Tage und Herausforderungen.
Mitreißen
Vorhang auf für eine ganz andere Szene: Ulm, direkt an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, 1978. Wieder ein Augusttag. Wieder meint es die Sonne gut mit einem hochgestimmten, erwartungsvollen Publikum. Diesmal sind es an die 60 000 Zuhörer, die erschienen sind, um Frank Zappa und Genesis in einer alle Dimensionen sprengenden Rock-Show zu erleben. Junge Leute, die gut drauf sind, die trinken, tanzen, fummeln, in Ekstase geraten, ausflippen und sich möglichst schnell »zudröhnen« wollen. Und zwischendurch soll eine Dreiviertelstunde lang Joan Baez kurz vor Sonnenuntergang ihr Programm abspulen, das so gar nicht zu dem ohrenbetäubenden, harten Sound des Abends passen will. Lieder von Simon & Garfunkel, Dylan, den Beatles, deutsche Protestsongs … Wie soll das funktionieren, wen wird diese kammermusikalische Einlage hier, bei einem Open-Air-Spektakel der Superlative, schon interessieren? Die großen Stars, das sind hier die anderen. Ihr werden die Knie weich.
Ihr deutscher Konzertveranstalter Fritz Rau, inzwischen ein enger Freund, spricht beruhigend von einem »Experiment« und schließt hinter ihrem Rücken bereits Wetten ab, dass sein amerikanischer Schützling, den er zärtlich »Schmetterling« nennt, vielleicht doch nicht ausgebuht werden wird – seine Kollegen hinter den Kulissen sind aber genau davon überzeugt. Schmetterling Baez glaubt indessen, wie Raus Wettbrüder, an eine bevorstehende Katastrophe. Sie hat bereits Schwierigkeiten, mit der nötigen Ruhe und Konzentration ihre Gitarre zu stimmen, so laut ist der Sound, den Bürgerschreck Zappa und seine Band verbreiten. Nach der dritten Zugabe verlässt ihr schnauzbärtiger Vorgänger, trunken vor Glück, unter tosendem Beifall die Bühne. Die Dämmerung setzt ein, ein schwarzer Vorhang wird heruntergelassen, Baez betritt zaghaft ihren Platz vor dem Mikrofon. Innerhalb der vielen Drum-Sets, Keyboards und Verstärker kommt sie sich verloren und überflüssig vor. Mit den Technikern, die natürlich wissen, wen sie da vor sich haben, tauscht sie vielsagende Blicke. Mitleid? Ermunterung? Respekt? Einen Soundcheck benötigt sie nicht. Ein Gesangs-Mikro sowie ein Tonabnehmer für ihr Instrument genügen. Die Massen vor ihr, so viel ist sicher, warten mit zunehmender Ungeduld auf Genesis, stellen sich bestenfalls auf einen Pausenfüller ein – auf Gesang zum Überbrücken. Auf Belangloses während der Umbaupause. Unruhe kommt auf. Manche sind bereits jetzt betrunken, grölen und schwanken. Viele kehren ihr den Rücken zu oder wandern ab. GIs ziehen in kleinen Gruppen von einem Ende des riesigen Felds zum anderen. Da steht sie nun, ganz allein »mit ihren sechs Saiten« und »zwei Stimmbändern«. Sie räuspert sich und startet mit einem Lied, das keiner kennt und auch keiner zur Kenntnis nimmt. Der Startschuss geht nach hinten los.
Baez, für ihren Freund Rau nicht umsonst die »personifizierte Zivilcourage«, lässt sich nicht ins Bockshorn jagen und macht weiter. Applaudiert wird kaum, aber auch noch nicht gepfiffen. »Ich befahl mich und mein Schicksal in Gottes Hände.« Sie testet ein paar Schlagworte wie »Rock ’n’ Roll« oder »Woodstock«, erntet ein paar höfliche Zurufe und entwickelt so allmählich ein Gefühl dafür, wohin heute Abend für sie die Reise gehen könnte. Es wird eine Fahrt ins Ungewisse, und nur sie selbst kann das Tempo bestimmen. Sie feiert kleine Etappensiege. Bei Joe Hill horchen einige spürbar auf, beim ersten Dylan-Song ebbt der Lärm deutlich ab. Bei Sag mir, wo die Blumen sind, werden auch noch die letzten Zwischenrufer von Umstehenden mit entrüstetem Gezische zum Schweigen gebracht. Als sie Swing Low, Sweet Chariot intoniert, sitzen die meisten bereits, wächst die Aufmerksamkeit. Dann kippt die Stimmung zu ihren Gunsten, kontrolliert nur noch sie den Spannungsbogen. We Shall Overcome wird bereits von einzelnen Grüppchen von ihr eingefordert, wenige Minuten später hat sie die Menge in der Hand. Und hat selbst die Skeptiker und Ignoranten erobert. Die meisten haben längst mit dem Trinken aufgehört, »und auch von den Rowdys« ist »kein Laut mehr zu hören«. Viele singen oder summen mit. Baez bezieht, durch freundlichen Zuspruch, sogar Menschen ein, die sich außerhalb des Festivalgeländes, kaum dass ihre Stimme zu ihnen vordringt, an die Zäune gedrückt haben oder ihr von einer weit entfernten, gerade noch wahrnehmbaren Uferböschung zuhören. Alle, die direkt vor ihr stehen, haben auf einmal Tränen in den Augen, und bald kann sie auch ihre eigenen nicht mehr zurückhalten. Behutsam, aber ohne lockerzulassen, zieht sie einen nach dem anderen in ihren Bann. »Im Herzen der älteren Leute« hat sie eine Saite angeschlagen und zum Schwingen gebracht, »und die jüngeren, diejenigen, die gerade erst zehn waren, als es Sommer in Woodstock war«, spüren dies – eine Welle ungeordneter, kaum erklärbarer Emotionen erfasst die Nachgeborenen. Ein unbestimmtes Gefühl – Sehnsucht, Nostalgie, die Ahnung von etwas »Größerem«, Erhabenerem – überträgt sich auch auf sie.
Warum aber weinen diese so verschiedenen Menschen, warum röten sich ihre Wangen wie auf Befehl, warum werden nahezu alle von Rührung übermannt? »Warum? Wegen all der Jahre, die sie verpasst haben«, oder wegen der selbst erlebten Jahre, die ihnen jetzt schon fehlen wie ein alter Freund, den man schmerzlich vermisst? »Für all die ›Blumenkinder‹ in Amerika, die sie romantisiert und nachgeahmt« haben? »Für Erinnerungen, die eigentlich ihren Eltern, Tanten und Onkeln gehörten, aber nicht ihnen? Vielleicht.« Tausende sind hingerissen. Und die meisten von ihnen haben jetzt intuitiv verstanden, worum es vor langer Zeit ging, nicht nur in Woodstock, und ein Gespür dafür entwickeln können, worauf es auch weiterhin ankommt. Dank dieser Stimme der Baez, die einen kaum loslässt, die das euphorisierende Gefühl von Großzügigkeit, Freiheitswillen und Idealen transportiert. Schrittweise hat sie, ganz unauffällig, den Kulminationspunkt erreicht. Und nun ist die Dreiviertelstunde um. Sie verbeugt sich, geht ab, kehrt zurück, verbeugt sich wieder, weiß gar nicht mehr, wohin mit sich.
Am Ende springen die Zuhörer wie auf Kommando auf, toben, jubeln, klatschen sich die Hände wund. Jetzt geht die Party »erst richtig los«. Baez selbst ist überwältigt, erschöpft und wie benommen, als sie von der Bühne abgeht, wo ihr Zappa gratuliert; Rau ist sprachlos. Die meisten in ihrem Team haben rotgeränderte Augen, umarmen sie oder schütteln fassungslos die Köpfe. Und als dann die leeren Bierdosen gleich dutzendweise auf die Bühne fliegen, als das Ulmer Publikum lautstark zu trampeln beginnt und damit selbst noch Sprechchöre und ein gellendes Pfeifkonzert übertönt, muss man ihr erst erklären, dass diese plattgetretenen »Rosen aus Blech« einer ruppigen Liebeserklärung gleichkommen: Sie muss sofort wieder zurück auf die Bühne; die Zuhörer haben noch lange nicht genug von ihr. Ihr Manager duckt sich, um dem Bierdosenhagel auszuweichen, als er sie erneut ankündigt. Diesmal aber mit stolzgeschwellter Brust – er hat seine Wette gewonnen. Niemand kann es so richtig fassen, sie selbst schon gar nicht, aber nicht weniger als sieben Zugaben ringen die Fans ihr ab. Aus den geplanten fünfundvierzig sind neunzig Minuten geworden, aus dem unauffälligen Zwischenakt ein Highlight. Die Veranstalter fluchen und sind doch hochzufrieden. Sie müssen schließlich energisch einschreiten, damit man Baez endgültig ziehen lässt.
Die Umjubelte klemmt sich ihre Gitarre wieder unter den Arm und verschwindet offstage. Bahnt sich ihren Weg durch die Wohnwagen der Musiker, lange nicht so unbemerkt wie noch zwei Stunden zuvor. Schon befürchtet sie, ihren Mitstreitern »die Show gestohlen« zu haben, und so kann sie es an den Folgetagen auch in der Presse nachlesen … Diese Show, die es in sich hatte, wird sie eines Tages zu ihrem Song Children of the Eighties inspirieren. Doch jetzt kann sie erst einmal aufatmen, durchatmen. Der Rest des Abends versinkt dann in einem Nebel verwirrter Zufriedenheit; die laue Sommerluft vermischt sich mit dem Duft deutscher Grillwürstchen. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum ist die 37-jährige Joan Baez bei diesem Sommerkonzert zur Sensation geworden. Nicht das erste und auch nicht das letzte Mal.
Verteidigen
Wir springen noch einen großen Schritt weiter in die Vergangenheit: Ost-Berlin, Chausseestraße, Mai 1966. Just am Tag der Arbeit – Ironie des Schicksals für jemanden, der vom Singen lebt und von dem Staat, in dem er lebt, ständig daran gehindert wird – läutet es nachmittags an der Wohnungstür des regimekritischen Liedermachers Wolf Biermann. Seit einigen Monaten ist der knapp Dreißigjährige durch ein Auftrittsverbot zusätzlich isoliert; nun steht ihm auf einmal eine lebende Legende gegenüber, direkt aus Kalifornien eingeflogen. Oder, in seinen eigenen Worten: »die weltberühmte Joan Baez« und »schöne Klassenfeindin aus den USA« dem »Nobody Biermann«. »Die legendäre Folksängerin besucht den« aufmüpfigen Songwriter, »den man grade in die Tonne getreten hat!« Die »singende Venus aus Amerika« begehrt Einlass in sein realsozialistisches Wohnzimmer. Mithin eine Begegnung auf Augenhöhe? Zwischen zwei politischen Poeten? Zwischen zwei Barden, wie sie verschiedener nicht sein könnten und die doch so unglaublich viel gemeinsam haben? Gitarristin »meets« Gitarristen?
Dafür spricht so ziemlich alles. Dagegen sprechen vorerst freilich die aktuellen Bedingungen und Einschränkungen. Eine in Freiheit lebende Couragierte trifft einen in einem Unrechtsstaat lebenden Mutigen, doch aufgrund seiner misslichen derzeitigen Situation eben leider oft auch Verzagten. Einen begabten Mann, dem man mit Verunsicherungen zusetzt und der täglich mit der Furcht klarkommen muss, von der Staatssicherheit eingebuchtet zu werden. Baez erscheint ihm wie ein Engel aus einem anderen Teil der Welt – in dem gewiss ganz und gar nicht alles rosig ist, in dem jemand wie sie aber selbstbewusst und vorlaut sein und den Mund aufsperren darf. Was sie momentan ja auch wieder unter Beweis stellt. Die Fünfundzwanzigjährige und wie gewohnt Unparteiische, die sich gerade an einem bundesdeutschen Ostermarsch beteiligt hat, ist in diesem Frühjahr beiderseits der Mauer öffentlich zu hören: In Westberlin singt sie im Sender Freies Berlin für den Deutschen Gewerkschaftsbund und leiht dort auch den Berliner Falken, die Baez für eine Antikriegsveranstaltung eingeladen haben, ihre Stimme; im Osten der geteilten Stadt ist sie Ehrengast des Staatskabaretts Distel, wo sie noch am selben Abend von zweihundert geladenen – also handverlesenen, ideologisch zuverlässigen – Zuhörern erwartet wird.
Man will damit prahlen, die große Baez an diesem symbolträchtigen Datum präsentieren zu können: hier und nicht im Westen! Eigentlich ist der intime Zuschnitt des Gastspiels grotesk, denn Abertausende von DDR-Bürgern hätten ihr selbstredend gern in weitaus größerem Rahmen gelauscht, in einem Stadion oder in einer Konzerthalle; die SED-Führung aber befürchtete Zwischenfälle und entschied sich zuvor für eine kleine, unverfängliche Veranstaltung für Regimetreue, Parteikader und Kulturfunktionäre. Organisiert vom ostdeutschen Fernsehfunk. So braucht die Regierung sich gar nicht erst aufs politische Glatteis begeben, und die Gefahr, dass unliebsame Äußerungen oder brisante Darbietungen auf fruchtbaren Boden stoßen könnten, womit man bei einem populären Baez-Konzert rechnen muss, wird gleich im Keim erstickt. Vorbeugung ist, im Arbeiter- und Bauernstaat Walter Ulbrichts, noch immer die wirksamste Propaganda.
Baez, deren Auftrittsvorbereitungen in der Distel bereits abgeschlossen sind und die den kurzen Weg von der Friedrichstraße zu Biermann mit zwei amerikanischen Freunden zurückgelegt hat, nimmt sich erstaunlich viel Zeit für ihren Kollegen, den verbotenen Bänkelsänger – gewiss hat sie zuvor von dessen vorangegangener Festnahme gehört und davon, dass man ihn systematisch davon abhält, Ostberliner Kulturereignisse selbst als Zuschauer aufzusuchen. Ihre Visite ist solidarischer Natur: Wie keine andere kann sie nachfühlen, was es heißt, persona non grata zu sein. Als unerwünscht deklariert zu werden, wenn man doch unbedingt singen und sich mitteilen möchte. Mundtot gemacht zu werden, wenn man von orientierungslos gewordenen Menschen sehnsüchtig erwartet wird und eben auch jede Menge zu sagen hat. Maulkörbe, das bedeutet sie Biermann, sind für sie einfach nicht akzeptabel – egal auf welchem Kontinent.
Auf Anhieb sind sie einander sympathisch. Von Berührungsängsten keine Spur. Trotz der Sprachbarriere kommt man sich schnell näher; Biermann erlebt eine aufmerksame und wissbegierige Joan Baez, fühlt sich von ihr künstlerisch geradezu liebkost und auch inhaltlich verstanden. »Als ich ihr dann mein ›Barlach‹-Lied vorsang, sägte die scharfe Melodie sich in ihre Seele. Die zwei Tränen im Auge« seiner »Besucherin«, die er schon damals als »Ikone« wahrnimmt, »waren mein Honorar«. Die »Sprache der Lieder« ist ihr beider Verständigungsmittel, eine musikalisch-poetische lingua franca; und was mit Gitarren gemeint sein soll, die man sich am liebsten wie Geliebte durch die Gitterstäbe hindurch herbeizaubert, braucht man einer Joan Baez nicht erst umständlich zu erklären. Für Biermanns spezifischen Gebrauch von Lyrik, die Wahl seiner Ausdrucksmittel und sein Idiom hat sie ein offenes Ohr. Je mehr er ihr vorsingen darf, desto ermutigter fühlt er sich. Mit seiner Preußischen Romanze nimmt er sie für sich ein. Und sein vertrauter »Flamenco-Sound im fremden Deutschland gefiel der Baez, denn sie selbst hat ja mexikanische Wurzeln«. Joan ist auch deshalb so neugierig auf Wolfs Chansons, da sie selbst ja gerade erst damit anfängt, eigene Songs zu schreiben. Sie revanchiert sich, indem sie ihm ihr ausgefeiltes Fingerpicking demonstriert und als Geschenk »ein Set Stahlkrallen für die Finger der rechten Hand« für ihn dabeihat. Geben und Nehmen – ein idealer Austausch. Die beiden sind literarisch, musikalisch und politisch füreinander entflammt. Genießen Interesse, Einverständnis und das Gefühl einer geschwisterlichen Zusammengehörigkeit.
Schade nur, dass die kostbare Zeit füreinander so schnell um ist. Biermanns Gäste müssen los, der Beginn der Veranstaltung steht kurz bevor. Er selbst hätte sowohl mit als auch ohne Eintrittskarte keine Chance, dem Recital beizuwohnen; er sollte sich wohl auch besser davor hüten, am Eingang der Distel eine unnötige Szene zu machen. Womit er indessen nicht gerechnet hat, ist Baez’ Entschlusskraft und Unbekümmertheit. Für sie ist es ausgemachte Sache, dass ihr freundlicher, kluger Gastgeber mitkommt und auch im Innern des Kabaretts Platz findet. Ein Ticket für den Verfemten hat sie auch. Ungläubig stolpert Biermann, ihr aufmunterndes »Let’s go!« noch in den Ohren, seiner »heiligen Johanna mit der Gitarre« hinterher. »Sie packte mich, zottelte mich Angsthasen resolut die Treppe runter.« Durch für ihn wohlbekannte Berliner Gefilde eilen die vier der Höhle des Löwen entgegen. Und ehe Biermann es sich versieht, landet er, nach einem sehr unangenehmen Geplänkel mit Stasi-Mitarbeitern in Zivil und einer geharnischten Intervention seiner »Athena im Zorn«, gespickt mit Drohungen und Verwünschungen auf Englisch, worauf sich auf einmal wie durch Zauberhand Tür und Tor für das Paar öffnen, im Inneren dieser Höhle. Biermann ist drin, darf zuhören. Seine Resignation ist wie weggewischt. Die Saalordner, überrumpelt von Baez’ kühnem Eingreifen, wirken machtlos. Zu prominent ist der Gaststar, als dass sie es auf einen Eklat ankommen ließen: Die Augen der internationalen Presse richten sich nun erst recht auf den Distel-Abend, der ungewöhnlich stachlig auszufallen verspricht. »Arm in Arm«, so die westdeutsche Zeit, betreten die beiden »das Kabarett. Die Fernsehfunktionäre reagierten mit betretenem Schweigen und hektischer Ausgelassenheit. Niemand verwehrte Biermann den Einlass in die ›Distel‹. Die Amerikanerin hatte allerdings auch keinen Zweifel daran gelassen, dass sie nur im Beisein des Lyrikers auftreten werde.«
»Zähneknirschend« notierten die Agenten, wie er »sich in die letzte Saal-Reihe setzte«. Nun ist es an Biermann, zu staunen. Über die Professionalität und Authentizität von Baez’ Vortrag. Über die phänomenale Qualität ihres Gesangs. Über die Aura, die von ihr ausgeht. Über das geschmeidige, pausenlose Ineinandergreifen von Songs, kurzen Einführungen und gewandten Übersetzungen durch einen smarten Dolmetscher, der selbst Sänger und Schauspieler ist. Und nicht zuletzt über ihren Mumm: Denn auf einmal hört er sie klar und deutlich sagen, dass sie ihr nächstes Lied einzig und allein für ihn, den Unerwünschten, singen werde. »Für Wolf Biermann, den ich heute Nachmittag in seiner Wohnung besucht habe.« Ihr unverwandter Blick ruht auf ihren Zuhörern; Baez lässt sie nicht aus den Augen. Der missliebige, nun aber von ihr in aller Öffentlichkeit geadelte Poet, die Stasi-Beamten, das wie vom Donner gerührte Publikum und der sprachlose Übersetzer – sie alle trauen ihren Ohren kaum, als Baez übergangslos als explizite »Widmung« an »ihren Freund« die Hymne Oh, Freedom anstimmt. Als sie »Mister Biermann« und seinen hinter der Berliner Mauer eingepferchten Landsleuten das uralte Gleichnis vom eingekerkerten Sklaven, der allein wegen seines tiefen Glaubens sich im Geiste nie versklaven lassen wird und zugleich die ewige Freiheit preist, beherzt darbringt. Lied und Hommage sind zuvor selbstverständlich nicht abgesprochen gewesen. Ein empfindlicher Schock für die Veranstalter. Biermann ist gerührt und auch betroffen, seine Landsleute im Saal bekommen vor lauter Schreck kaum ein Wort heraus, und der Übersetzer verzichtet wohlweislich auf die Wiedergabe von Baez’ tollkühnem Statement und den nicht minder rebellischen Freedom-Zeilen. Die explosiven englischen Worte bleiben unwidersprochen im Raum stehen. Doch die Kameras laufen weiter, zeichnen alles auf. Die Panne lässt sich nicht mehr beheben. Jetzt ist der Skandal perfekt.
Und es soll noch besser kommen. Baez lässt die Presse wissen, was für »ein großes Erlebnis« das Treffen mit Biermann für sie gewesen sei. Eine weitere Herausforderung. Zwar spricht sie seinen Namen »Bärmann« aus, aber jeder weiß, wer hier gemeint ist. Ihr Einsatz für ihren Kollegen geht ein gehöriges Stück weiter. »Ich bedauere«, führt seine Beschützerin aus, »dass er in Ostberlin nicht mehr auftreten darf. Ich glaube, jeder Mensch und insbesondere ein Mensch mit seiner großen Begabung sollte überall auftreten dürfen. Ich selbst würde sehr gern mit ihm zusammen in Ostberlin singen. Außerdem möchte ich ihn einladen, in Amerika zu singen und seine Gedichte dort zu rezitieren.« Größere Unterstützung, noch dazu aus dem Munde einer international geachteten Pasionaria der Menschenrechte, ist ihm noch nie zuteilgeworden. Und Baez hat der DDR-Führung ihren vermeintlichen Triumph, die weltweit bekannteste Vietnamkrieg-Gegnerin für ein Exklusiv-Gastspiel engagiert zu haben, gründlich verdorben. Die beiden unbequemen Künstler vermasseln mit dem pikanten Zwischenfall diesen so hübsch inszenierten Ersten Mai.
Es versteht sich von selbst, dass der Distel-Mitschnitt sofort der DDR-Zensur zum Opfer fällt, nie im Fernsehen gezeigt wird und unter Verschluss bleibt. Dissonanzen sind tabu. Baez und Biermann hingegen gelingt am Folgetag sogar noch ein zweites privates Treffen, bei dem sie den Agenten des Unrechtsstaates erneut ein Schnippchen schlagen – und das, obwohl beide unter der Rund-um-die-Uhr-Bewachung durch die Stasi stehen, Baez tatsächlich während ihres Doppel-Aufenthaltes in Ost-Berlin zur Fahndung ausgeschrieben ist. Aus Stasi-Akten, die erst Jahrzehnte später ausgewertet werden können, geht außerdem hervor, dass man im Osten über Begegnungen von Baez mit dem West-Berliner Kabarettisten und Biermann-Vertrauten Wolfgang Neuss bestens Bescheid wusste – und somit auch über dessen Pläne, die beiden privat zusammenzubringen. Baez und ihre Entourage aber erweisen sich als gewitzter als die auf sie angesetzten Überwacher: Einen nur vorgegaukelten Aufenthalt in der Distel-Garderobe, als »Erholungs«-Pause im Anschluss an die Probe, nutzen sie am ersten Mai zur spontanen Flucht Richtung Chausseestraße; am zweiten Mai schlüpft Baez, ohne dass sie daran gehindert werden kann, nach ihrem erneuten Grenzübertritt am Checkpoint Charlie, in der Leipziger Straße in Biermanns Auto. Dort hat er schon auf sie gewartet. Erneut gehört der Tag ihnen, tauschen sie Songmaterial, Liedtexte, Tonbänder, lässt sich der brandgefährliche »innersozialistische Kleinkram« für einige beglückende Stunden ignorieren.
Baez’ und Biermanns Freundschaft bleibt über Jahres-, Landesund Regimegrenzen hinweg intakt, auch nach der 1976 erfolgten Ausbürgerung von »Mister Bärmann«. Der beiderseitige Respekt wächst stetig. Baez wird Dylan später mit Schallplattenaufnahmen ihres gemeinsamen Ostberliner Kollegen gehörig nerven; und im Sommer 1983, siebzehn Jahre nach dem denkwürdigen Zwischenfall, stehen die beiden B’s dann – im Westen – anlässlich eines großen, vom Dauerregen beeinträchtigen Friedenkonzertes mit internationaler Beteiligung, im Fußball-Stadion des FC St. Pauli, gemeinsam auf der Bühne. Wie Baez seinerzeit in der Distel nimmt nun auch Biermann in Hamburg kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, öffentlich die Schattenseiten des Sozialismus zu kritisieren. Das nimmt man ihm übel; das missverstehen einige als unbotmäßige Schmähung; dafür erntet er Buh-Rufe und Pfiffe. »Aber siehe da, der spontane Beifall war stark. Und das Allerbeste« an seinem Auftritt war für ihn ohnehin die Wiederbegegnung mit seiner alten Wegbegleiterin.
Baez’ damaliges, so mutiges wie solidarisches Einstehen für ihn war eine Aktion gewesen, zu der sie nicht die geringste Veranlassung gehabt hatte. Dieses spontane Einstehen für einen Mann aus einem fremden Land, den sie erst wenige Stunden kannte und dem sie sich auf der Stelle verbunden fühlte, hatte ihn wieder einmal gelehrt, dass man – wie er aus Erfahrung natürlich längst wusste – mit einer Gitarre, einer Handvoll Akkorde, einer Auswahl wirklich guter Lieder und einer gehörigen Portion Zivilcourage vielleicht ein wenig die Welt verändern kann. Auch in einem unfreien Land. Wenigstens für die Dauer eines Abends. Doch lang genug, um ein deutliches Zeichen zu setzen.
Mobilisieren
Eine letzte Rückblende: Washington D. C., Tribüne vor dem Lincoln Memorial, 28. August 1963. Geschätzte 250 000 Menschen nehmen an diesem Mittwoch an einem »March for Jobs and Freedom«, der als eine der größten und dabei auch friedlichen Massenkundgebungen der Geschichte für die Wahrung und Erweiterung der Menschenrechte eingehen wird, teil. In der Verlängerung der National Mall schreiten die Demonstranten, zu drei Vierteln schwarze amerikanische Bürger, aus allen Teilen des Landes angereist, vom Washington Monument zu beiden Seiten des Reflecting Pool entlang Richtung Westen. Der Marsch hat utopischen Charakter und stellt sich dennoch der Realität. Der Marsch ist auch ein Wagnis. Es gilt, schwerwiegende rechtliche und gesellschaftliche Probleme zu lösen, um die noch in weiter Ferne liegende Aufhebung von Rassenschranken voranzutreiben; es gilt, alltägliche Diskriminierung zu beseitigen, die berüchtigten Jim Crow Laws zu überwinden und, das zählt zu den zentralen Forderungen des Projekts, auf die dringend nötige Verabschiedung von zwei fundamentalen Gesetzesvorhaben hinzuwirken – dem Civil Rights Act und dem Voting Rights Act. Beide werden in den Folgejahren, als direkte Konsequenz dieser eindrucksvollen Veranstaltung, tatsächlich endlich durchgesetzt.
Ultimatives Ziel ist die völlige Gleichstellung aller Bevölkerungsgruppen und die Emanzipation der Afroamerikaner. Mit jedem heutigen Schritt bewegen sich die Menschen darauf zu. Langsam, aber mit Durchhaltevermögen. Auf den Sieg, irgendwann in der Zukunft, unbeirrt hoffend. Wer hier mitmarschiert und mitorganisiert, wer Schilder mit Losungen hochhält, wer seine Entschlossenheit zur Schau stellt, betet, zuhört und mitsingt, hat sich an diesem Sommertag also nicht umsonst in die Hauptstadt der Vereinigten Staaten begeben. Wer sich hier einreiht, hilft, Geschichte zu schreiben und die Ohnmacht zu überwinden. Joan Baez ist mit dabei, in vorderster Front.
Schon in den frühen 1940er Jahren gab es Pläne für einen derartigen Friedensmarsch mit weitreichenden Folgen, doch erst jetzt signalisiert erstmals eine Regierung, die Kennedy-Administration, eine gewisse Kooperationsbereitschaft hinsichtlich der Planung und Vorbereitung. Erst jetzt, im Juni, hat sich der Präsident in einer aufsehenerregenden Rede, der »civil rights address«, via Radio und Fernsehen an die Nation gewandt, Perspektiven aufgezeigt und guten Willen bekundet. Erst jetzt, auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung und dem damit einhergehenden »Trend« zu wirksamen, intelligenten und gewaltlosen politischen Aktionen, zu Sit-Ins und Diskussionen, scheint ein günstiger Zeitpunkt für die Massendemo gekommen. Man will dafür Sorge tragen, dass die Präsenz vieler mündiger Bürger, die meisten davon Angehörige der schwarzen Mittelschicht, weltweit als verantwortungsvolle, selbstbewusste Machtdarstellung wahrgenommen und nicht wieder in Chaos, Straßenkämpfe, Mord, Plünderungen und bürgerkriegsartige Zustände ausartet. Das Risiko, das man eingeht, ist denkbar hoch.
Wahr ist aber auch: Der allgegenwärtige Rassismus mit seinen Beleidigungen, Demütigungen, körperlichen Übergriffen und Hassausbrüchen hat inzwischen unerträgliche Ausmaße angenommen, und die von Millionen stillschweigend tolerierten oder gar gutgeheißenen, tatsächlich aber verheerenden Phänomene einer amerikanischen »Apartheid« wirken sich noch immer auf sämtliche Lebensbereiche aus – Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Lokale, Chancen am Arbeitsmarkt – und sind einfach nicht mehr hinnehmbar. Lynchjustiz und andere üble Gewaltakte müssen fortan unwiderruflich der Vergangenheit angehören. Die Veranstalter haben sich trotz gewaltiger logistischer und enormer finanzieller Probleme, trotz der Ermordung des schwarzen Aktivisten Medgar Evers im Bundesstaat Mississippi, trotz schwieriger Sicherheitsvorkehrungen, trotz schlimmer Ausschreitungen in den Südstaaten, wie sie in jener aufgeheizten Ära an der Tagesordnung sind, und trotz des Rückschlages, den ein fruchtloses, desillusionierendes Treffen zwischen dem engagierten Romancier James Baldwin und Senator Robert Kennedy kurz zuvor in New York darstellte, nicht beirren lassen. Für die Initiatoren des March on Washington, allen voran Bayard Rustin und Asa Philip Randolph, ist überdeutlich geworden, dass ein viel zu großer Teil der Bevölkerung und der verantwortlichen Politiker die massiven Rassismus-Probleme entweder nicht wahrnimmt oder sie verdrängt und kleinredet.
Aus heutiger Sicht wissen wir, wie sich das Rad der Geschichte weitergedreht hat – mit den Morden an den beiden Kennedy-Brüdern, dem Präsidenten John Fitzgerald und dem späteren demokratischen Vorwahlkandidaten Robert, der seinerseits die Präsidentschaft anstrebte. Mit den ebenfalls mörderischen Attentaten auf den Widerstandskämpfer Malcolm X und den Bürgerrechtler Martin Luther King. Wir kennen aber auch die immense Bedeutung der großen Rede eben dieses Baptistenpastors und Vordenkers Martin Luther King, die diesen entsetzlichen Bluttaten voranging und die mit dem darin enthaltenen Leitmotiv I Have a Dream visionäre und mythische Bedeutung erlangt hat. King ist der letzte Sprecher an jenem 28. August, als er diese Zuversicht verströmenden Worte verkündet, und niemand unter den 250 000 Zuhörern wird die Kraft, Wucht und Glücksverheißung seiner rhetorisch meisterhaften, moralisch aufwühlenden Ansprache wohl je vergessen.
Selbstverständlich sind unter den schwarzen Berühmtheiten James Baldwin, Sidney Poitier und Harry Belafonte anwesend, und ebenso selbstverständlich liefern schwarze Kultsängerinnen wie Mahalia Jackson, Odetta und Marian Anderson, die bereits 1939 an gleicher Stelle, auf den Stufen vor dem Lincoln Memorial, einen denkwürdigen Auftritt absolviert hatte, herausragende musikalische Beiträge an diesem wahrhaft historischen Tag. Weniger vorhersehbar und damit umso bemerkenswerter ist die Präsenz einiger weißer Prominenter – der Oscar-gekrönte Filmregisseur Joseph L. Mankiewicz und zwei der größten Filmstars jener Epoche, Marlon Brando und Charlton Heston, verleihen der Veranstaltung zusätzlichen Hollywood-Glamour. Und ihre von den Medien gebührend gewürdigte Teilnahme – nicht mehr und nicht weniger als eine politische Botschaft – lässt sicher auch den einen oder anderen Zuschauer aus dem »anderen« Lager, der dem Protestmarsch skeptisch oder feindselig gegenüberstand, aufhorchen, nachdenken oder ins Grübeln geraten.
Und dann ist da noch eine Handvoll weißer Musiker, die zugunsten der Anliegen und Rechte der Schwarzen singen. Allesamt »Folkies«, denen gerade die Musikhörer der Nation zu Füßen liegen. Trotz ihrer Jugend bereits geschätzt und gefeiert, sehr erfolgreich und eben weder Vertreter eines oberflächlichen Musik-Genres noch bloße Tanzmusik-Interpreten: seriöse junge Leute. Der vielversprechende Nachwuchs Amerikas, kritische Geister und kluge Köpfe. Peter, Paul & Mary etwa. Das Trio ist mit Dylans schon damals emblematischem Blowin’ in the Wind zu hören sowie mit dem Pete-Seeger- und Trini-Lopez-Millionen-Seller If I Had a Hammer, einem veritablen Ohrwurm. Unbedingte Gerechtigkeit wird in diesem vordergründig so unterhaltsamen, eingängigen Lied eingeklagt. Ferner erscheint Dylan höchstpersönlich, gerade mal zweiundzwanzig Jahre alt, mit seinem brandneuen Protestsong Only a Pawn in Their Game, worin er den erst zwei Monate zurückliegenden, politisch und rassistisch motivierten Mord an Medgar Evers thematisiert. Dylan, der sich später nur noch höchst ungern für Kundgebungen und präzise politische Ziele zur Verfügung stellen wird. Und da ist Joan Baez, auch sie erst 22, in einem ärmellosen, lilafarben karierten Sommerkleid. Eine Kette und eine Anstecknadel mit dem Peace-Symbol sind der einzige Schmuck, den der Superstar der Folk-Bewegung heute trägt. Ernst schaut sie drein. Zuerst, noch vor dem Konzert, hat sie nur Augen für Brando, ihr Idol aus Jugendzeiten, gehabt: »Da stand er, sieben Meter von mir entfernt, umgeben von Zeitungsleuten und Menschen, die nach Stars Ausschau hielten. Ich war barfuß und lehnte mich gegen eine Säule auf den Stufen zum Kapitol. Ich versuchte, mir einen ungetrübten Blick auf sein Gesicht zu verschaffen, und hoffte dabei, er würde einmal zu mir hinüberschauen und mir dann direkt in die Augen schauen. Als er in der Menge verschwand und sich in Luft auflöste, schlug mein Herz so heftig, dass mein ganzer Körper zitterte.«
Das Geständnis eines verliebten Teenagers, möchte man meinen. Das Déjà-vu-Erlebnis einer Kinogängerin. Die Schwärmerei einer Halbwüchsigen. Baez schämt sich nicht, noch in ihren Aufzeichnungen And A Voice to Sing With daran zu erinnern. Doch schon wenige Stunden später hat sie sich wieder im Griff, ist sich ihrer historischen Mission in vollem Umfang bewusst. Es geht darum, die sich nach echter Veränderung sehnenden Teilnehmer dieser einzigartigen Demonstration ein für alle Mal aus der unterwürfigen Position der Bittsteller zu entlassen und stattdessen Macht und Entscheidungsspielraum auch in ihre Hände zu legen. Zehn Minuten stehen ihr zur Verfügung, um einen Beitrag zu diesem grundlegenden Sinneswandel zu leisten. Diesmal hat sich die Ausgangssituation in ihr Gegenteil verkehrt: Zehntausende von Augenpaaren ruhen auf Baez’ Gestalt, die hinter einem Wald von Mikrofonen beinahe unterzugehen droht, als sie ganz allein auf das Podium am Lincoln Memorial klettert, auf dem an diesem Tag auch der namhafte Eva Jessye Choir zu hören sein wird. Mit Dylan hat Baez bereits im Duett When the Ship Comes In präsentiert, ein Lied, das erst wenige Tage alt und an dessen Entstehungsgeschichte sie maßgeblich beteiligt worden ist.
Jetzt aber gehört Washington ihr und ihrer Stimme. Ruhig, konzentriert und gelassen dirigiert sie die Teilnehmer der Kundgebung zu den Strophen und dem Refrain von Oh, Freedom und We Shall Overcome. Gibt zwischendurch die neuen Textzeilen vor, zieht die mitsingenden Demonstranten ganz allmählich in den Bann dieser zeitlosen Hymnen. Nahezu alle, die gekommen sind, um ihr und Dr. King zuzuhören, stimmen mit ein, folgen ihren Vorgaben. Ein Ozean aus Menschen. Auch Baez hat nämlich einen Traum durchlebt, einen Traum von Frieden, Brüderlichkeit und Chancengleichheit, der dem des berühmten Redners gleicht und von dem sie ihren Zuhörern im Laufe dieser zwei so einfachen Lieder indirekt erzählt. Und mit dem sie ihre Herzen, Seelen und Hirne erreicht. Das ist weit mehr als nur ein bescheidener Beitrag zu einem Tag, der in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Ihr Gesang ist, wie der Gehalt einer gelungenen Ansprache, ausschlaggebend für den Erfolg des gesamten Unterfangens.
Minutenlang ist von hier bis zur National Mall, vom selben Mikro aus, von dem auch King spricht, nichts anderes wahrzunehmen als der klare Sopran einer jungen Frau. Und das wird lediglich der erste in einer langen Serie von Gesängen sein, mit denen Baez Zukunft gestaltet und echte Hoffnung zu wecken vermag. »Ich glaube, ich habe schon früh erkannt, dass man viele kleine Momente braucht, um etwas zu ändern, nicht nur einen großen«, bekannte sie im Jahre 2015, als sie auf 1963 zurückblickte. »Solche Tage waren genauso wichtig für mich wie der große Tag in Washington.«
»Nur ich und meine Gitarre«, darauf hat Baez ihre historische Rolle in Stellungnahmen und Interviews oft zu reduzieren versucht. Weiter nichts. Schmälern hat sie sie damit nicht können. Mehr wäre auch gar nicht nötig gewesen, um die Menschen für einen entscheidenden Moment innehalten zu lassen. Es stimmt schon: Nur ihre Gitarre und sie.
Elterntag: Zwischen Albert Vinicio und Big Joan. Newport, Juli 1967.
Nowhere Girl
Ich bin keine Heilige. Ich bin ein Lärm.Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich