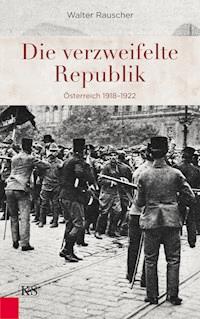
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem totalen Zusammenbruch der alten Ordnung, der Niederlage der k.u.k. Monarchie im Ersten Weltkrieg, zerfiel das Habsburgerreich in eine Reihe von neuen Kleinstaaten, der Kaiser musste abdanken. In Wien gründeten die politischen Parteien den "deutschösterreichischen" Staat und riefen am 12. November 1918 die Republik aus, die sich Deutschland anschließen sollte. Durch den Friedensvertrag von Saint-Germain wurde das neue Staatswesen jedoch zur Unabhängigkeit gezwungen und hatte sich auch einen neuen Namen zu geben: Republik Österreich. Besonders in ihren ersten Jahren kämpfte sie mit scheinbar unüberwindlichen Problemen: Die vom langen Krieg erschöpfte Bevölkerung hungerte und fror, die Nachbarländer erschwerten den wirtschaftlichen Aufbau des Landes durch ihre hartnäckige Abgrenzungspolitik. Überhaupt galt der von Wien aus regierte Staat vielen als lebensunfähig, folglich drängten die westlichen Bundesländer auf die Abspaltung. Durch die horrende Inflation und die massive Verschuldung drohten der Ersten Republik bereits 1922 der Staatsbankrott, die Zerschlagung und Aufteilung auf die Nachbarstaaten. Walter Rauscher schildert die Existenzkrise der Anfangsjahre der Republik, geht auf politische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Herausbildung des österreichischen Staats ein und zeigt, wie mühevoll und riskant dessen Entwicklung von Anfang an war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Rauscher
Die verzweifelte Republik
Österreich 1918–1922
www.kremayr-scheriau.at
eISBN: 978-3-218-01092-4
Copyright © 2017 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, WienAlle Rechte vorbehaltenSchutzumschlaggestaltung: Sophie GudenusUnter Verwendung einer Grafik von: IMAGNO/ÖNBLektorat: Paul MaerckerSatz und typografische Gestaltung: Michael Karner, Gloggnitz
Inhalt
I.
Österreich-Ungarn im Krieg
II.
Die letzten Tage der Monarchie
III.
Parallelwelten
IV.
Die Republik Deutschösterreich
V.
Ein Staat in Not
VI.
Die nationale Katastrophe
VII.
Eine unmögliche Existenz
VIII.
Vor dem Staatsbankrott
IX.
Sanierung und Kontrolle
X.
Die verzweifelte Republik
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Die unwahrscheinlichsten Taten, die hiergemeldet werden, sind wirklich geschehen;ich habe gemalt, was sie nur taten.Karl Kraus, »Die Letzten Tage der Menschheit«
I.Österreich-Ungarn im Krieg
Politisch allein ist der Tod der Monarchieund die Geburt der Republik nicht zu erklären.Prager Tagblatt, 12. November 1918
Die Gründung der Republik stand ganz im Zeichen des Niedergangs der alten Ordnung. Sie war die Konsequenz des Auflösungsprozesses des habsburgischen Vielvölkerstaats und folgte auf die Niederlage im Krieg. Sie ging in bitterster Not vonstatten, in einem Gefühl, dass all die Opfer der vergangenen vier Jahre vergebens waren, dass am Ende gar nur mehr größtes Elend blieb. Auch das Bemühen um eine identitätsstiftende Festlichkeit und die Ansammlung einer imposanten Menschenmenge vor dem Parlament auf der Wiener Ringstraße vermochten die allgemeine Depression nicht vergessen zu machen. Der Zerfall der Monarchie hatte sich schließlich in geradezu rasendem Tempo vollzogen und die deutschsprachigen Teile Österreichs auf sich allein gestellt zurückgelassen. Deren Zusammenfassung durch die Gründung einer Republik wurde freilich bereits wenige Monate später einer bedeutenden internationalen Revision unterzogen.
»Der Historiker wird einst Mühe haben, logisch darzustellen, wieso über Wien, der Kaiserstadt, plötzlich die rote Fahne gehisst werden konnte, wieso der alte Glanz des Wiener Hofes in wenigen Tagen erlosch und alles in Vergessenheit sinken konnte, was vor noch gar nicht so langer Zeit die breiten Massen der Wiener gefangen hielt«, versuchte das Prager Tagblatt den Umbruch dieser Tage verständlich zu machen. »Gewiss haben die großen Ereignisse innerhalb des alten Österreich, die Loslösung der Nationalstaaten und der Zusammenbruch des ganzen zentralistischen Systems den letzten Akt dieses Dramas vorbereitet, aber trotz all dieser Vorgänge blieb auf Deutschösterreichs Boden eine Bevölkerung zurück, die, politisch sehr konservativ und mit den monarchischen Einrichtungen eng verwachsen, republikanischen Gedanken fast unzugänglich schien. Die Wandlung dieser bürgerlichen, bäuerlichen und kleinbürgerlichen Kreise ist nur menschlich zu erklären. Sie alle haben nicht nur allzu viel zu leiden gehabt unter der Wirkung des Krieges, sie sahen auch bei diesem furchtbaren Zusammenbruch nur zu deutlich den großen Gegensatz zwischen der äußeren Machtentfaltung des monarchischen Systems und seiner inneren Hohlheit. Es ist kein Zweifel, dass die letzten Tage Österreichs, dieses Versagen des staatlichen Apparats, das schamlose Benehmen der altösterreichischen Generalität, der brutale Egoismus der machthabenden Gesellschaft, sowie hundert andere kleine Verfallserscheinungen Tausende alter Monarchisten in Republikaner verwandelt haben.«1
Der Kriegsausbruch
Im Sommer 1914 hatte die Doppelmonarchie den Feldzug gegen Serbien eröffnet und damit den Großen Krieg entfesselt. Angesichts der Bündnisse und außenpolitischen Konstellationen musste dem greisen Kaiser Franz Joseph und seinen Beratern eigentlich klar sein, dass eine Strafexpedition gegen den kleinen Nachbarn eine Kettenreaktion auslösen würde. Unter den staatlichen Eliten Österreich-Ungarns siegte aber der Wille zur Vergeltung über die Vernunft, die Emotion über das Kalkül. Wien ignorierte alle Warnungen vor einer Intervention Russlands zum Schutze Serbiens und beschäftigte sich lediglich mit der Operation gegen Belgrad. Deutschland hatte ohnehin zu verstehen gegeben, an der Seite seines habsburgischen Verbündeten zu stehen, und damit den Ballhausplatz in seiner Entscheidung zum militärischen Eingreifen noch ermutigt. Die Folge war kein begrenzter Krieg am Balkan, sondern die große Konfrontation in Europa zwischen der Entente und den Mittelmächten, die schlussendlich zum Weltkrieg eskalierte.
Der Krieg wurde selbst im sonst so zerstrittenen Vielvölkerstaat allgemein begrüßt: »Wahrhaft erhebend sind die begeisterten Kundgebungen der Bevölkerung, welche ihren patriotischen Gefühlen gestern in Wien in imposanten Demonstrationen für den Krieg Ausdruck gaben. Auch aus den sämtlichen österreichischen Hauptstädten treffen Berichte ein, welche große Massenkundgebungen des Patriotismus und der Kriegsbegeisterung melden.«2 Militärisch begann die Auseinandersetzung für die k. u. k. Monarchie freilich miserabel: Unzureichend ausgerüstet, mit Versorgungsschwierigkeiten von Beginn an und dem verfehlten Konzept der bedingungslosen Offensive führten die Feldzüge zu unnötig hohen Verlusten. Diese waren derart hoch, dass sich die k. u. k. Armee davon praktisch während des gesamten Krieges nicht mehr erholen konnte. Der Feldzug gegen Serbien war eine einzige Katastrophe, an der Ostfront drohte man, von der russischen »Dampfwalze« einfach überrollt zu werden. Die Generalität versuchte von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken, indem in Galizien, Bosnien und Serbien mit krimineller Härte gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen wurde, der möglicherweise bis zu 60.000 Menschen zum Opfer fielen. Bald wurde klar, dass die bewaffnete Macht des Habsburgerreichs auf sich allein gestellt nur Niederlagen erlitt. Es bedurfte der deutschen Unterstützung. Erst dann konnten die an die zaristische Armee verlorenen galizischen Gebiete nach der Durchbruchsschlacht von Tarnów-Gorlice zurückerobert, Serbien mit deutscher und bulgarischer Hilfe endlich besiegt werden.
Ökonomisch höchst bedeutsam war der Ausschluss der Monarchie vom globalen Markt. Es regierte die staatliche Kriegswirtschaft, die die Arbeiterschaft unter Ausschaltung der Gewerkschaften militärisch disziplinierte und entrechtete, der Rüstungsindustrie dagegen eine besonders bevorzugte Stellung einräumte. Nach großen Schwierigkeiten zu Kriegsbeginn, mit vielen Arbeitslosen bei gleichzeitigem Facharbeitermangel, Unternehmensstilllegungen und Transportproblemen erlebte die Industrie vor dem Hintergrund militärischer Erfolge im Osten vom Frühjahr 1915 bis zum Herbst 1916 sogar wieder eine von Euphorie und Gewinnen geprägte Phase. Freilich hatte sich die Wirtschaft den Kriegsbedürfnissen unterzuordnen. Das Militär dominierte Politik und Wirtschaft, das Abgeordnetenhaus des Reichsrats, das österreichische Parlament, tagte nicht. Absolutistisch beherrschte die Administration der bewaffneten Macht zunächst auch die Heimat, geriet jedoch zunehmend mit den zivilen Behörden in Streit. Bald wurde offensichtlich, dass das Habsburgerreich keineswegs auf einen langen Krieg vorbereitet war. Erste Mangelerscheinungen zeigten sich praktisch schon bei Ausbruch der Kampfhandlungen. Eigene Zentralen sollten in enger Kooperation mit der Großindustrie die fehlenden Rohstoffe besorgen und verteilen. Öffentlich-rechtliche Kriegsverbände fassten als Beratungs- und Verwaltungsorgane warenspezifisch Betriebe zusammen.3
Kein rascher Sieg
Im weiteren Verlauf des durch die Banknotenpresse und Kriegsanleihen finanzierten Waffengangs gab es auch weitere Rückschläge: Die jahrzehntelangen Verbündeten Italien und Rumänien erklärten Österreich-Ungarn 1915 bzw. 1916 den Krieg. Die italienischen Streitkräfte griffen die Doppelmonarchie in den Alpen und am Isonzo mit massivem Einsatz an. Die Bukowina ging im Sommer 1916 im Zuge der Brusilov-Offensive an die russische Armee verloren und Siebenbürgen musste von den einfallenden Rumänen wieder zurückerobert werden. Zu allem Überfluss waren an der Ostfront österreichisch-ungarische Soldaten, in erster Linie Ruthenen und Tschechen, teilweise zu den Russen übergelaufen.4
Doch die militärische Lage besserte sich wieder, und ein Jahr danach erreichten die k. u. k. Truppen schließlich wieder die alten Reichsgrenzen. An der Südfront wiederum brachte die habsburgische Armee mit deutscher Hilfe im Herbst 1917 die italienischen Truppen – in der mittlerweile 12. Isonzoschlacht – durch den Durchbruch bei Flitsch-Tolmein und das Vordringen bis zum Piave sogar an den Rand der totalen Niederlage. Allerdings mussten nun Massen italienischer Kriegsgefangener versorgt werden, was die Bevölkerung des Habsburgerreichs als Belastung empfand. Die Ernährungslage Österreich-Ungarns war ohnehin seit geraumer Zeit prekär geworden. Dies führte in Wien bereits im Mai 1916 zu ersten Krawallen.5 Die Bevölkerung war zunehmend kriegsmüde. Die Blockade durch die gegnerische Entente trug ihre unheilvollen Früchte für die Versorgungssituation Österreichs. Aber ein baldiges Kriegsende war nicht in Sicht.6
Teuerung, Inflation und Hunger zehrten am Durchhaltevermögen der Bevölkerung. Blanker Egoismus verdrängte den Gemeinsinn des August 1914. Kriegsgewinnler, Wucherer, Schleichhändler und Schieber nützten die Not der Gesellschaft rücksichtslos aus. »Seit Tagen und Wochen hat die Kritik der Öffentlichkeit die Missstände verfolgt, die sich in der Versorgung mit Fett, Fleisch und Eiern herausgestellt haben«, schrieb die Arbeiter-Zeitung. »Die Behörden haben das Übel viel beredet und über die Abhilfen viel beraten, aber zur Tat ist man noch immer nicht bereit«.7 Die Ernährungs- und Versorgungsfrage führte die beiden Reichshälften in einen Dauerkonflikt und beeinträchtigte die Kriegswirtschaft nachhaltig.8 Die Gewinne der Unternehmen gingen deutlich zurück. Der Mittelstand geriet in eine existenzielle Krise, Handel und Gewerbe siechten dahin. Das Militär stand der Ernährungslage und den Bedürfnissen der Zivilbevölkerung weitgehend mit Desinteresse gegenüber. Es kaufte Vorräte auf, was die Preise in die Höhe schnellen ließ, und schadete der agrarischen Produktion in besonderem Maße, da der Landwirtschaft durch die »kriegswichtigen« Maßnahmen der Armee die Arbeitskräfte und Zugtiere fehlten.9
1917 war sodann ein höchst zwiespältiges Jahr. Das Glück schien endlich auf der Seite der durch die Errichtung der Gemeinsamen Obersten Kriegsleitung noch unverhohlener vom Deutschen Reich dominierten Mittelmächte zu sein, als im Osten Revolution und militärische Erschöpfung Russland als Gegner aus dem Krieg ausscheiden ließen. Während Deutschland damit endgültig sein Hauptaugenmerk auf die Westfront richten konnte, besaß die Donaumonarchie nun die Möglichkeit, sich in erster Linie auf Italien zu konzentrieren. Doch dies war letztlich nicht mehr als ein oberflächlicher Blick auf die Landkarte. Die Wirklichkeit sah anders aus. Durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten war die Überlegenheit der Gegner nicht mehr zu leugnen. Sie betraf Menschen und Material gleichermaßen. Im Winter 1916/17 hatte der Hunger die Doppelmonarchie erfasst. Lebensmittelvorräte und Rohstofflager waren zum größten Teil erschöpft, die Seeblockade der Alliierten machte sich schmerzhaft bemerkbar, und Ungarn, die Kornkammer des Habsburgerreichs, weigerte sich, auch die anderen Kronländer mit landwirtschaftlichen Produkten zu versorgen. Immer mehr Ersatznahrungsmittel sollten nun den Mangel ausgleichen.10
Wenigstens hatte die Zahl der Gefallenen deutlich abgenommen, ebenso die Zahl der Soldaten, die tatsächlich an der Front kämpften. Zu Anfang des Jahres 1918 standen auf Seiten Österreich-Ungarns noch knapp 2,9 Millionen Mann an der Front, rund 1,6 Millionen dienten bei den Ersatzkörpern, Militärbehörden und anderen Einrichtungen in der Heimat. Insgesamt acht Millionen Männer sollten schlussendlich von 1914 bis 1918 eingezogen werden. Durch die Einberufungen und den Mangel an Zugtieren war aber die Agrarproduktion im Verlauf des Krieges dramatisch gesunken. Die Versorgungsfrage wurde zum zentralen Problem. Der Hunger war allgegenwärtig, und zur Unterernährung gesellten sich Krankheiten wie Tuberkulose und Rachitis bei den Kindern. Die Geburtenziffern sanken augenfällig. Ab 1917 verelendete die Gesellschaft zunehmend, besonders in den Städten. Die Bevölkerung auf dem Land hatte es trotz Arbeitskräftemangel und Requirierungen durch das Militär vergleichsweise besser. Immerhin stand sie nicht vor dem Hungertod und konnte sogar von den verzweifelten Städtern profitieren, die sie persönlich mit Nahrungsmittel versorgte. Dass der Arbeiterschaft nach ihrer Unterdrückung in der ersten Kriegshälfte mittlerweile, wie etwa im Mieterschutz, rechtliche Zugeständnisse gemacht wurden, vermochte die soziale Situation nicht ausreichend zu entspannen.11
Der große Streik
Der Krieg hatte eine revolutionäre Basis geschaffen. Das alte System verlor nicht zuletzt durch seine Unfähigkeit, Front und Heimat ausreichend zu ernähren, stetig an Autorität und versuchte, durch den Einsatz von militärischen Assistenzeinheiten die Ordnung in der Heimat aufrechtzuerhalten. Die Friedensverhandlungen mit Russland in Brest-Litowsk, die Revolution der Bolschewiki und die demokratischen Ideen aus den USA beeinflussten im Jänner 1918 die Stimmung im Innern der Monarchie. Große Teile der Arbeiterschaft protestierten dagegen, dass es der von den Deutschen angeführten Delegation der Mittelmächte weniger um den Frieden als um Territorialerwerb zu gehen schien.12 Dass man auch die Verbesserung der Ernährungssituation forderte, verstand sich von selbst.
In den Tagen nach der Monatsmitte streikten in Österreich etwa 600.000 Arbeiter. Ähnlich wie in Ungarn drohte eine Radikalisierung der Protestbewegung. Mit Russland als Vorbild hätte der Massenausstand vielleicht auch in Österreich-Ungarn die Revolution einleiten können. Den Jännerstreiks fehlte aber die politische Führung. »Niemand hat den Arbeitern zu diesem Ausstand geraten, niemand ihn organisiert«, hieß es in der Arbeiter-Zeitung; »aus der Erregung der Arbeitermassen ist er mit elementarer Gewalt hervorgebrochen und keine Macht wäre imstande gewesen, seinen Ausbruch und seine Ausbreitung zu verhindern.«13 Die Führung der Sozialdemokratie wollte von einer Revolution nichts wissen. Keiner ihrer Protagonisten stellte sich an die Spitze der Protestbewegung, um das herrschende System zu stürzen. Parteigründer Viktor Adler, aber auch seine politischen Ziehsöhne wie etwa Karl Renner waren Reformer, keine Revolutionäre.14 In ihrer Loyalität zum Kaiserstaat sahen sie nicht einmal, dass die k. k. Regierung sie für ihre Zwecke einspannte, nämlich die unzufriedenen Massen mit kleineren Zugeständnissen wieder zu besänftigen.
Die Sozialdemokratie war in ihrer Mehrheit lange Zeit für den Krieg gewesen.15 Nun stand sie vor dem Dilemma, die Streikbewegung für ihre eigenen Ziele zu nutzen, gleichzeitig aber Chaos und Anarchie zu verhindern. »Um unnötige Opfer zu vermeiden«, ermahnte die Parteivertretung die Arbeiterschaft, »Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten und alle Zusammenstöße auf der Straße zu vermeiden. Ihr demonstriert durch den Streik – die Wirksamkeit dieses Demonstrationsmittels könnte durch Straßenexzesse nicht gesteigert, sondern eher gefährdet werden.«16 Der Parteivorstand fürchtete einen extremen Linksruck der Arbeiterbewegung. Um die Massen zu beruhigen, kamen führende Sozialdemokraten mit der österreichischen Regierung überein, dass k. u. k. Außenminister Ottokar Graf Czernin in Brest-Litowsk auf Gebietsforderungen verzichten und eine Verbesserung der Ernährungslage erreichen sollte. Ähnliches wurde auch in Budapest abgesprochen. Für Kaiser Karl und seine politischen Verantwortlichen stellte dies kein großes Opfer dar, denn der Ballhausplatz hatte ohnedies beabsichtigt, von Annexionen abzusehen. Die sozialdemokratische Parteileitung rief sodann die Arbeiterschaft auf, die Arbeit wieder aufzunehmen.17 Aber besonders in Böhmen weiteten sich die Streiks sogar noch aus. Weit mehr als die Aufrufe der moderaten sozialdemokratischen Führung trug dann allerdings die Angst vor militärischen Maßnahmen oder gar einem deutschen Einmarsch in Böhmen zur Wiederaufnahme der Arbeit bei.18
Allgemeine Erschöpfung
Trotz der Friedensschlüsse mit Sowjetrussland und dem neuen ukrainischen Staat ging der Krieg anderswo unvermindert weiter. Ein Ende war nicht in Sicht.19 Die sächsische Gesandtschaft in Wien nahm beim Verbündeten daher zunehmend antideutsche Emotionen wahr: »Kampfunlust an der Front und knurrender Magen im Land beschuldigen die Deutschen oder vielmehr die Vormacht Preußen der immer längeren Fortsetzung des Krieges, der, nach der Vorstellung anscheinend weiter, im Wesentlichen sozialdemokratisch beeinflusster Kreise, schon seit Langem nicht mehr im Interesse Österreich-Ungarns geführt wird. Jeder neue Rückgang der verfügbaren Nahrungs- und Bekleidungsmittel, jede neue Vermehrung der Teuerung, die schon allzu viel Vermögende arm und Arme zu Schuldnern gemacht hat, jeder neue groteske Auswuchs des Schleichhandels, der im Übrigen gut geordnet und schlechthin zur Existenzvoraussetzung der gesamten Bevölkerung geworden ist, jede neue Einzelerscheinung solcher Art gibt aufs Neue vermeintlichen Anlass zu jener Missstimmung.«20
Nach dem Ausfall Russlands hatten Großbritannien, Frankreich und Italien durch die amerikanische Intervention die letztlich entscheidende Unterstützung erhalten. Trotzdem standen k. u. k. Truppen als Besatzer im Osten – in den ehemals zaristischen Teilen Polens, Weißrusslands und der Ukraine –, im Südosten – in Serbien, Montenegro, Albanien und Rumänien – und schlussendlich im Süden – im Friaul und in Teilen Venetiens. Wenn das kaiserliche Heer also keineswegs geschlagen war, raubten ihm zwölf zermürbende Schlachten am Isonzo mit einem Verlust von insgesamt 375.000 Mann und darüber hinaus die sich noch verschlimmernden Nachschubschwierigkeiten doch zunehmend die Kräfte.
Die Ernährungslage spitzte sich – für Armee und Heimat gleichermaßen – zu. Es fehlte zudem an vielem anderen, etwa an ausreichend medizinischer Versorgung und an Kohle. Das Militär requirierte immer rücksichtsloser und brachte damit die eigene darbende Bevölkerung gegen sich auf, die selbst mit Hungerrationen ihr Auslangen finden musste. Allein in Wien stellten sich täglich an die 150.000 Menschen um geringe Portionen Fleisch, Fett, Eier und Gemüse an, nicht selten vergeblich. »Mit Sicherheit lässt sich immerhin nicht voraussehen, wozu irgend ein plötzlicher Ausbruch der Volksleidenschaft gerade in diesen Wochen der Hungersnot noch führen mag«, beobachtete der deutsche Partner; »die noch einigermaßen gemäßigten Führer der Sozialdemokratie machen kein Hehl daraus, dass sie die Massen nicht mehr in der Hand haben.«21
Größere Teile der Bevölkerung verarmten. Dies traf vor allem auch auf den Mittelstand zu, auf Beamte und Fixbesoldete. So konnte es vorkommen, dass etwa ein Lehrer große Teile seines Mobiliars verkaufen oder ein Hofrat sich allabendlich als Pianist in einem Café ein Zubrot verdienen musste. Selbst Sektionschefs konnten sich infolge des Sinkens des Geldwertes nicht mehr satt essen und galten bereits als »proletarisiert«. Wien stand in jenen Tagen im zweifelhaften Ruf, »die teuerste Großstadt der Welt, jedenfalls aber Europas« zu sein.22
Österreich-Ungarn erreichte die Grenze seiner Belastbarkeit. Ein deutschböhmischer Abgeordneter wusste »von 1600 Todesfällen infolge Hungers allein in einem Krankenhaus und von Arbeitsniederlegungen auch der bestgesinnten Arbeiter infolge körperlicher Erschöpfung« zu berichten.23 Immer wieder wurde gestreikt. Kleinere Revolten an allen Ecken und Enden der Monarchie gehörten beinahe schon zum Alltag. Zuweilen setzte die Autorität das Militär gegen Protestierende und Plünderer ein – Aktionen, die bisweilen auch Todesopfer forderten. In Galizien wandten sich die bislang stets loyalen Polen – nach der in den Brester Friedensverhandlungen vereinbarten Abtretung des Cholmer Landes an die Ukraine und der Ankündigung eines eigenen ruthenischen Kronlandes – wütend von der Habsburgermonarchie ab. Sie veranstalteten einen »nationalen Trauertag«, worauf in Galizien das Standrecht verhängt wurde.24 Vielerorts schlug der Nationalitätenkonflikt der vergangenen Jahrzehnte in blanken Hass um.
Aus Russland kehrten nach und nach hunderttausende Kriegsgefangene in die Heimat zurück. Auch für sie war der Krieg keineswegs vorbei. Viele von ihnen wurden nach vierwöchigem Urlaub wieder in die Armee eingegliedert. Nicht wenige sahen sich obendrein noch dem Verdacht der Desertion oder dem Vorwurf der Feigheit vor dem Feind ausgesetzt.25 Im ostadriatischen Cattaro meuterten Einheiten der Kriegsflotte. In der Steiermark nahmen die Meutereien von Heimkehrern und Ersatzmannschaften bedenkliche Ausmaße an. Die Rebellionen wurden schließlich allesamt niedergeschlagen und die Hauptschuldigen nach dem Urteilsspruch von Stand- oder ordentlichen Militärgerichten hingerichtet.26
Zu allem Übel wurde auch die Autorität des ursprünglich durchaus beliebten jungen Kaisers erheblich erschüttert.27 Das Bekanntwerden von geheimen, eigenmächtigen habsburgischen Friedensfühlern nach Frankreich, die sogenannte »Sixtusaffäre«, hatte schwerwiegende Konsequenzen für die Donaumonarchie und die Stellung Karls.28 Österreich-Ungarn galt fortan im Zweibund nicht einmal mehr als Juniorpartner, sondern wurde – nach dem Canossagang des jungen Monarchen zu Wilhelm II. in dessen Hauptquartier im belgischen Spa – vom Deutschen Reich regelrecht als Vasall behandelt.29
Die Donaumonarchie hatte somit im Mai 1918 ihre Handlungsfreiheit, ja ihre außen- und militärpolitische Selbständigkeit verloren. Daraus zogen auch die gegnerischen Mächte ihre Konsequenzen. Sie schlossen künftig einen Sonderfrieden mit der von Deutschland in freundschaftlicher Umarmung förmlich erdrückten Doppelmonarchie aus und wollten fortan das im Jänner 1918 vom amerikanischen Präsidenten Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker auf das Habsburgerreich im Sinne von Nationalstaatsgründungen angewandt wissen. Damit wurden – wenngleich zunächst noch immer nicht in vollständiger Eindeutigkeit – die Weichen für eine Auflösung des alten Vielvölkerstaats an der Donau gestellt.
Und dieser kämpfte im Innern mit schwerwiegenden Problemen. Die durch den »Brotfrieden« erhofften Getreidelieferungen aus der Ukraine blieben aus, durch die Transportschwierigkeiten sank die Stahl- und Kohleproduktion dramatisch. Auf der anderen Seite nahmen die Krankenstände der Industriearbeiter deutlich zu. Wie die Soldaten hassten auch sie die Armeebehörden, die den Krieg in die Länge zogen und bereits auf alle möglichen Bereiche des Lebens zugreifen wollten, in zunehmendem Maße. Im Hinterland trieben sich bewaffnete Deserteure in den Wäldern herum, andere Fahnenflüchtige tauchten wiederum in den Städten unter. Größtenteils hielt aber der Glaube, letztendlich doch vor dem Sieg zu stehen, die Moral immer noch aufrecht.30
Dies war angesichts der katastrophalen Bedingungen an der Südfront durchaus erstaunlich. Die kaiserliche Heeresleitung versuchte ihrerseits im Juni 1918 mit der größten österreichisch-ungarischen Offensive des Krieges überhaupt, Italien endgültig niederzuringen, dringend benötigte Verpflegung vom besiegten Gegner zu beschaffen und die Kampfmoral nachhaltig zu stärken. Der einmal mehr schlecht geführte Angriff der ermatteten und waffentechnisch unterlegenen k. u. k. Truppen in Venetien scheiterte allerdings kläglich, die Schlacht am Fluss Piave musste aufgrund hoher Verluste nach zehn Tagen abgebrochen werden. Einmal mehr lag der Misserfolg nicht an der Kampf- und Opferbereitschaft der Soldaten, die im Großen und Ganzen noch immer ungebrochen war, sondern an der Zerstrittenheit der Generalität und der damit verbundenen miserablen Planung der Operation. Kein Wunder also, dass sowohl unter den Soldaten als auch in der Zivilbevölkerung die Verachtung gegenüber den alten Autoritäten wuchs.31
Innere Erosionserscheinungen
Hinzu kam der Nationalitätenkonflikt. Seit der Gründung der »Doppelmonarchie« 1867 unterdrückte die politische Nation der Ungarn die Emanzipationsbestrebungen der anderen Völker im Königreich der Stephanskrone. In Österreich gab es dagegen keine derart beherrschende Nationalität. Seine Deutschen, die sich lange als das Staatsvolk der westlichen Reichshälfte betrachtet hatten, sahen sich vielmehr starken Tschechen und stärker werdenden Südslawen gegenüber. Im Reichsrat in Wien hatten die nationalistischen Exzesse vor der Jahrhundertwende dem Parlamentarismus nachhaltig geschadet.
Die Magyaren schienen seit Jahren den Ausgleich Ungarns mit dem habsburgischen Monarchen zu einer kompletten Verselbständigung des Reichs der Stephanskrone ausreizen zu wollen. Dessen ungeachtet war sich Budapest jedoch bewusst, dass Ungarn ohne die westliche Reichshälfte, ohne seine Integration in ein jahrhundertealtes Staatswesen mit allgemein hoch geachteter Dynastie und großer Armee, eingepfercht zwischen Deutschen und Slawen einen äußerst schweren Stand haben würde. Was wiederum den Deutschnationalismus betraf, hegte Berlin keineswegs den Wunsch, die deutschsprachigen Österreicher ins Wilhelminische Reich aufzunehmen. Deren schärfste Gegner in einem Zeitalter des Nationalismus, die Tschechen, strebten zwar die Gleichberechtigung, aber keinen eigenen Staat an. Die viertstärkste Völkerschaft der Donaumonarchie, die Polen Galiziens, hatte eine vergleichsweise privilegierte Stellung inne, die die nationale Einigung, die Wiedererrichtung eines eigenen Staats, nicht dringlich erscheinen ließ. Die Mehrheit der Westslawen der Monarchie fürchtete die zaristische Knute, und trotz der virulenten südslawischen Frage lehnten viele Slowenen und Kroaten eine serbische Vorherrschaft ab. Italienischen und rumänischen Nationalismus hoffte der Doppelstaat schlussendlich durch die außenpolitischen Bündnisse der Donaumonarchie mit Rom und Bukarest im Zaum halten zu können. Dies war die Situation vor Kriegsausbruch.
Im Sommer 1918 war die Lage freilich bereits eine ganz andere.32 Die Polen durften mittlerweile davon ausgehen, nach dem Krieg endlich wieder ihren eigenen Staat gründen zu können. Die vereinbarte Abtretung des Cholmer Landes an die Ukraine entfremdete sie vom habsburgischen Reich nur noch mehr, was sich auch in tausenden Desertionen in die nationale militärische Untergrundorganisation ausdrückte. Die überwiegende Mehrheit der Südslawen hatte sich gegenüber dem Habsburgerreich lange Zeit loyal verhalten. Ihre politischen Führer strebten nach einer gemeinsamen Einheit innerhalb der Donaumonarchie, wollten bis zum Sommer 1918 eine Föderalisierung, keine Zerschlagung des Vielvölkerreichs. Die Südslawen kämpften an den Fronten unter schweren Opfern und Entbehrungen. Infolge der Niederlage am Piave fielen jedoch selbst die bislang so proösterreichischen Slowenen zunehmend ab. Unter dem Einfluss der russischen Oktoberrevolution kam es außerdem vor allem in Kroatien-Slawonien, aber auch in Bosnien-Herzegowina zu massenhaften Desertionen. Die überwiegend serbischen Meuterer und Deserteure wurden bisweilen zwar von der einheimischen südslawischen Bevölkerung unterstützt, Banden von Fahnenflüchtigen verbreiteten im Hinterland durch Raub, Plünderungen und andere Gewalttaten aber auch Angst und Schrecken.33
Die tschechischen Regimenter kämpften ebenfalls – mit wenigen Ausnahmen – im Verband der k. u. k. bewaffneten Macht aufopferungsvoll. Desertionen waren eine Seltenheit.34 Dies traf auch auf die Slowaken zu. Die Tschechen befanden sich allerdings in den böhmischen Ländern seit Jahrzehnten in einem unversöhnlich scheinenden Konflikt mit den Deutschnationalen. Der deutsche Kurs der österreichischen und der Nationalismus der ungarischen Regierung trieben Tschechen und Slowaken förmlich in die Selbständigkeit.35 Nach der von Beginn des Krieges an antihabsburgischen Emigration forderten seit der »Drei-Königs-Deklaration« 1918 auch die tschechischen Politiker in Österreich mit zunehmender Entschlossenheit einen eigenen Tschechoslowakischen Staat. Zuletzt standen Tausende von ehemaligen Kriegsgefangenen und Deserteuren auch als Angehörige der Tschechischen bzw. Tschechoslowakischen Legion aktiv auf der Seite der Entente.36 Die österreichische Regierung reagierte auf die tschechischen Sezessionstendenzen mit dem Vorhaben, den deutschen Besitzstand in Böhmen abzusichern und damit letztlich die Länder der Wenzelskrone zu zerreißen. Angesichts der slawischen Emanzipation radikalisierten sich die Deutschösterreicher noch weiter und bekundeten ihre Verbundenheit mit Deutschland.
Die österreichische Sozialdemokratie hatte schon vor dem Krieg zu spüren bekommen, dass die nationale Frage noch größere Bedeutung zu besitzen schien als Demokratisierung und soziale Probleme. Im Reichsrat spaltete sie sich in nationale Klubs.37 Innerhalb der deutschsprachigen Sozialdemokratie hielt die Loyalität zum alten Reich auch während des Kriegs weiter an.38 Adler und Renner etwa dachten nicht an den Nationalstaat, sondern lediglich an einen gründlich reformierten Vielvölkerstaat.39
Die andere Massenpartei, die Christlichsozialen, war dem Herrscherhaus treu ergeben, ja sogar mit Erzherzog Franz Ferdinand politisch verbunden gewesen, und somit durchaus eine der Stützen der Monarchie.40 Die CSP hatte ihre Basis in den bürgerlich-bäuerlichen Schichten, sich nach dem Tod ihres charismatischen Gründers Karl Lueger aber in existenzbedrohenden Richtungsstreitigkeiten verfangen. Nach dem Urnengang von 1907 gemeinsam mit den Konservativen noch stärkste parlamentarische Kraft, fiel sie bei den Reichsratswahlen vier Jahre später hinter die national selbst so zerstrittenen Sozialdemokraten zurück.41
Von den parteiinternen Konflikten der beiden Massenbewegungen profitierten die Deutschfreiheitlichen. Obwohl ihrem Wesen nach eigentlich ebenfalls heterogen, gelang es den vor allem in den böhmischen Ländern verankerten, bislang betont obrigkeitsstaatlich orientierten Bürgerlichen mit ihrem zur Stimmenmaximierung gegründeten »Deutschen Nationalverband«, bei den letzten Wahlen im kaiserlichen Österreich 1911 sogar die beiden Großparteien zu übertrumpfen und damit die stärkste Fraktion im Reichsrat zu stellen.42
Gerade unter dem neuen Kaiser Karl hatten die österreichischen Regierungen einen deutschen Kurs verfolgt. Nach deren Scheitern oblag es schließlich im Juli 1918, vor dem Hintergrund weitgehender politischer und nationaler Entfremdung und der Auflösung alter Loyalitäten, dem Kirchenrechtler Max von Hussarek, der bereits drei Regierungen als Unterrichtsminister angehört hatte, ein neues Kabinett zu bilden. Der neue Regierungschef plante jedenfalls eine weit ausgreifende Verwaltungsreform, die in letzter Konsequenz auf eine Verfassungsreform hinzielen sollte, außerdem die Ordnung der Staatsfinanzen und gesteigerte Anstrengungen in der Ernährungspolitik.43 Sozialdemokratische und deutschliberale Kritik an dem neuen klerikalen Ministerpräsidenten war für den politischen Katholizismus sodann bloß Ausdruck »jüdischer Solidarität«.44 Doch den Auflösungserscheinungen wirklich Einhalt zu gebieten, war schließlich auch er nicht der richtige Mann.
Bis zuletzt durfte die Krone freilich noch auf maßgebliche Kräfte zählen: auf die Bürokratie, die Kirche und die Armee. Die Loyalität von Adel, Klerus, Bürgern und Bauern hatte bislang den Fortbestand der Dynastie und der Donaumonarchie ermöglicht.45 Mittlerweile machte aber der Nationalitätenstreit angesichts der bedrohlichen Situation auch vor der Armee nicht mehr halt. Der Hass der einzelnen Völkerschaften aufeinander zersetzte den Zusammenhalt des Heeres. Hinzu kamen Unterernährung, Krankheiten wie Grippe und Malaria und die demoralisierende Erkenntnis, gegenüber den Alliierten von Tag zu Tag in größere Unterlegenheit zu geraten.46 Dies hatte sich im Sommer 1918 selbst für das deutsche Heer im Westen herausgestellt. Auch in Frankreich und Belgien zeichnete sich seit dem »schwarzen Tag von Amiens« die Niederlage der Mittelmächte ab.
Das alte System wurde zunehmend als Fremdherrschaft aufgefasst. Gerade auch für die Tschechen hatte das Haus Habsburg abgewirtschaftet. Sie wollten fortan weder mit Deutschösterreichern noch mit Ungarn in einem Staatsgebilde weiterleben.47 Tomáš G. Masaryk und Edvard Beneš, vor dem Krieg noch ohne nennenswerten Rückhalt in der Bevölkerung, agitierten im Ausland für eine Republik der Tschechen und Slowaken. Schlussendlich mit Erfolg: Nach und nach erkannten die alliierten Mächte den Tschechoslowakischen Nationalrat in Paris als De-facto-Regierung an. In der böhmischen Hauptstadt, wo die tschechische Politik mittlerweile ebenfalls einen komplett unabhängigen gemeinsamen Staat mit den Slowaken forderte, vermochten sich die aufgeheizten Gemüter gar nicht mehr zu beruhigen. Nationalistische Kundgebungen und Auseinandersetzungen mit der deutschen Minderheit standen in Prag an der Tagesordnung. Die schlussendlich einsetzende Fahnenflucht zu Zehntausenden blieb freilich keineswegs auf die Tschechen beschränkt.
Die Niederlage zeichnet sich ab
Weit mehr als die gescheiterte Piaveoffensive läuteten die Vorfälle am Balkan die Niederlage und das Ende des Krieges ein. Noch am 14. September hatte der k. u. k. Außenminister István Graf Burián mit einer Note an sämtliche kriegführenden Mächte »zu einer unverbindlichen Aussprache über die Grundsätze des Friedensschlusses eingeladen«.48 Burián vertrat die Auffassung, dass angesichts der militärischen Situation zu diesem Zeitpunkt beide Lager einander die Hand zu einer Verständigung reichen könnten, »ohne eine Einbuße an Prestige besorgen zu müssen«. Bei einer Ablehnung erhoffte sich der ungarische Karrierediplomat wenigstens »eine günstige Wirkung im Sinne einer Stärkung der gemäßigteren Strömungen (…) und zum mindesten eine Förderung der allgemeinen Friedensdiskussion«.49 Es fiel auf, dass der Ballhausplatz diesen Friedensschritt selbständig unternahm, also nicht im Namen der Verbündeten, und formell keinen Unterschied zwischen Freund und Feind machte. Burián vertrat die Ansicht, dass Berlin diese Pille schlucken musste, so wie Österreich-Ungarn sich schon wiederholt gegenüber deutschen Aktionen loyal gezeigt hatte.50
Aber die Entente wies diesen Vorschlag ohnehin zurück. Sie verlangte zunächst einmal die deutsche Kapitulation und startete eine Offensive an der Mazedonienfront. In der zweiten Septemberhälfte brach Bulgarien zusammen, Deutschland und die Donaumonarchie konnten die von Sofia geforderte Unterstützung nicht mehr leisten. Der Partner Österreich-Ungarns am Balkan sah sich daraufhin zum Waffenstillstand genötigt. Um die verbündeten Türken bei der Stange zu halten, bezeichnete Burián die militärische Lage in Südosteuropa als »ernst, aber keineswegs hoffnungslos«.51 Die Kapitulation Bulgariens überforderte aber die Möglichkeiten der k. u. k. Heeresmacht. Die früher eroberten und besetzten Gebiete auf dem Balkan waren angesichts der gegnerischen Übermacht nicht mehr zu halten. Serbien und Albanien mussten geräumt werden. Die österreichisch-ungarischen Verbände traten den Rückzug in Richtung der alten Grenzen an.52 Selbst in den Augen der Verantwortlichen in Wien und Budapest war der Krieg nun nicht mehr zu gewinnen.
Am 3. Oktober erhoben die deutschösterreichischen sozialdemokratischen Parlamentsabgeordneten, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Regierungsbeteiligung der Genossen in Berlin an der neuen deutschen Reichsregierung, die Forderung nach dem nationalen Selbstbestimmungsrecht: »Die Vertreter der deutschen Arbeiterschaft in Österreich erkennen das Selbstbestimmungsrecht der slawischen und romanischen Nationen Österreichs an und nehmen dasselbe Recht auch für das deutsche Volk in Österreich in Anspruch. Wir erkennen das Recht der slawischen Nationen an, ihre eigenen Nationalstaaten zu bilden, wir lehnen aber unbedingt und für immer die Unterwerfung deutscher Gebiete unter diese Nationalstaaten ab. Wir verlangen, dass alle deutschen Gebiete Österreichs zu einem deutschösterreichischen Staate vereinigt werden, der seine Beziehungen zu den anderen Nationen Österreichs und zum Deutschen Reiche nach seinem eigenen Bedürfnis regeln soll.« Österreich, so die Entschließung, sollte unter demokratischen und föderalen Gesichtspunkten in einen Staatenbund umgeformt werden.53
Die Sozialdemokraten einigten sich mit den Vorstandsmitgliedern der Deutschnationalen und der Christlichsozialen Partei, bei einer Neuordnung der Verhältnisse ein einheitliches Staatsprogramm auf Basis der nationalen Selbstbestimmung zu entwerfen. Der Christlichsoziale Viktor Kienböck, ein späterer Finanzminister der Ersten Republik, sprach dabei »einer energisch demokratischen Vorgangsweise das Wort, welche beim neuen Bau die Mitarbeit der Bevölkerung selbst nachhaltig heranzieht.« Gleichzeitig beeilte sich Kienböck aber festzuhalten: »Die demokratische Mitarbeit unserer österreichischen Bevölkerung am Verfassungswerk, die hier gefordert wird, verleugnet in keiner Weise den monarchischen Gedanken. Im Gegenteil, sie geht von ihm aus.« Es war jedoch höchste Zeit zu handeln. »In solcher Lage ist Kühnheit nichts anderes als das Ergebnis kühler Überlegung.«54
Die drei Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn und die Türkei beschlossen einstweilen endlich, zum Abschluss eines allgemeinen Waffenstillstands und zur Einleitung von Friedensverhandlungen gleichzeitig an den US-Präsidenten heranzutreten. Der k. u. k. Gesandte in Stockholm wurde beauftragt, die schwedische Regierung zu ersuchen, die entsprechende Depesche am 4. Oktober nach Washington zu übermitteln. Das Waffenstillstandsangebot sprach freilich von einem reinen »Verteidigungskampf« der Donaumonarchie und strebte einen Friedensschluss auf Basis von Wilsons bekanntem Programm an.55 Die Alliierten und nicht mehr das Haus Habsburg entschieden über die Zukunft Mitteleuropas.
Ein Reich in Agonie
Die Macht war dem altösterreichischen System nunmehr endgültig entglitten. »Österreich hat einen Ministerpräsidenten mit dem Amtssitze in Washington. Er heißt Woodrow Wilson und Vollstrecker seiner Politik in Wien ist Freiherr v. Hussarek«, schrieb die Neue Freie Presse wenig gnädig. Der Regierungschef sprach seinerseits im spärlich besuchten Plenum des Abgeordnetenhauses »von mündigen Völkern, die ihre Zukunft selbst bestimmen«. Für das patriotisch-nationalliberale Blatt war dies eine glatte Bankrotterklärung: »Wenn der Staat durch seinen Ministerpräsidenten erklärt, ihr mündigen Völker könnt verfahren, wie es euch beliebt, und ich will geduldig warten, was für mich dabei herausschaut, macht er sich überflüssig.«56
Inneren Zusammenhalt gab es tatsächlich kaum mehr. Während die deutschen Reichsratsabgeordneten von der Gründung eines deutschösterreichischen Staats in einem Bund freier nationaler Gemeinwesen sprachen, wollten die tschechischen und südslawischen Mandatare souveräne Nationalstaaten schaffen und sich erst dann mit den Nachbarn über die Regelung der gemeinsamen Beziehungen auseinandersetzen.57 Aber auch verschiedene deutschnationale Abgeordnete schlossen sich zu einer eigenen »Deutschösterreichischen Unabhängigkeitspartei« zusammen, deren Name schon das Programm klar definierte.58
Zu all den Abspaltungsvorhaben gesellte sich noch eine doppelte Regierungskrise: Am 11. Oktober trat nicht bloß die österreichische, sondern auch die ungarische Regierung zurück. Ein »Völkerministerium« sollte gebildet werden. Allein die Tschechen verweigerten sich, und damit war der Plan auch schon wieder obsolet. Hussarek blieb schließlich k. k. Ministerpräsident und stand dem Kaiser bei, die Bildung eines Staatenbunds vorzubereiten. Ungarn dagegen wollte nicht nur von einer Föderalisierung der Donaumonarchie nichts wissen, sondern ging endgültig von der Konzeption des Dualismus ab. Das Königreich, so kündigte sein Ministerpräsident am 16. Oktober an, wolle die Gemeinsamkeit lediglich auf eine Personalunion beschränken.59
Deutschland hatte bereits die harte Antwort auf das Friedensangebot erhalten. Österreich-Ungarn wartete dagegen immer noch auf die Reaktion aus Washington. Und es ging das Gerücht um, dass die Rückmeldung des amerikanischen Präsidenten nicht ebenso schroff ausfallen würde.60 Kaiser Karl glaubte, dem 14-Punkte-Programm Woodrow Wilsons mit einem eigenen Manifest an seine Völker entgegenwirken zu können, um so gleichsam im letzten Moment den Zerfall seines Reichs aufzuhalten. Mit der Errichtung eines Bundesstaats auf Grundlage des nationalen Selbstbestimmungsrechts wollte das alte System auch vor den Siegermächten und auf der Friedenskonferenz bestehen. Es glaubte, einmal mehr durch Anpassung überleben zu können. Der Plan sah die Schaffung von vier Einheiten, einer deutschen, tschechischen, südslawischen und einer ukrainischen, vor. Ungarn sollte schließlich dieses Konstrukt zur Pentarchie erweitern. Die Polen hatten in diesem Konzept die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie nicht vielleicht doch bei der Donaumonarchie verbleiben wollten. Aber für die politischen Vertreter der slawischen Völker kam dieses Projekt nicht mehr in Frage, und auch in Budapest schlug bereits die Stunde der Sezessionisten.61
II.Die letzten Tage der Monarchie
Kein Feind kann uns antun, was hierdie Völker sich gegenseitig antun.Neue Freie Presse, 29. Oktober 1918
Das Völkermanifest
Dass das Habsburgerreich eine militärische Niederlage nicht überleben würde, musste den Verantwortlichen bereits im Sommer 1914 klar gewesen sein. Trotzdem gingen sie mit der Kriegserklärung gegen Serbien das größtmögliche Risiko ein – und verloren. Was mit einer Strafexpedition gegen den kleinen unbotmäßigen Nachbarn begonnen hatte, endete als Katastrophe. Die Donaumonarchie lag in Agonie. Aber das System Habsburg klammerte sich noch an einen letzten Strohhalm: Österreich sollte »dem Willen seiner Völker gemäß« zu einem Bundesstaat umfunktioniert werden. Dies war des Kaisers Plan, den er mittels Manifest am 16. Oktober 1918 verkündete: Jede der Nationalitäten sollte auf ihrem Siedlungsgebiet ihr eigenes staatliches Gemeinwesen bilden. Bis zur tatsächlichen Vollendung dieser Umgestaltung sollten die bestehenden Einrichtungen »zur Wahrung der allgemeinen Interessen« unverändert aufrecht bleiben. Karl I. beauftragte seine Regierung, ohne Verzug alle Arbeiten zum Neuaufbau Österreichs vorzubereiten. »An die Völker, auf deren Selbstbestimmung das neue Reich sich gründen wird«, so hieß es in dem Schriftstück, »ergeht mein Ruf, an dem großen Werke durch Nationalräte mitzuwirken, die – gebildet aus den Reichsratsabgeordneten jeder Nation – die Interessen der Völker zueinander sowie im Verkehre mit Meiner Regierung zur Geltung bringen sollen.«1
Karl hatte das Manifest mit Ministerpräsident Max Hussarek und dessen Nachfolger, dem anerkannten Staats- und Völkerrechtler Heinrich Lammasch, ausgearbeitet. Es war auffallend, dass sich das Manifest nur an die Völker der westlichen Reichshälfte, nicht aber an Ungarn richtete. Zudem enthielt es lediglich allgemeine Grundsätze. Wie die Regierung die Aufgabe des Zusammenschlusses der Völker Österreichs unter dem Dach eines Bundesstaats lösen sollte, angesichts des Widerstands, der sich bei fast allen Parteien dagegen bemerkbar machte, blieb ein Rätsel.2 »Ein Völkerbund soll gegründet werden, dem die Völker fehlen«, schrieb die führende Tageszeitung der alten Monarchie, die Neue Freie Presse, und erkannte beinahe prophetisch: »Das bloße Selbstbestimmungsrecht genügt keinem dieser Völker. Alle wollen Macht über andere Völker. Das Selbstbestimmungsrecht wollen sie nur gegen Österreich für sich, denken jedoch nicht daran, es den nationalen Minderheiten zuzugestehen.«3
Für die Arbeiter-Zeitung war das Manifest lediglich aus einer Zwangslage heraus erlassen worden und nicht aus wahrer Einsicht und Reformwilligkeit. Das Organ der deutschen Sozialdemokratie in Österreich hielt es darüber hinaus für »recht dürftig«. Seine Beschränkung auf lediglich allgemeine Grundsätze sei aber nicht unbedingt ein Nachteil, und es tue gut daran, sich auf die Entscheidung der Völker zu berufen und nicht mehr auf die kaiserliche Allmacht, denn diese sei im Zeitalter des nationalen Selbstbestimmungsrechts Geschichte. Illusionen brauche man sich freilich nicht hinzugeben: »Die neue Zeit wird mit dem Manifest nicht eröffnet«.4 Für die Reichspost durchströmte dagegen »auch diese menschlich warme kaiserliche Kundgebung ein Geist, der Zuversicht und Vertrauen erweckt«. Das dem Herrscherhaus gegenüber stets loyale Organ des politischen Katholizismus in Österreich bezeichnete einen Staatenbund gar als das Programm der Zukunft.5





























