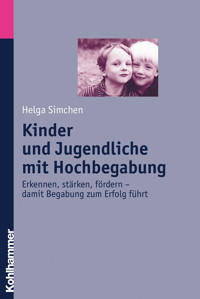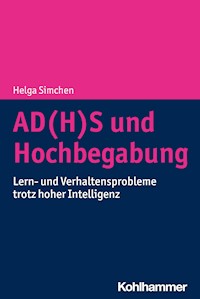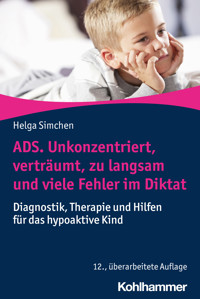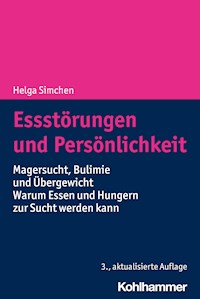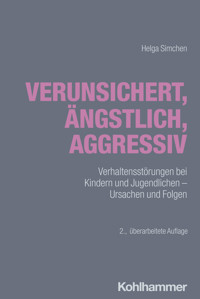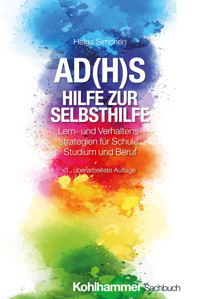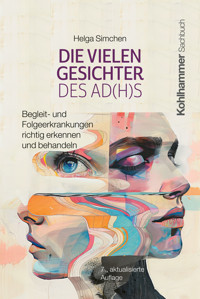
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
AD(H)S bedeutet weit mehr als nur eine Beeinträchtigung von Konzentration und Verhalten. Seine genetisch bedingte Stirnhirnunterfunktion mit Reizüberflutung und Botenstoffmangel hat eine dichtere Vernetzung von Nervenbahnen im Gehirn zur Folge. Diese Besonderheit verleiht den Betroffenen nicht nur Nachteile, sondern auch besondere Fähigkeiten, über die sie bei ausgeprägter AD(H)S-Problematik leider nicht immer verfügen können. Eine rechtzeitige multimodale Behandlung mit individueller und problemorientierter lern- und verhaltenstherapeutischer Begleitung sowie dem Praktizieren eines Selbstmanagements kann verhindern, dass Selbstwertgefühl und Sozialverhalten in eine Negativspirale geraten, was zu Dauerstress sowie psychischen und psychosomatischen Erkrankungen führen kann. Das in der 7. Auflage vorliegende Buch zeigt bewährte Strategien und Hilfestellungen auf, die es Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen, nicht mehr unter ihrem AD(H)S zu leiden, sondern dessen Vorteile nutzen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 AD(H)S hat viele Gesichter
1.1 Viele fragen: »Woran erkenne ich ein AD(H)S vom Unaufmerksamen Typ?«
Symptome des AD(H)S im Säuglingsalter
Symptome des AD(H)S bei Kleinkindern
Symptome des AD(H)S bei Schulkindern
Einteilung und Beschreibung des AD(H)S durch das DSM-5
Die wichtigsten Symptome des AD(H)S im Kindesalter im Detail
Symptome des AD(H)S bei Jugendlichen
Symptome des AD(H)S bei Erwachsenen
Differenzialdiagnose des AD(H)S
Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen des AD(H)S
1.2 Auch das ist AD(H)S – Berichte über Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit AD(H)S
Sarah, knapp 6 Jahre alt, hyperaktiv, drohende Zurückstellung der Einschulung
Jessica, 9 Jahre, hyperaktiv, hochbegabt und mit Problemen in der sozialen Integration
Eric, 10 Jahre, besucht die Hauptschule, AD(H)S ohne Hyperaktivität
Anna-Maria, eine 15-jährige Jugendliche mit AD(H)S ohne Hyperaktivität und mit sehr guten Schulnoten
Dorina, 15 Jahre, Gymnasiastin, AD(H)S bei sehr guter Intelligenz
Frau Schmitt, 45 Jahre, hyperaktiv, allein erziehende Mutter
Frau Jakob, 43 Jahre, hyperaktiv, drei gescheiterte Ehen
1.3 Die positiven Seiten des AD(H)S
Worin äußern sich die positiven Seiten des AD(H)S bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
2 Wenn Üben allein nicht ausreicht
2.1 AD(H)S und Störungen in der Informationsverarbeitung
Was sind die wichtigsten Wahrnehmungsstörungen und wie kann man sie erkennen?
2.2 Die Bedeutung von Motorik und Bewegung
Die Entwicklung des Kindes im Spiegelbild der Motorik
Die Bedeutung der Motorik bei der AD(H)S-Diagnostik
2.3 Blicksteuerungsschwäche und gestörtes dynamisches beidäugiges Sehen
Was verstehen wir unter Blicksteuerungsschwäche?
3 Häufige Begleiterkrankungen des AD(H)S
3.1 Das Asperger-Syndrom
3.2 Lern- und Teilleistungsstörungen
Besonderheiten beim AD(H)S-Kind – warum Üben oft Frust bedeutet und allein nicht ausreicht
Zum Nachweis und zur Diagnosestellung des AD(H)S
AD(H)S als Ursache von Teilleistungsstörungen
Was sind Teilleistungsstörungen?
Wenn die Schule zum Alptraum wird
Eine potenzielle Lese-Rechtschreib-Schwäche frühzeitig verhindern
Die Gabe von Stimulanzien – ein Baustein einer wirkungsvollen Hilfe für AD(H)S-Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche
Beispiele aus der Praxis
3.3 Der soziale Reiferückstand
Auf die Eltern kommt es an
Entscheidende Lebensphasen für die soziale Entwicklung
Grundfaktoren für ein erfolgreiches soziales Lernen
Wie erleben AD(H)S-Kinder die wichtigen Entwicklungsphasen?
Bereits im Kindergarten(alter) rechtzeitig handeln
Sich in der Gemeinschaft wohlfühlen
Woran erkenne ich, dass meinem Kind soziale Reife fehlt?
Verhaltenstherapeutische Ziele
3.4 Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen
In welcher Form reagieren Kinder und Jugendliche mit AD(H)S auf ihre dauernde seelische Belastung?
Reaktive Fehlentwicklungen und psychosomatische Störungen
3.5 Aggressives Verhalten muss nicht sein
TV, Computer und Smartphone – »schöne neue Welt«?
Worin liegen die Ursachen für aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen?
Worin besteht die Veranlagung zur inneren oder äußeren Aggressivität von AD(H)S-Kindern?
Warum Aggressionen nicht verdrängt werden sollten
Die Entwicklung zur »antisozialen« Persönlichkeit verhindern
3.6 Die häufigsten psychosomatischen Beschwerden
Faktoren, die einen Zusammenhang von AD(H)S und psychosomatischen Störungen begünstigen
Die wichtigsten psychosomatischen Störungen bei Kindern
Die wichtigsten psychosomatischen Beschwerden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit AD(H)S
3.7 Drohende seelische Behinderung bei Kindern und Jugendlichen
4 Folgeerkrankungen des AD(H)S
4.1 Die Angststörung
Ängste und ihre körperlichen Begleiterscheinungen
Ängste bei AD(H)S
Zur Diagnostik von Angststörungen
Warum Kinder mit AD(H)S so leicht zu Ängsten neigen
Wenn aus Ängsten eine Phobie wird
Was kann man gegen Ängste und Phobien tun?
Welche Medikamente werden verordnet?
Entspannungsübungen helfen
Panikreaktionen
4.2 Zwangstörungen bei AD(H)S
Zwangshandlungen, Zwangsgedanken, Zwangsimpulse
AD(H)S und Zwangsstörungen rechtzeitig diagnostizieren und behandeln
Wenn die Eltern selber betroffen sind
4.3 Depressionen
Depression als Folgeerkrankung eines AD(H)S im Erwachsenenalter
4.4 Tics und Tourette-Syndrom
Was versteht man unter einem Tic und einem Tourette-Syndrom?
Zur medikamentösen Behandlung von Tics und dem Tourette-Syndrom
4.5 Anfallsleiden
Können Stimulanzien Krampfanfälle auslösen?
Voraussetzungen und Besonderheiten der Stimulanziengabe bei Anfallsleiden
5 »Liebe allein genügt nicht!«
5.1 Kinder und Jugendliche mit AD(H)S brauchen mehr als Zuneigung
Welche konkreten Hilfen brauchen AD(H)S-Kinder im Einzelnen?
Seelische Störungen bei Kindern und Jugendlichen – wie alltäglich sind sie?
Störungen in Elternhaus und Kindergarten rechtzeitig und richtig wahrnehmen
Das innerfamiliäre Verhaltensmanagement – ein wichtiger Therapiebaustein in der Behandlung von Kindern mit AD(H)S
Wann ist unser Kind schulreif?
Wenn AD(H)S und LRS zusammen vorliegen
5.2 Auf die richtige Erziehung kommt es an
Autoritative Erziehung – was bedeutet das und warum ist sie für Kinder und Jugendliche mit ausgeprägtem AD(H)S besonders geeignet?
Eltern als Brücke zwischen Kind und Therapeut
Kinder brauchen positive Vorbilder und klare Grenzen
Rechtzeitig »nein« sagen
Sind Strafen sinnvoll, und wenn ja, wann und welche?
Jugendliche mit AD(H)S – unnötige Machtkämpfe vermeiden
Warum Mütter so wichtig sind
5.3 Wie Geschwister eine erfolgreiche Behandlung verhindern können
6 »Fahren mit angezogener Handbremse«
6.1 Ein Leben zwischen Nichtwollen und Nichtkönnen
Nichtwollen oder Nichtkönnen – was war zuerst?
Warum sich Kinder und Jugendliche mit AD(H)S so schwertun
Was tun bei Diagnose AD(H)S?
6.2 Träume und Fantasien – eine Flucht aus der Wirklichkeit
Beispiele aus der Praxis
6.3 Die erlernte Hilflosigkeit
Falsch verstandene Hilfestellungen
Kinder und Jugendliche zur Selbstständigkeit erziehen
6.4 Frustabbau durch Aggressionen und Zwänge
Zwangshandlungen bei hypoaktiven Kindern
Aggressives Verhalten bei hyperaktiven Kindern
Eine Außenseiterrolle muss nicht sein
Wie Eltern bei ihren Kindern unnötige Frustrationen vermeiden und gefährlichen Aggressionen vorbeugen können
Wenn bei den Eltern selber ein AD(H)S vorliegt
Aggressives Verhalten nicht auf die leichte Schulter nehmen
Welche Faktoren begünstigen bei Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S die Entstehung von Kriminalität?
Wie lässt sich die Entwicklung von Kriminalität bei Kindern und Jugendlichen auf die Dauer wirksam verhindern? – Acht Maßnahmen
6.5 Essstörungen als Komorbidität bei Jugendlichen und Erwachsenen mit AD(H)S
Negativer emotionaler Dauerstress wird so zum Bindeglied zwischen AD(H)S und den Essstörungen
Warum und wann kommt es unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu Essstörungen im Rahmen eines AD(H)S?
Warum Pubertätsmagersucht?
Besonderheiten bei der Behandlung von AD(H)S-bedingten Essstörungen
6.6 AD(H)S und Allergien
7 »Niemand versteht mich!«
7.1 Impulssteuerungsschwäche
Impulssteuerungsschwäche – was bedeutet das?
Wie äußert sich eine Impulssteuerungsschwäche konkret?
Neurobiologische Ursachen impulsiven Handelns
Mit welchen weiteren Verhaltensweisen und Störungsbildern kann eine Impulssteuerungsschwäche verbunden sein?
Wie misst man impulsives Verhalten?
Die Impulsivität (rechtzeitig) kontrollieren
Beispiele aus der Praxis
Welche therapeutischen Maßnahmen gibt es?
Die eigene Erziehung zu Hause ändern – Voraussetzung für eine erfolgreiche Verhaltenstherapie
7.2 Borderline-Persönlichkeitsstörung
Was verstehen wir unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Zwanghaftes destruktiv-aggressives Verhalten
Wenn Mütter überfordert sind
Zur Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Neurobiologische Parallelen beim Borderline-Syndrom und AD(H)S
7.3 Sucht
Die Macht der Drogen – Faktoren, die ein Suchtverhalten begünstigen
Die Sucht nach Computerspielen und Medien
Computerspiele überlasten den Arbeitsspeicher und blockieren so die Lerntätigkeit
Worin besteht neurobiologisch der Zusammenhang zwischen AD(H)S und Sucht?
Wege einer erfolgreichen Drogenprävention
Möglichkeiten und Grenzen der Drogentherapie
7.4 Depressionen oder depressive Reaktionen?
Einige Zahlen zur Depression
Woran erkenne ich bei meinem Kind eine Depression?
Hyperaktive Erwachsene und Depression
Das »Sissi-Syndrom« – eine Sonderform der Depression und sein möglicher Zusammenhang mit dem AD(H)S
8 Die Bedeutung der Frühdiagnostik und Frühbehandlung
8.1 »Nichts gelingt mir!« – Auf das Selbstbewusstsein kommt es an
Ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig für das Leben
Ein schlechtes Selbstwertgefühl bedeutet innere Verunsicherung
Kindern und Jugendlichen ein positives Selbstvertrauen vermitteln
8.2 Die Bedeutung des sozialen Umfeldes und der Schule
Wie können Eltern der Entwicklung von Verhaltensstörungen wirkungsvoll entgegenwirken?
Wann und wie eine Verhaltenstherapie helfen kann
Verhaltens- und Stimulanzientherapie – ein erfolgreiches Paar
Lassen Sie sich durch Außenstehende nicht beirren
Wenn die Eltern selbst vom AD(H)S betroffen sind
Eltern beraten Eltern
Auch entferntere Verwandte und Freunde haben Einfluss und Verantwortung
Damit die Schule für AD(H)S-Kinder nicht zum Alptraum wird
Eine Bitte an alle Lehrerinnen und Lehrer: Leiten Sie Ihre Beobachtungen frühzeitig an die Eltern weiter
Halten Sie immer zu Ihrem Kind!
Ganztagsschulen – eine Chance für AD(H)S-Kinder?
8.3 Die Notwendigkeit der Behandlung
AD(H)S frühzeitig behandeln, um Späterkrankungen zu vermeiden – eine lohnenswerte Aufgabe
Wenn für den Anfang nur noch eine Stimulanzientherapie weiterhilft
Kinder und Jugendliche mit AD(H)S bedürfen einer komplexen multimodalen ärztlichen Behandlung mit Stimulanzien – Warum?
Die Praxis spiegelt den Erfolg einer kompetenten Behandlung wider
Zur Behandlung von Erwachsenen mit AD(H)S
9 AD(H)S erfolgreich behandeln – Erfahrungen aus der Praxis
9.1 Eltern im Dschungel gegensätzlicher Meinungen
AD(H)S ist keine neue Krankheit
Warum die AD(H)S-Symptome heutzutage stärker ausfallen
Die richtige AD(H)S-Therapie auswählen: erst informieren, dann aussuchen
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum AD(H)S auf einen Blick
Eine erfolgreiche AD(H)S-Behandlung beginnt zu Hause
Faktoren für eine positive Kindheitsentwicklung
Vier Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen AD(H)S-Therapie
9.2 Goldstandard der AD(H)S-Behandlung
Gemeinsam Probleme formulieren und Behandlungsschwerpunkte setzen
Entspannungsübungen – ein wichtiger Bestandteil der AD(H)S-Behandlung
Beispiel einer konkreten Entspannungsübung
In schweren Fällen unverzichtbar – die Stimulanzientherapie
Eltern als Co-Therapeuten
Ergänzende Therapiebausteine
Jedes Kind braucht einen individuellen Therapieplan
Kinder und Jugendliche müssen bereit sein, in der Therapie mitzuarbeiten
Sport und Bewegung bewirken Positives
10 Mit AD(H)S sein Leben gut meistern
Empfohlene Ratgeber und Fachliteratur
Hilfreiche Webseiten
Erwähnte Testverfahren
Sachwortverzeichnis
Die Autorin
Dr. med. Helga Simchen war zunächst Oberärztin der Kinderklinik und dann wissenschaftlich sowie klinisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie der Medizinischen Akademie Magdeburg tätig. Dort arbeitete sie in enger Kooperation mit dem Institut für Neurobiologie und Hirnforschung auf dem Gebiet der Aufmerksamkeits-, Lern- und Leistungs- sowie Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. In der ehemaligen DDR galt sie als Spezialistin für die Problematik der hyperaktiven Kinder. Schwerpunkte waren dabei die Früherfassung von Teilleistungsstörungen (z. B. Legasthenie), der Komorbiditäten des Hyperkinetischen Syndroms (HKS) sowie der Tic- und Tourette-Symptomatik. Im Vorstand der Gesellschaft für Rehabilitation war sie über viele Jahre als Arbeitsgruppenleiter tätig. Sie hielt Vorlesungen über Kinder- und Jugendpsychiatrie und Entwicklungsneurologie und hatte einen Lehrauftrag am Institut für Rehabilitationspädagogik. Ihr Arbeitsschwerpunkt waren die neurobiologischen und psychosozialen Ursachen der Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen.
Dr. med. Helga Simchen hat eine abgeschlossene Ausbildung als Fachärztin für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische Psychotherapie, Hypnose und Systemische Familientherapie. Der breite Fundus ihres Wissens und die täglichen Erfahrungen aus ihrer Spezialpraxis für AD(H)S und Teilleistungsstörungen in Mainz verleihen ihr eine besondere Befähigung, sich mit dem zukunftsweisenden Thema der Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen des AD(H)S zu beschäftigen. Dabei behandelt sie nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen, sondern ebenso die mit dem AD(H)S verknüpfte Problematik der Familie und des sozialen Umfeldes in deren Psychodynamik.
Helga Simchen
Die vielen Gesichterdes AD(H)S
Begleit- und Folgeerkrankungenrichtig erkennen und behandeln
7., aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagsbild: Login – stock.adobe.com7., aktualisierte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045786-7
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-045787-4epub: ISBN 978-3-17-045788-1
Vorwort
AD(H)S verstehen heißt, seine Dimensionen zu begreifen.AD(H)S erkennen bedeutet, sein Labyrinth zu durchschreiten.AD(H)S behandeln heißt, Mensch und Umwelt als Einheit zu sehen.
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S) wird nicht nur wegen seiner Akutsymptomatik behandelt, sondern – und das vor allem – um seine Spätfolgen zu vermeiden. Der Ausgangspunkt dafür ist meist eine seelische Krise, die mit einem schlechten Selbstwertgefühl einhergeht.
Es gibt eine Fülle von AD(H)S-assoziierten Begleit- und Folgekrankheiten. Obgleich eine diesbezügliche wissenschaftliche Forschung erst noch am Anfang steht, geben die Erfahrungen aus der psychotherapeutischen und psychiatrischen Praxis mit Jugendlichen und Erwachsenen dafür eindeutige Hinweise. Diese Begleit- und Folgeerscheinungen sollten durch eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung des AD(H)S möglichst vermieden bzw. rechtzeitig behandelt werden.
Noch immer warten jedoch zu viele AD(H)S-Betroffene und ihre Angehörigen mit dem Besuch bei einem Facharzt zu lange ab und ebenso zögern leider noch immer zu viele Ärzte und Therapeuten eine Stimulanziengabe so lange hinaus, bis ihre Patienten unter einer schwerwiegenden seelischen und/oder körperlichen Beeinträchtigung leiden. Auf diese Weise vergeht viel Zeit, in der Kinder und Jugendliche wichtige Entwicklungsphasen für sich hätten besser nutzen können. Stattdessen haben sie nun mit Defiziten zu kämpfen, die sie noch zusätzlich belasten.
Die wichtigsten Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen des AD(H)S sind:
Ein oppositionelles Verhalten, das in 40 – 60 % der Fälle als ein aufsässiges Benehmen infolge eines unbehandelten oder nicht optimal behandelten AD(H)S auftritt
Eine Lese-Rechtschreib- Schwäche (Legasthenie) und eine Rechenschwäche (Dyskalkulie), die sich bei etwa 50 % aller Kinder mit AD(H)S nachweisen lassen
Entwicklungsstörungen der Sprache, die sich häufig als ein Leitsymptom für ein beginnendes AD(H)S manifestieren
Beeinträchtigungen der Fein-, Grob- und Visuomotorik
Auditive Wahrnehmungsstörungen, die bei zwei Dritteln aller AD(H)S-Kinder vorkommen
Ticstörungen, insbesondere bei hyperaktiven Kindern
Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, unter denen oft Erwachsene und Jugendliche mit AD(H)S leiden
Zu viel Stress, innere Verunsicherung bei negativ geprägtem Selbstwertgefühl können die Entwicklung einer Essstörung begünstigen
Eine besondere Art von Epilepsie
Einnässen und Einkoten, die – besonders wenn sie tagsüber auftreten – als mögliche Hinweise auf ein AD(H)S mit Beeinträchtigung der körperlichen und seelischen Entwicklung ernst genommen werden sollten
Eine Tabak- und Alkoholabhängigkeit, vor allem bei Erwachsenen, die nicht selten den gelegentlichen bzw. regelmäßigen Konsum weiterer »leichter« Drogen wie Haschisch mit einbezieht und rasch in eine Abhängigkeit mündet
Ein Medikamentenmissbrauch, speziell bei AD(H)S-Betroffenen mit chronischen Kopfschmerzen sowie Angst- und Zwangsstörungen
Eine erhöhte Unfallrate, da hyperaktive Kinder im Vergleich zu ihren Altersgenossen häufiger zu Unfallopfern werden und zudem verhältnismäßig schwerer verunfallen
Rechtzeitig und richtig behandelt, muss sich AD(H)S nicht in jedem Fall nachteilig auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken. Man kann im Leben mit AD(H)S gut zurecht- kommen, viel erreichen und – gerade auch aufgrund des AD(H)S – beruflich sehr erfolgreich sein.
Mit AD(H)S richtig umgehen zu lernen, bedeutet einen Weg zu beschreiten, der manchmal nicht ganz einfach ist. Dennoch lohnt es sich, nach ihm zu suchen. Anfangs ist an Kreuzungen und Kurven zeitweilig professionelle (ärztliche bzw. therapeutische) Hilfe erforderlich. Anliegen dieses Buches ist es, allen Betroffenen, Angehörigen, Lehrern, Ärzten und Therapeuten diesen Weg aufzeigen. Im Kern geht es darum, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die unnötigen Folgen des AD(H)S zu ersparen und ihnen aufzuzeigen, wie sie von den positiven Seiten ihres AD(H)S profitieren können.
AD(H)S hat viele gute Seiten,man muss nur die Hierarchie der Besonderheiten erkennen,sie nicht bekämpfen, sondern sich ihrer bedienen,um seine Persönlichkeit voll entfalten zu können.
Januar 2003 für die 1. AuflageNovember 2019 für die 5. AuflageHelga Simchen
1 AD(H)S hat viele Gesichter
1.1 Viele fragen: »Woran erkenne ich ein AD(H)S vom Unaufmerksamen Typ?«
»AD(H)S ist eine Modekrankheit, AD(H)S hat heute jeder«, so Meinungen aus der Praxis, die häufig geäußert werden. Weder das eine noch das andere stimmt. Richtig ist, dass AD(H)S heute – im Vergleich zu früher – öfter diagnostiziert und mehr behandelt wird, doch längst noch nicht ausreichend, was die tägliche Arbeit der Ärzte beweist, die sich auf die Diagnostik und Behandlung von AD(H)S spezialisiert haben.
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) gibt es mit und ohne Hyperaktivität, deshalb wird es korrekterweise jetzt in der Fachliteratur AD(H)S genannt. Beide Formen des AD(H)S unterscheiden sich deutlich in ihrer Symptomatik, wobei die wesentlichen Diagnosekriterien immer vorhanden sein müssen. Die beiden Subtypen beschreibe ich mit ihren unterschiedlichen Symptomen und Verläufen in diesem Buch ausführlich. Das ADS vom Unaufmerksamen Typ, dass ich auch gern als hypoaktive Variante bezeichne, wurde viel später erst als solches wissenschaftlich anerkannt. Deshalb wird das ADS jetzt korrekterweise als AD(H)S bezeichnet, als Oberbegriff für ein ADS mit oder ohne Hyperaktivität. Manchmal liegt aber auch ein sog. Mischtyp vor.
Die Disposition, d. h. die Veranlagung zum AD(H)S mag häufig sein, aber behandlungsbedürftig werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene erst dann, wenn ihre Entwicklung und Lebensqualität deutlich beeinträchtigt sind. Unerkannt und unbehandelt führt AD(H)S zur inneren Verunsicherung der Betroffenen mit psychischer Instabilität und schlechtem Selbstwertgefühl. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden dann schnell zum Außenseiter und fühlen sich von ihrer Umwelt unverstanden. Sie wissen, dass sie vieles können und durchschauen, aber sie sind nicht in der Lage, dies aufs Papier zu bringen und es ihren Angehörigen, Freunden und Kollegen verständlich zu machen.
Das ist aber nur die aktuelle Seite der AD(H)S-Problematik. Viel schwerwiegender ist die Gefahr der späteren psychischen Instabilität mit einer hohen Rate an sekundären seelischen und körperlichen Erkrankungen. Das Selbstwertgefühl entwickelt sich in der Kinder- und Schulzeit, etwa in der Zeit vom achten bis elften Lebensjahr, und es entscheidet mit darüber, wie das betroffene Kind sein weiteres Leben in den verschiedenen Bereichen meistern wird. Deshalb die große Bedeutung der Frühdiagnostik und Frühbehandlung des AD(H)S.
Die Symptomatik des AD(H)S ist sehr vielfältig und nicht anhand von Tabellen oder Skalen zu erfassen. Diese dienen mehr der Verlaufskontrolle und der Orientierung, wann an ein AD(H)S gedacht werden sollte. Die Kinder und Jugendlichen selbst merken nur, dass sie anders reagieren und dass sie trotz Anstrengung und fleißigem Lernen auch bei guter Intelligenz keinen für sie ausreichenden Erfolg in der Schule und im Beruf haben. Sie spüren ihre innere Unruhe und den Drang, sich immer bewegen zu müssen. Manche müssen alles anfassen, immerzu reden oder ständig jemanden provozieren. Sie lernen nicht aus Fehlern und hören schlecht zu. Was sie aber hören wollen, hören sie ganz genau. Sie können sich auch konzentrieren, wenn sie etwas interessiert, aber es gelingt ihnen nicht immer, selbst dann nicht, wenn sie es möchten.
In ihren Zeugnissen steht sehr oft sinngemäß der Satz: »Du kannst, wenn du willst, das hast du schon bewiesen.« Sie wollen ja, aber sie können die Daueraufmerksamkeit nicht halten, wenn Nebengeräusche oder andere Dinge sie ablenken. Sie beginnen voller Freude und Elan das erste Schuljahr und merken bald, dass sie den Anforderungen nicht gewachsen sind. Sie resignieren langsam und ziehen sich zurück oder sie werden zum Klassenclown, um sich so Bestätigung zu holen. Manche entwickeln psychosomatische Beschwerden. Je nachdem, ob das Kind hyper- oder hypoaktiv ist, neigt es zu Aggressionen oder Ängsten als Folge seiner inneren Verunsicherung.
Viel Leid könnte manchem Kind erspart bleiben, wenn das Krankheitsbild des AD(H)S Eltern, aber auch Lehrern, Psychologen und Ärzten besser bekannt wäre und hilfesuchende Eltern rasch fachkundige Unterstützung erhielten.
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S) wird definiert als eine neurobiologisch bedingte, spezifisch veränderte Steuerungsdynamik der Wahrnehmung, der kognitiven und emotionalen Verarbeitung und der sich daraus ergebenden Reaktions- und Verhaltensbildung. Aus epidemiologischen Untersuchungen1 ist bekannt, dass in Deutschland ca. eine Million Kinder und Jugendliche eine AD(H)S-Konstitution mit beratungs- bzw. behandlungsbedürftigen Entwicklungsbeeinträchtigungen haben. Im Erwachsenenbereich liegt die Zahl der Betroffenen bei etwa 1,5 Millionen. Diese leiden zudem häufig ebenso unter Depressionen, Suchterkrankungen und Angststörungen.
Liegt ein AD(H)S vor, ist die Reizverarbeitung beeinträchtigt
Wahrnehmungen sind oberflächlich und »hüpfend«
Wegen der Reizfilterschwäche wird das Arbeitsgedächtnis überlastet
Äußere Reize können nicht ausreichend nach Wichtigkeit gefiltert werden
Durch Reizüberflutung bilden sich zu viele Leitungsbahnen
Es werden auch unwichtige Informationen abgespeichert
Botenstoffmangel beeinträchtigt die Weitergabe von Informationen vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis
Die Umstellung von einer Tätigkeit zur anderen kann beeinträchtigt sein
Ein schneller Ver-/Abgleich mit »Erinnerungen« ist nicht möglich
Gelerntes und Handlungsabläufe automatisieren sich sehr langsam
Abgespeichertes Wissen kann nicht schnell genug abgerufen werden
Die Symptomatik des AD(H)S ist in jeder Altersgruppe etwas unterschiedlich. Sie wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, ob eine Hypo- oder Hyperaktivität vorliegt.
Die Schwere der Symptomatik und damit auch das Ausmaß des Leidensdruckes hängen von vielen Faktoren ab. Eine gute Intelligenz, ein verständnisvolles soziales Umfeld und geringe Anforderungen bilden schützende Faktoren.
Symptome des AD(H)S
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung
Störung der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung
Störung der Merkfähigkeit
Innere und motorische Unruhe
Mangelhafte emotionale Steuerung
Frustrationsintoleranz
Impulssteuerungsschwäche
Störung der Feinmotorik
Teilleistungsstörungen
Symptome des AD(H)S im Säuglingsalter
Die Symptome des AD(H)S beginnen sich zumeist allmählich, vom ersten Lebensjahr an, zu entwickeln. Häufig fallen sie zunächst noch nicht merkbar auf, da sie je nach Ausmaß der Beeinträchtigungen, der Höhe der Anforderungen und der vorhandenen Ressourcen zuweilen noch über einen längeren Zeitraum kompensiert werden können. Die ersten Anzeichen einer AD(H)S-Problematik sind bereits im Säuglingsalter zu finden. Sie sind aber noch unspezifisch und lassen nur bei familiärer Veranlagung einen Verdacht zu. Die Kombination folgender Symptome – die von Eltern von AD(H)S-Kindern häufig beobachtet wurden – könnte im Säuglingsalter auf eine AD(H)S-Veranlagung hindeuten:
AD(H)S-Symptome im Säuglingsalter
unstillbares Weinen (phasenhaft)
oberflächlicher Schlaf, hellwach
können Streicheln nicht genießen
unruhig und unausgeglichen
kein Krabbeln
zeitiges Laufen
kein ausdauerndes »Spielen«
Trinkschwierigkeiten
Hautallergie
Gibt es in einer Familie bereits AD(H)S-Betroffene, sollten die genannten Symptome Anlass für eine gezielte weitere Beobachtung sein. Eine frühe Diagnose ermöglicht es sodann, den betroffenen Kindern von Anfang an eine strukturierte Betreuung mit viel Verständnis und individueller Förderung zu geben.
Neben den Babys und Kleinkindern, bei denen Eltern die Symptome frühzeitig bemerken, gibt es ebenso völlig unauffällige Säuglinge, die ausgesprochen »pflegeleicht« sind. Sie entwickeln erst später eine meist hypoaktive oder eine zwischen den beiden Subtypen liegende AD(H)S-Form.
Trinkschwierigkeiten sind oft die Folge der manchmal vorhandenen unregelmäßigen Atmung und der gestörten Mundmotorik. Hautallergien und Neurodermitis haben besonders hyperaktive Säuglinge. Viele von ihnen leben gleich nach ihrer Geburt im Stress und verunsichern ihre Eltern durch ihre Unruhe. Möglicherweise leiden sie unter einem Noradrenalinüberschuss im Rahmen ihres angeborenen Ungleichgewichts (dysbalance) der Neurotransmitter (Botenstoffe). Dieser Dauerstress destabilisiert das Immunsystem der Kinder und macht ihren Körper für allergische Reaktionen anfällig. Nicht wenige Eltern berichten, wie anstrengend die Pflege ihres später hyperaktiven Kindes im Säuglingsalter war. Oft konnten sie sich aus diesem Grund zu keinem weiteren Kind entschließen.
Dass seelisches Wohlbefinden und Immunsystem miteinander verknüpft sind, zeigt die Tatsache, dass sich eine Allergie bei einem AD(H)S-Kind unter der Behandlung nicht selten deutlich bessert oder gar verschwindet.
Symptome des AD(H)S bei Kleinkindern
AD(H)S-Symptome beim Kleinkind (1.–3. Lebensjahr)
hochgradige motorische Unruhe oder auffallend ruhig und brav
spielt nur kurzzeitig, schnell wechselnd in der Beschäftigung, ohne sie zu beenden
verzögerte Sprachentwicklung
fein- und grobmotorisch ungeschickt
lernt schwer, sich allein anzuziehen
motzt schnell und unangemessen stark
fällt »über die eigenen Beine« und weint leicht
Auffälligkeiten in der Mundmotorik (offener Mund, sabbert lange)
hat Umstellungs- oder Anpassungsprobleme
überängstlich, klammert, sehr anhänglich
kann nicht warten, bis es an der Reihe ist
empfindlich oder extrem unempfindlich gegenüber Außenreizen
Das hyperaktive Kleinkind ist sehr unruhig, umtriebig und schwer lenkbar. Es ist dauernd in Bewegung, klettert überall hoch, macht alle Schränke auf und reagiert nicht auf Zuruf. Es wird schnell wütend und schlägt gleich zu. Solche Kinder sind für ihre Eltern eine große Herausforderung und für ihre Geschwister nicht selten eine Belastung. Ihr Kommentar lautet oft: Der oder die »nervt»...
Hyperaktive Kinder fallen frühzeitig durch die Hauptsymptome des AD(H)S
motorische Unruhe,
Impulssteuerungsschwäche mit Spontanhandlungen sowie
verminderte Konzentration und Daueraufmerksamkeit
auf und grenzen sich durch die Intensität und Beständigkeit dieser Symptome von den lebhaften, temperamentvollen Kindern ab.
Weniger fallen dagegen die hypoaktiven Kinder auf.
Symptome des hypoaktiven Kindes im Vorschulalter (4.–6. Lebensjahr)
verhält sich ängstlich und unsicher
weint und motzt leicht, ist stimmungslabil
begreift manches langsam, kann nicht zuhören, sagt gleich: das kann ich nicht
Auffälligkeiten in der Mundmotorik, spricht undeutlich
Auffälligkeiten in der Sprache, verwechselt Konsonanten
motorische Probleme, malt und bastelt nicht gern
Probleme beim Schwimmenlernen und beim Fahrradfahren
selten Kontaktaufnahme zu gleichaltrigen Kindern
im Kindergarten Rückzugs- und Regressionstendenzen
spielt gern allein in der Puppen- oder Bauecke (oft stundenlang)
hat über viele Jahre immer den gleichen Freund
in seiner Tätigkeit viel zu langsam oder viel zu schnell
zieht sich aus dem Stuhlkreis zurück, kann nicht zuhören
kann sich nicht allein beschäftigen, langweilt sich immer
vergisst und verliert immer wieder Gegenstände
Die oben genannten Symptome des hypoaktiven Kindes werden zwar häufig übersehen, können jedoch in ihrer Summe seine seelische Entwicklung maßgeblich beeinträchtigen. Unerkannt, unbeachtet und unbehandelt kann das AD(H)S schwere Folgen für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis hin zum Erwachsenenalter haben.
Bei ausgeprägter Symptomatik sollte das AD(H)S schon vor der Einschulung diagnostiziert und behandelt werden, wenn nötig auch schon medikamentös mit Stimulanzien. Dies, damit sich das betroffene Kind nach der Einschulung nicht als »Versager« erlebt.
Symptome des hyperaktiven Kindergartenkindes (4.–6. Lebensjahr)
motorisch sehr unruhig, immer in Bewegung
spricht schnell und laut, schreit herum
regt sich leicht und übermäßig stark auf
reagiert spontan und oft unüberlegt, schlägt schnell zu
fragt viel, wartet aber oft die Antwort gar nicht ab
kann nicht lange zuhören, vergisst und verliert viel
bei Unsicherheit schnell aggressiv
hat Sprachprobleme: Stammeln, Schwierigkeiten einige Konsonanten auszusprechen
hält den Stift verkrampft und drückt ihn viel zu sehr auf
kann schlecht malen und Linien einhalten
hält sich nicht an Regeln, vergisst sie und redet immer dazwischen
will immer bestimmen, motzt schnell, ist schnell beleidigt
hat mit sich und anderen keine Geduld
hat einen großen Gerechtigkeitssinn, verzeiht auch schnell
will im Sport immer der erste sein, bei sozialen Diensten sehr eifrig
schläft spät ein, braucht wenig Schlaf
nässt tagsüber manchmal noch ein, seltener auch nachts
kann sich zu Hause anders als im Kindergarten verhalten
Im Kindergartenalter sind zwischen dem hypo- und hyperaktiven Subtyp schon verschiedene Übergangsformen zu beobachten. Das hypoaktive Kind ist angepasst und ängstlich, das hyperaktive Kind dagegen verhaltensauffällig und aggressiv. Sowohl die Ängstlichkeit als auch die Aggressivität sind jedoch beide Zeichen einer inneren Verunsicherung, die bereits den Beginn einer reaktiven Fehlentwicklung anzeigen.
Symptome des AD(H)S bei Schulkindern
Im Schulalter werden die Unterschiede zwischen hypo- und hyperaktiven Kindern deutlicher sichtbar, wobei zwischen beiden AD(H)S-Varianten viele Übergänge und Zwischenstufen existieren: Ein Kind kann z. B. in seinem äußeren Auftreten hyperaktiv, in seinem Denk- und gezielten Handlungsvermögen jedoch hypoaktiv geprägt sein.
Symptome des hypoaktiven Schulkindes
ist unkonzentriert, verträumt und viel zu langsam
hat Probleme in der Feinmotorik, beim Schreiben und Malen
leicht ablenkbar, vergisst und überhört viel
innerlich und motorisch unruhig, im Denken langsam und umstellungserschwert
ist zu empfindlich, weint leicht, ist schnell gekränkt
kann Kritik nicht vertragen, fühlt sich ungeliebt und missverstanden
macht zu Hause stundenlang und nicht allein Hausaufgaben
ist ängstlich und traut sich nichts zu
bleibt in der sozialen Reife zurück, spricht manchmal in Babysprache
hat oft Kopf- oder Bauchschmerzen
lässt sich leicht ärgern, kann sich nicht entsprechend wehren
Im Folgenden sei der Kommentar einer Lehrerin zum Abschlusszeugnis der ersten Klasse eines Jungen (Tobias) wiedergegeben, der ein Jahr später – trotz sehr guter Intelligenz – die zweite Klasse wiederholen musste (siehe unten). Die Gründe dafür lagen vor allem in einem zu langsamen Arbeitstempo des Jungen sowie in seinen zu vielen Fehlern im Diktat und beim Rechnen. Zu Hause war Tobias ständig unzufrieden mit seinen Hausaufgaben, bei denen er mehr radierte als er schrieb. Da er sich zwischendurch sehr erregte und weinte, brauchte er für die Hausaufgaben ein bis drei Stunden. Lautes Lesen verweigerte er. Die Ursache dafür war ein AD(H)S ohne Hyperaktivität mit Lese-Rechtschreib-Schwäche infolge multipler Störungen in der Informationsverarbeitung.
Wenn man dieses Zeugnis genau liest, lassen sich schon am Ende der ersten Klasse Schwierigkeiten erkennen, die von der Lehrerin sehr gut beobachtet und beschrieben wurden. Nach deren Ursachen wurde zunächst allerdings leider nicht weiter geforscht, sonst wäre dem Jungen einiges erspart geblieben.
Kommentar zum Abschlusszeugnis der ersten Klasse von Tobias
Tobias hat nach wie vor große Schwierigkeiten, sich im Schulalltag zurechtzufinden. Mit den anderen Kindern kommt er meist gut zurecht. Häufig muss er noch daran erinnert werden, die vereinbarten Regeln einzuhalten. Manchmal stört er durch Dazwischenreden und lautes Lachen den Unterricht. Leicht ablenkbar kann er diesem nur phasenweise folgen und sich nur für kurze Zeit konzentrieren. Seine Mitarbeit ist noch zu gering. An Gesprächen beteiligt er sich äußerst selten und muss zur Mitarbeit immer erst aufgefordert werden. Meist ist er gedanklich mit anderen Dingen beschäftigt, träumt, schaut aus dem Fenster – dadurch bekommt er viele Erklärungen nicht mit.
Erst in den letzten Wochen gelang es ihm, Arbeitsanweisungen, die für alle gegeben wurden, auch auf sich selbst zu beziehen und umzusetzen. Dabei muss er sein Arbeitstempo noch erheblich steigern und seine Hefte sorgfältiger führen.
Erst sehr spät verstand Tobias das Leseprinzip. Allerdings kennt er noch nicht alle Buchstaben sicher und hat große Mühe, sie zu unterscheiden. Er liest noch sehr stockend, bei längeren Wörtern muss er noch lautieren, sodass er den Sinn des Gelesenen nicht versteht. Schriftliche Arbeitsanweisungen kann Tobias erst nach persönlicher Erklärung umsetzen. Er sollte täglich lautes Lesen üben.
Tobias' Stifthaltung ist noch sehr verkrampft, sein Schriftbild sehr eckig und ungleichmäßig. Vorgegebene Reihen werden nicht eingehalten. Beim Abschreiben macht er wenig Fehler, aber es erfolgt viel zu langsam. Bei Diktaten sind nur ganz wenige Wörter lesbar. Nach intensivem Üben kann er auch fast fehlerfrei schreiben.
Tobias erzählt gern von eigenen Erlebnissen, dabei zeigt er einen reichhaltigen und differenzierten Wortschatz. Hier ist er den meisten Kindern seiner Klasse weit voraus.
Im Rechnen hat er den erarbeiteten Zahlenraum weitgehend erfasst. Einfache Plus- und Minusaufgaben rechnet er meist richtig. Für neue und ungewohnte Aufgaben braucht er noch zu viel Zeit. Bei Sachaufgaben findet er selten den Rechenweg allein.
Musische Tätigkeiten scheinen ihn eher zu langweilen, aber im Sportunterricht ist er für alle Bewegungsspiele schnell zu begeistern und bemüht sich immer der Erste zu sein.
Das hyperaktive Kind zeigt dagegen ein anderes, fast gegenteiliges Erscheinungsbild, wenngleich beiden AD(H)S-Varianten die wesentlichsten Symptome gemeinsam sind, da bei beiden die gleiche Grundstörung vorliegt.
Symptome des hyperaktiven Schulkindes
ist motorisch unruhig, immer in Bewegung und zappelt viel
unkonzentriert, kann nicht zuhören und vergisst viel
spielt und arbeitet unbeständig, wechselt schnell von einer Beschäftigung zur anderen
hat motorische Probleme, kann seine Kraft schlecht dosieren
guter Beobachter, bemerkt alles, kann andere gut durchschauen
nimmt alles wahr, kann schlecht zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden
antwortet oft, noch bevor die Frage richtig gestellt wurde
glaubt, alles zu können, und überschätzt sich leicht
lernt nicht aus Fehlern, fühlt sich schnell ungerecht behandelt
ist sehr laut, aber selbst oft geräuschempfindlich
kann schlecht mit den Hausaufgaben anfangen und unterbricht sie oft
will immer bestimmen, kann Gefahren schlecht einschätzen
setzt sich für andere ein, auch wenn es dadurch selbst Ärger bekommt
kommt mit Gleichaltrigen schlechter aus als mit Älteren oder Jüngeren
sammelt nutzlose Dinge
Viele Schulkinder, ob hyper- oder hypoaktiv, haben Probleme beim Lösen von Textaufgaben und beim Aufsatzschreiben.
Die neurobiologisch bedingten Defizite können bei AD(H)S-Kindern im Schulalter aufgrund der erhöhten Anforderungen im Leistungs- und Verhaltensbereich zu verschiedenen Funktionsstörungen führen, die in ihrer Vielfalt bei jedem einzelnen Kind in eine unterschiedliche individuelle Symptomatik münden. Diese weist ein immer gleiches Grundmuster auf, das jedoch in verschiedener Schwere ausgeprägt ist.
Abb. 1.1:Verschiedene Formen des AD(H)S
Einteilung und Beschreibung des AD(H)S durch das DSM-5
Das zurzeit am besten standardisierte diagnostische Manual ist das amerikanische DSM-5 aus dem Jahre 2014. Dieses teilt das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in drei Gruppen ein, nämlich AD(H)S
mit vorwiegend Unaufmerksamkeit
mit Hyperaktivität und Impulsivität
den Mischtyp, der von beiden etwas hat
Das DSM-5 (= das diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft) wird auch in den deutschsprachigen Ländern für die Diagnostik seelischer Erkrankungen verwendet. Die USA sind uns in der Diagnostik und Behandlung von AD(H)S und seiner Akzeptanz in der Bevölkerung jedoch weit voraus. Das mag nicht zuletzt daran liegen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika besonders viele Personen vom AD(H)S betroffen sind. Dies beruht zu großer Wahrscheinlichkeit nicht zuletzt darauf, dass diese Störung vererbt wird. So wissen wir heute, dass es für AD(H)S eine genetische Veranlagung gibt, die auf die nächste Generation übertragen werden kann.
Der unaufmerksame AD(H)S-Typus nach DSM-5
beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schulaufgaben, bei der Arbeit oder anderen Tätigkeiten
hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten
scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere sprechen
führt Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schulaufgaben oder andere Pflichten nicht zu Ende bringen
hat Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren
vermeidet Aufgaben oder macht solche nur widerwillig, die eine längere geistige Tätigkeit erfordern
verliert häufig Gegenstände, die benötigt werden
lässt sich leicht und oft durch äußere Reize ablenken
ist bei Alltagstätigkeiten oft vergesslich
flüchtet häufig in eine Traumwelt
Der hyperaktive AD(H)S-Typus nach DSM-5
Dieser Typus liegt vor, wenn bei einer mindestens sechs Monate bestehenden Störung mindestens acht der folgenden Anzeichen vorhanden sind. Der/die Betroffene
wird leicht durch äußere Reize abgelenkt
hat Schwierigkeiten, bei Aufgaben und Spielen längere Zeit aufmerksam zu sein
kann nur schwer sitzen bleiben, wenn dies von ihm verlangt wird
zappelt häufig mit Händen und Füßen oder windet sich in seinem Sitz (bei Jugendlichen kann sich dies auf subjektive Empfindungen von Rastlosigkeit beschränken)
kann nur schwer ruhig spielen
kann bei Gruppen- und Spielsituationen nur schwer warten, bis er an der Reihe ist
unterbricht oft andere und drängt sich diesen auf, platzt z. B. in das Spiel anderer Kinder hinein
redet häufig übermäßig viel
platzt oft mit der Antwort heraus, bevor die Frage vollständig gestellt ist
scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere mit ihm sprechen
hat Schwierigkeiten, Aufträge anderer vollständig auszuführen (nicht bedingt durch oppositionelles Verhalten oder Verständigungsschwierigkeiten), beendet z. B. die Hausaufgaben nicht
wechselt häufig von einer nicht beendeten Aktivität zur anderen
verliert häufig Gegenstände, die er für Aufgaben oder Aktivitäten zu Hause oder in der Schule benötigt (z. B. Spielzeug, Bleistifte, Bücher, Anweisungen)
unternimmt oft ohne Rücksicht auf mögliche Folgen körperlich gefährliche Aktivitäten (nicht aus Abenteuerlust), rennt z. B. ohne zu schauen auf die Straße
Bei der besonders schweren Form des AD(H)S mit Hyperaktivität sind noch weitere Symptome vorhanden, die mit einer Störung der sozialen Anpassung an die Familie und an Gleichaltrige sowie mit einer deutlichen Beeinträchtigung der schulischen Leistungsfähigkeit verbunden sind.
Die Symptome sind Folge einer Funktionsbeeinträchtigung des Stirnhirns durch Mangel einzelner Botenstoffe mit der Folge einer »Dysbalance« (d. h. dass das Verhältnis der einzelnen Botenstoffe zueinander verschoben ist). Dies führt zum Beispiel zu einer veränderten Wahrnehmung, die wiederum mit zu schnellen oder zu langsamen Reaktionen verknüpft ist.
Die wichtigsten Symptome des AD(H)S im Kindesalter im Detail
Mangel an Konzentration und Daueraufmerksamkeit
Ist ein AD(H)S-Kind von einer Sache fasziniert, kann es sich sehr gut konzentrieren. Wird es aber abgelenkt und die Beschäftigung uninteressant, lässt seine Konzentration erheblich nach, sie kann dann auch nicht willentlich aktiviert werden. Ein AD(H)S-Kind kann seine Aufmerksamkeit nicht über einen länger andauernden Zeitraum aufrechterhalten und schon gar nicht, wenn es gelangweilt ist. Dann hat es mit seiner inneren Unruhe zu kämpfen, die für ihn bei Nichtbeschäftigung unerträglich wird. Dann muss es sich körperlich intensiv bewegen oder durch Provozieren Ärger erzeugen.
AD(H)S-Kinder sind aber auch in der Lage, stundenlang mit Lego-Bausteinen zu spielen, fernzusehen, mit dem Game-Boy zu spielen oder anderen »Lieblingsaktivitäten« nachzugehen, soweit diese ihr Belohnungssystem aktivieren. Auffällig ist, dass Computerspiele fast alle Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen mit AD(H)S faszinieren. Dies hat seinen Grund darin, dass der Computer das menschliche Gehirn durch seine schnell wechselnden Bildfrequenzen besonders stimuliert.
Mangelnde Strukturierung
AD(H)S-Kinder können sich schlecht für eine komplexe Aufgabe motivieren und diese erfolgreich strukturieren. Kinder mit AD(H)S stehen deshalb häufig vor großen Problemen beim Lösen von Textaufgaben. Sie nehmen zu oberflächlich wahr und können nicht ordnen. Sie schreiben ebenso die Schulaufsätze sehr oft viel zu kurz und mit Gedankensprüngen. Dabei achten sie weder auf die Rechtschreibung noch auf die Zeitform. Sie wechseln in ihrer Schilderung ständig zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Bei Klassenarbeiten setzen sie sich häufig zu sehr unter Druck: Infolge ihrer emotionalen Steuerungsschwäche verbunden mit Stressintoleranz gelingt ihnen dann gar nichts mehr, ihr logisches Denken ist unter Stress beeinträchtigt. So kommt es – trotz guter Vorbereitung und ausreichendem Wissen – nicht selten zum regelrechten Black-out.
Hausaufgaben werden zum Problem Nr. 1
Das Erledigen von Hausaufgaben wird zu Hause und in der Schule zu einem schwerwiegenden Problem, wenn AD(H)S-Kinder keine Lust dazu haben. Sie besitzen kein Zeitgefühl, denken in Stunden und können sich gar nicht erst überwinden, anzufangen. Beginnen sie endlich nach langen Diskussionen mit den Aufgaben, muss die Mutter daneben sitzen und immer wieder zum Weiterarbeiten ermuntern. Verlässt die Mutter das Zimmer, wird sofort aufgehört und gespielt, aus dem Fenster geschaut oder gemalt. Das AD(H)S-Kind steht während der Hausaufgaben mehrmals auf, um irgendetwas ganz »Dringendes« zu erledigen.
Handeln, ohne vorher nachzudenken
Das impulsive Handeln, ohne vorher nachgedacht zu haben, ist für AD(H)S-Kinder typisch. Zunächst in Ruhe nachzudenken, fällt den Kindern schwer, da ihr Stirnhirn nicht einwandfrei funktioniert. Unser Tun und Handeln wird vom Stirnhirn kontrolliert und mit den Erfahrungen aus dem Langzeitgedächtnis verglichen und dann erst »freigegeben«. Bei Menschen mit AD(H)S muss jede Idee jedoch sofort umgesetzt werden. Sie können schlecht abwarten, bis sie an der Reihe sind, weil sie bis dahin sonst alles wieder vergessen haben. Auch jedes Gefühl wird deshalb unmittelbar und unkontrolliert geäußert. AD(H)S-Betroffene lernen nicht aus Fehlern und können gemachte Erfahrungen nicht direkt mit dem aktuell Erlebten vergleichen. Die Aktivierung des Langzeitgedächtnisses und dessen Informationsweiterleitung gelingen infolge von Botenstoffmangel und eines viel zu dichten und weit verzweigtem neuronalen Netzes deutlich langsamer. Deshalb können diese Kinder schlechter aus Fehlern lernen und ihnen bekannte Regeln einhalten. Sie stehen ihnen im Moment des Handelns nicht so schnell zur Verfügung. Denn ein AD(H)S-Kind braucht für die Automatisierung von Leistungen im Denken und im Handeln um ein Vielfaches mehr Zeit als ein anderes Kind. Man muss also einem AD(H)S-Kind wichtige Informationen mehrmals direkt mitteilen und diese wiederholen lassen, erst dann ist es in der Lage, diese abrufbereit zu speichern. Interessant und auffällig ist, dass AD(H)S-Kinder zugleich fähig sind, sich dagegen Dinge zu merken, die schon längst Vergangenheit und für andere uninteressant und unbedeutend sind. So besteht bei ihnen besonders für kränkende Ereignisse ein Riesengedächtnis. Das AD(H)S-Kind kann meist schnell auswendig lernen, ist aber nicht in der Lage, aus einem längeren Text das Wesentliche zu erfassen. Der Text bedeutet Chaos, Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden fällt schwer.
Schlechte Steuerung der Gefühle
Das Stirnhirn ist auch dafür verantwortlich, dass AD(H)S-Kinder ihre Emotionen nur schwer steuern können. Die Kinder können ihre Gefühle bei Motz- oder Wutanfällen nicht abfangen und sie sozial angepasst abreagieren. Sie weinen rasch und fühlen sich leicht angegriffen. Dabei sucht das hypoaktive Kind immer die Schuld bei sich, das hyperaktive dagegen meist bei anderen, mit einem »immer ich!« weist es lautstark alle Beschuldigungen energisch zurück.
Vergesslichkeit und Lügen
AD(H)S-Kinder verfügen im Gehirn nur über einen durch Reizüberflutung überlasteten Arbeitsspeicher, der die Reize der Umgebung nicht nach ihrer Wichtigkeit sortieren kann. Sie nehmen ihre Umwelt nur oberflächlich wahr und ersetzen Erinnerungslücken als Selbsthilfe durch ihre sehr gute Fantasie. Tatsächlich können sie sich im Moment an nichts anderes erinnern und halten die auf diese Weise konstruierten Wirklichkeiten für real. Sie werden deshalb schnell als Lügner beschimpft, womit man ihnen Unrecht tut. Kommen sie innerlich zur Ruhe, fällt ihnen die wirkliche Begebenheit wieder ein – nur unter Stress gelingt dies eben nicht.2
Eine zu langsame bzw. zu schnelle Arbeitsgeschwindigkeit
Die Arbeitsgeschwindigkeit von AD(H)S-Kindern fällt je nach AD(H)S-Typ entweder viel zu langsam oder viel zu schnell aus, besonders im Rahmen schriftlicher Arbeiten. Das Ergebnis entspricht dann nicht der eigentlichen Intelligenz und dem Leistungsvermögen der Kinder, trotz reichlichem Üben. Ihre Schrift ist krakelig, die Buchstaben hängen zwischen den Linien und sind oft unleserlich. Weder Rand noch Datum, nur viele Kleckse und Eselsohren. Oder die Kinder liefern eine gezirkelte Schrift mit perfektionistischer Ordnung ab, ohne jedoch den Stoff der Schulstunde je zu schaffen. Beide Male wird mit verkrampfter Hand und mit viel zu viel Druck geschrieben.
Motorische Beeinträchtigungen
Motorische Beeinträchtigungen können sich als Probleme in der Fein-, Grob-, Grapho-, Sprech- und/oder Augenmotorik sowie in der Koordination äußern. Die Körperbewegungen von Kindern mit AD(H)S wirken dann nicht fließend, sondern unharmonisch mit schlechter Kraftdosierung. Ihre Schrift automatisiert sich nicht, d. h. mit zunehmendem Schreibtempo wird sie eckig, »krakelig«, meist gelingt Druckschrift besser. Bei beeinträchtigter Körperkoordination können Hampelmannsprung, Radfahren oder Schwimmen nur mühsam erlernt werden. Ist die Sprachmuskulatur betroffen, gelingt eine deutliche Aussprache von Wortenden oder einiger Konsonanten nicht immer, z. B. der S- und Z-Laute; es kommt zum Lispeln. Ist der Sprachrhythmus gestört, tritt unter psychischer Anspannung zeitweiliges Stammeln auf. Sind die Augenmuskeln betroffen, kann es zum gestörten dynamischen beidäugigen Sehen kommen, d. h. die Augen bleiben bei Bewegung nicht ständig in Parallelstellung, sodass kurzzeitig das Gelesene unscharf erscheint oder sich nach oben oder unten verschiebt.
Das Selbstwertgefühl leidet
AD(H)S-Kinder leiden je nach der Schwere der Symptomatik unter einem verminderten Selbstwertgefühl. Dieses bleibt, sofern das Kind sich weiterhin nur negativ erlebt und nicht bald Anerkennung und Lob erhält, lebenslänglich negativ besetzt. Häufig bemühen sich die Kinder, ihr schlechtes Selbstwertgefühl zu kompensieren: Sie suchen die Anerkennung der Gleichaltrigen durch die Aufgabe eigener Interessen oder durch das »Erkaufen« von Freundschaften. Sie wagen Mutproben, die kein anderer machen würde, oder fallen in die Rolle des Klassenclowns. Manche kompensieren ihr schlechtes Selbstbild auch durch einen unangepasst »starken Willen«.
Ordnung halten fällt sehr schwer
AD(H)S-Kinder sammeln tausend Dinge, die ihnen in die Hände fallen; alles muss direkt griffbereit sein und nichts wird nach System abgelegt. Die Kinder sind nicht in der Lage, ihre Zimmer systematisch aufzuräumen: Die Spielsachen werden nicht auf-, sondern einzig umgeräumt.
AD(H)S-Kinder sind in ihrer sozialen Reife zurück
AD(H)S-Kinder zeigen in Situationen der Unsicherheit oft kleinkindhaftes Verhalten. Sie spielen grundsätzlich lieber mit jüngeren oder auch älteren Kindern und entwickeln nur wenige Freundschaften, diese aber dafür umso intensiver. Sie suchen verstärkt Kontakt und intensive Zuwendung zu einzelnen Erwachsenen und sind für diese in ihrer großen Anhänglichkeit nicht selten anstrengend. Von ihren Klassenkameraden werden sie oft ausgegrenzt, da sie sich schlecht in eine Gruppe eingliedern können. Die Hyperaktiven wollen immer bestimmen, die Hypoaktiven erwarten eine besondere »Einladung« mitzumachen. Die übrigen Altersgenossen merken, dass das Verhalten der AD(H)S-Kinder anders ist. Untereinander verstehen sich AD(H)S-Kinder gut, allerdings gibt es oft Ärger, der aber schnell vergessen wird.
Die oben beschriebenen Symptome müssen nicht in ihrer Gesamtheit bei allen Kindern mit AD(H)S vorhanden sein. Neben einer ausgeprägten AD(H)S-Symptomatik gibt es eine Veranlagung zum AD(H)S mit diskreter Symptomatik und die verschiedensten Erscheinungsbilder zwischen der Hyper- und Hypoaktivität. Die Hyperaktivität schwächt sich meist im Laufe des Jugendalters ab, was aber bleibt, ist die emotionale Steuerungsschwäche, die innere Unruhe und der Mangel an Daueraufmerksamkeit.
Abb. 1.2:Ein Jugendlicher mit AD(H)S hat »aufgeräumt«
Symptome des AD(H)S bei Jugendlichen
Im Folgenden sind zum einen allgemeine Auffälligkeiten bei Jugendlichen mit AD(H)S, zum anderen spezifische Symptome bei hyper- und hypoaktiven Jugendlichen aufgeführt.
Auffälligkeiten bei Jugendlichen mit AD(H)S
sehr stark ablenkbar
innere und äußere Unruhe
schlechte Gefühlssteuerung mit Impulsivität
unzureichende Fähigkeit, den Tagesablauf zu organisieren
geringe Zielstrebigkeit
Leistungsabfall unter Stress
negatives Selbstwertgefühl
schneller Verlust der Selbstkontrolle
Einnahme von anregenden oder beruhigenden Mitteln als Selbstbehandlung
Schlafschwierigkeiten und häufiges Grübeln
Energiemangel
Geräuschempfindlichkeit bei selbst lauter Sprache
schlechtes Schriftbild
Handeln unüberlegt, ohne an die Folgen zu denken
sind überempfindlich
fallen bei Trennung in ein »Loch«
AD(H)S-Symptome bei Jugendlichen
spätere Pubertät als bei Gleichaltrigen, aber intensiver und länger
Selbstwertproblematik mit Versagensängsten und Selbstwertkrisen
mangelnde Selbstkontrolle mit starken Stimmungsschwankungen
sehr sensibel mit großem Gerechtigkeitssinn
extreme Reaktion bei Trennung, Verlust und Enttäuschung
schneller Wechsel von Interessen und Freunden oder Rückzug in die Isolation
Probleme bei der Berufsfindung, können sich nicht entscheiden
starker Wille, wenn von etwas überzeugt und begeistert
kein Zeitgefühl, Leben zwischen Langeweile und Zeitstress
Schwierigkeiten, konzentriert zu lernen und das Gelernte zu behalten
Schwarz-Weiß-Denken mit depressiven Löchern
Impulssteuerungsschwäche mit Panikattacken und Blackout-Reaktionen
Frustrationsintoleranz
Selbstgefährdung, um sich zu spüren und sich abzureagieren
Neigung zum Nikotin- und Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum
Freude an Geschwindigkeit und Computerspielen oder Rückzug in eine Traumwelt
Symptome des AD(H)S bei Erwachsenen
Die meisten Erwachsenen mit AD(H)S klagen über:
eine innere Unruhe,
ein schlechtes Selbstwertgefühl,
Schwierigkeiten bei der Gefühlssteuerung,
Konzentrationsschwäche,
mangelhafte Wahrnehmung,
nicht verstanden zu werden.
Die häufigsten AD(H)S-Symptome bei Erwachsenen sind:
Hohe Ablenkbarkeit, Konzentrationsschwäche
Gefühl innerer und äußerer Unruhe
Affektlabilität, Aggressivität, Impulssteuerungsschwäche
Probleme bei der Selbstorganisation und der emotionalen Steuerung
Bei der Tagesstrukturierung Schwierigkeiten, Ordnung und Zeit einzuhalten
in der Lebensplanung oft Mangel an Zielstrebigkeit und eigener Perspektive
Leistungsabfall unter Stress, der sich nur verzögert abbaut
Mangel an Problemlösungsstrategien
Geringes Selbstvertrauen oder Selbstüberschäzung bei beeinträchtigter Wahrnehmung
Reiferückstand in der sozialen Kompetenz
Bedürfnis nach anregenden Mitteln zur Selbstbehandlung
Ein- und Durchschlafschwierigkeiten
Energiemangel bei Interesse, aber sehr leistungsfähig
Immer wieder vergesslich trotz gelobter Besserung
Einige Eltern von AD(H)S-Kindern berichten, dass sie selber in der Grundschule unter einer AD(H)S-Problematik litten, die zuweilen mit einer Rechtschreib- und/oder Rechenschwäche verknüpft war. In einigen Fällen habe sich die Problematik von der 5. Klasse an deutlich gebessert. Diese Berichte bestätigen die Tatsache, dass es durchaus eine spontane Besserung der AD(H)S-Problematik gibt, wie sie sich auch unter der Behandlung in der Praxis zeigt.
Ist erst einmal die Pubertät überstanden, verliert bei vielen Erwachsenen das AD(H)S an Dramatik. Finden sie einen interessanten Beruf, der ihnen die Entfaltung ihrer vielen positiven Fähigkeiten gestattet, und einen passenden Lebenspartner, der Verständnis, Struktur und Toleranz mitbringt, so können sie ein erfülltes Leben mit guter Qualität genießen. Vorausgesetzt, ihr Selbstwertgefühl hat in der Kindheit nicht zu sehr gelitten. In der Familie sind Erwachsene mit AD(H)S sehr harmoniebedürftig, sehr feinfühlig und manchmal leider zu inkonsequent, was sodann auch die Erziehung ihrer Kinder (ohne und eventuell mit AD(H)S) betrifft. Im Beruf sind sie fähig, besonders hohe Leistungen zu vollbringen, zu denen nur sie so in der Lage sind. Sie verausgaben sich dabei schnell, klagen über eine starke Erschöpfung und Kraftlosigkeit nach der Arbeit. Sie sind dann so müde und ausgebrannt, dass sie sich abends weder der Familie noch einem Hobby widmen können. In ersten Ansätzen können diese Erscheinungsformen auch schon Jugendliche betreffen.
Weitere Symptome können je nach Schwere des Betroffenseins und abhängig vom AD(H)S-Typ bei Erwachsenen auftreten:
Ziellosigkeit trotz vieler Pläne bei gleichzeitiger Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen
leben im Hier und Jetzt, sind leicht beeinflussbar, schnell zu begeistern bei fehlender Ausdauer
bei Interesse arbeiten sie unermüdlich und können sich durch ihre Fähigkeit der Überfokussierung auch dann gut auf diese Sache konzentrieren
Stimmungsschwankungen zwischen Impulsivität und »depressiven Löchern«
unzuverlässig und ungeduldig bei Entscheidungen privater, geschäftlicher oder finanzieller Art, oder
perfektionistisch mit sturen, fast zwanghaften Regeln
niedrige Stresstoleranz, reagieren dann unüberlegt
Pessimismus, mangelndes Selbstvertrauen, fehlende Motivation