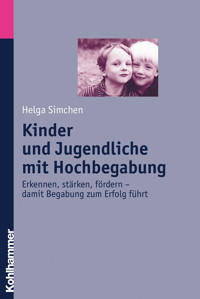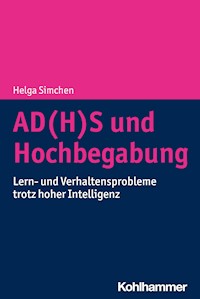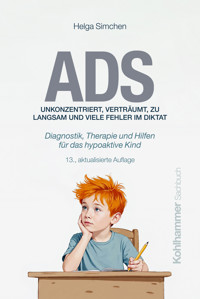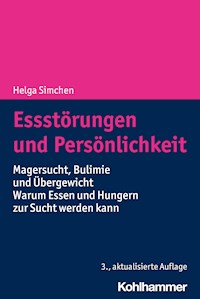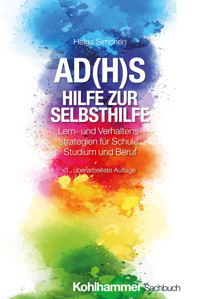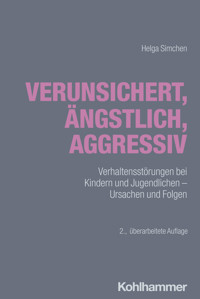
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Länger bestehende Verhaltensstörungen entwickeln bei Kindern und Jugendlichen eine besondere Dynamik, die die Qualität und Entwicklung ihres gesamten Lebens beeinflussen kann. Ängste und Aggressionen signalisieren oft den Beginn einer psychischen Destabilisierung und können den Weg zum stummen oder oppositionellen Außenseitertum bahnen. Häufig führt die Summe vieler Belastungsfaktoren zu psychischen Störungen. Dieses Buch zeigt auf, wie Verhaltensstörungen in der Familie, in der Schule und im sozialen Umfeld frühzeitig erkannt und ursachenorientiert behandelt werden können. Die 2. Auflage wurde nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen überarbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort zur 1. Auflage
1 Ängstlich und aggressiv als Kind – psychisch krank als Erwachsener
1.1 Die Kindheit prägt unser Verhalten
1.2 Reaktionen der Umgebung
1.3 Dauerstress – Ursachen und Folgen
1.4 Was tun bei mangelhafter Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung?
1.5 Wann sollte ein Verhaltenstherapeut befragt werden?
1.6 Jahrzehnt der Verhaltensstörungen
2 Selbstwertgefühl und Verhalten
2.1 Das Selbstwertgefühl
2.2 Kindliches Verhalten
2.3 Die Verhaltensbildung
2.4 Selbstwertgefühl und soziale Kompetenz
3 Verhaltensauffälligkeiten
3.1 Die neurologischen Ursachen der Verhaltensbildung
3.2 Wichtige Gehirnbereiche für die Verhaltensbildung
3.3 Kriterien zur Verhaltensbeurteilung
3.4 Wenn auffälliges Verhalten zur Verhaltensstörung wird
3.5 Beispiele aus der täglichen Praxis
3.6 Wie kann Verhaltensstörungen entgegengewirkt werden?
3.7 Konkrete Hilfen frühzeitig einsetzen
3.8 Erwartetes Verhalten
3.9 Verhaltensbesonderheiten in der frühen Kindheit
Das Schreikind mit »Dreimonatskolik«
Das trotzende Kind
Der »Wegbleiber« – respiratorische Affektkrämpfe
3.10 Richtiges Verhalten erlernen
4 Ursachen von Verhaltensstörungen behandeln
4.1 Erbanlagen und soziale Normen
4.2 Der Beginn einer Negativspirale
4.3 Ergebnisse veränderter Wahrnehmung
4.4 Die Bedeutung des sozialen Umfeldes
4.5 Der Einfluss der Vererbung
4.6 Beeinträchtigung der Entwicklung
Asperger-Syndrom
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S) mit und ohne Hyperaktivität
Fragiles-X-Syndrom
4.7 Die Bedeutung des Zentralnervensystems für die Verhaltensbildung
4.8 Neurobiologie des Lernens
4.9 Verbesserung der Wahrnehmungsverarbeitung
5 Gehirn, Umwelt und Verhalten
5.1 Was beeinflusst die Gehirnentwicklung?
Toxine (Giftstoffe) in der Schwangerschaft als wichtige Ursache für Funktionsstörungen des Gehirns
Infektionen in der Schwangerschaft
Hochgradige Unreife bei der Geburt
5.2 Die Bedeutung der Vorbildwirkung für Verhaltensbildung
5.3 Fördern und fordern – durch Spielen lernen
Bedeutung des Spielens
Kindergarten als Vorbereitung auf die Schule
5.4 Die Erziehung
Erziehen ist schwer, richtig erziehen noch schwerer
Richtige Belohnung
Wie viel Erziehung braucht ein Kind?
Kriterien der sozialen Reife
Verwöhnende Erziehung
Erziehung setzt Grenzen mit Konsequenzen
6 Wahrnehmungsverarbeitung und Stress
6.1 Stress als Ursache und Folge veränderter Wahrnehmung
6.2 Stress ist ein Bindeglied zwischen Veranlagung und Verhalten
6.3 Körperliche Auswirkungen von negativem Stress
Die Wirkung von Stress auf das Nervensystem
6.4 Stressbewältigung
6.5 AD(H)S – ein Stresspotenzial
6.6 Ängste und Aggressionen in der Kindheit
6.7 Was bedeutet »reaktive Fehlentwicklung«?
6.8 Psychischer Stress und das Immunsystem
6.9 Alpträume
6.10 Stottern und Stammeln
7 Teilleistungsstörungen als Folge einer gestörten Informationsverarbeitung
7.1 Entwicklung von Teilleistungsstörungen
7.2 Ursachen von Teilleistungsstörungen
7.3 Folgen für die Entwicklung und das Selbstwertgefühl
7.4 Beispiele von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen, auffälligem Verhalten und Selbstwertproblematik
8 Ängste und ihre Bedeutung
8.1 Angst als Symptom
8.2 Traumatisch bedingte Ängste
8.3 Ängste infolge innerer Verunsicherung
8.4 Der Unterschied zwischen »Angst« und »Furcht«
8.5 Verschiedene Ängste und ihre Ursachen
8.6 Panikattacken
8.7 Schulphobie
8.8 Zwänge und ihre Ursachen
8.9 Therapeutische Strategien bei Ängsten im Kindes- und Jugendalter
Konfrontationstherapie
Ursachenorientierte Verhaltenstherapie
8.10 Angst als Beginn einer psychischen Erkrankung
8.11 Medikamentöse Behandlung
9 Aggressives Verhalten
9.1 Verschiedene Formen der Aggressivität
Aggressivität als positive Eigenschaft
9.2 Beispiele aus der Praxis
9.3 Das limbische System – ein Zentrum der Gefühle
9.4 Die häufigsten neurobiologischen Ursachen für Aggressivität
9.5 Wenn aus einer Verhaltensstörung eine Borderline-Persönlichkeitsstörung wird
9.6 Das Borderline-Syndrom bei Erwachsenen
Borderline – eine Extremform des AD(H)S im Erwachsenenalter?
9.7 AD(H)S-Symptome bei Erwachsenen
9.8 Affektive Störungen
9.9 Vorwiegend soziale Ursachen für aggressives Verhalten
9.10 Der Einfluss der Medien auf die Verhaltensbildung
9.11 Computerspiele können Lernen blockieren
9.12 Mediensüchtig?
10 Kriminelle Laufbahnen verhindern
10.1 Kriminelle Handlungen
10.2 Gesellschaftliche Ursachen
10.3 Maßnahmen zur Verhinderung einer kriminellen Entwicklung
10.4 Sozial angepasste Aggressivität
10.5 Intelligenz und Verhalten
10.6 Widersprüche lösen und Extremverhalten unterbinden
10.7 Verhalten und familiäres Umfeld
10.8 Beispiele aus der Praxis
11 Aggressives Verhalten verhindern
11.1 Die Schule als konfliktbelasteter Bereich
11.2 Welche Schüler sind potenzielle Mobbing-Opfer?
11.3 Teamwork gegen aggressives Verhalten
Die Eltern als Coach
Verhaltenstherapeutische Strategien
11.4 Wichtige Therapiebestandteile
12 Autoaggressive Handlungen
12.1 Ursachen für Selbstverletzungen
12.2 Essen als Mittel zum Stressabbau
Ess-Brech-Sucht oder Bulimie
Frustessen und seine Ursachen
Die Pubertäts-Magersucht (Anorexie)
13 Folgen einer traumatisch erlebten Kindheit
13.1 Umweltfaktoren und Veranlagung
13.2 Diagnostik psychischer Störungen
Familie in Tieren
Der Sceno-Test
Familienbrett
Der Satzergänzungstest
Die Befindlichkeitsskala
Der Zaubertest
14 Therapie von Verhaltensstörungen
14.1 Verhaltenstraining
Beispiele für eine verhaltenstherapeutische Behandlung von Klein- und Vorschulkindern
14.2 Training der Gruppenfähigkeit
14.3 Unterschiede von analytischer, tiefenpsychologischer und psychodynamischer Therapie
Wenn der Missbrauch »missbraucht« wird
14.4 Systemische Therapie
14.5 Verhaltenstherapie
Schwerpunkte der Verhaltenstherapie
14.6 Therapiebegleitende Elternarbeit und was sie bedeutet
15 Aktives Handeln bei Verhaltensstörungen, um ihre möglichen Folgen zu vermeiden
Literaturempfehlungen für Eltern und Therapeuten
Stichwortverzeichnis
Die Autorin
Dr. med. Helga Simchen war zunächst Oberärztin der Kinderklinik und dann wissenschaftlich sowie klinisch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie der Medizinischen Akademie Magdeburg tätig. Dort arbeitete sie in enger Kooperation mit dem Institut für Neurobiologie und Hirnforschung auf dem Gebiet der Aufmerksamkeits-, Lern- und Leistungs- sowie Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. In der ehemaligen DDR galt sie als Spezialistin für die Problematik der hyperaktiven Kinder. Schwerpunkte waren dabei die Früherfassung von Teilleistungsstörungen (z. B. Legasthenie), der Komorbiditäten des Hyperkinetischen Syndroms (HKS) sowie der Tic- und Tourette-Symptomatik. Im Vorstand der Gesellschaft für Rehabilitation war sie über viele Jahre als Arbeitsgruppenleiter tätig. Sie hielt Vorlesungen über Kinder- und Jugendpsychiatrie und Entwicklungsneurologie und hatte einen Lehrauftrag an der Medizinischen Akademie sowie am Institut für Rehabilitationspädagogik. Ihr Arbeitsschwerpunkt waren die neurobiologischen und psychosozialen Ursachen der Aggressivität bei Kindern und Jugendlichen.Helga Simchen hat eine abgeschlossene Ausbildung als Fachärztin für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische Psychotherapie sowie Systemische Familientherapie. Der breite Fundus ihres Wissens und die täglichen Erfahrungen aus ihrer Spezialpraxis für AD(H)S und Teilleistungsstörungen in Mainz verliehen ihr eine besondere Befähigung, über das sehr aktuelle Thema der Ursachen und Folgen von Verhaltensstörungen, deren Diagnostik und Behandlung zu schreiben. Dabei bilden das soziale Umfeld, der Körper und die Psyche der Betroffenen immer eine Einheit, die nur als solche erfolgreich behandelt werden kann.
Helga Simchen
Verunsichert,ängstlich,aggressiv
Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Ursachen und Folgen
2., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
2., überarbeitete Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-044878-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-044879-7epub: ISBN 978-3-17-044880-3
Vorwort zur 1. Auflage
»Meine Kindheit war geprägt von ständiger Enttäuschung über mich und die anderen. Warum konnte ich nicht so sein wie sie? Nach außen war ich stark, keiner sollte meine Unsicherheit merken. Innerlich tobte ein kräftezehrender Kampf zwischen Ängsten, Enttäuschung und Streben nach Anerkennung, der mich bis heute beherrscht.«
An Menschen, denen es so oder ähnlich geht, an Eltern, Lehrer, Therapeuten, Ärzte und alle Interessenten, die über den Zusammenhang von Verhaltensstörungen in der Kindheit und psychischen Problemen im Erwachsenenalter mehr wissen wollen, wendet sich dieses Buch. Es soll über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von auffälligem Verhalten im Kindes- und Jugendalter informieren und sich an Erwachsene wenden, die trotz vieler Therapien noch immer an den Folgen ihrer traumatisch erlebten Kindheit leiden und offen für neue Betrachtungsweisen des Zusammenhanges von Ursachen und Folgen bei Verhaltensstörungen sind.
Hinter Aggressivität und Ängsten verbergen sich meist unbegrenzte Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die täglich gespürten eigenen Grenzen überwinden zu können. Mangel an Anerkennung und Akzeptanz wecken das Gefühl, ein Versager zu sein und nichts zu taugen. Es gibt einen Zusammenhang von veränderter Wahrnehmung, Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und Verhaltensbildung, den dieses Buch vermitteln möchte. Für manchen ist dies eine völlig neue Sichtweise, die erst der technische Fortschritt in den letzten Jahren ermöglichte. Aktuelle neurobiologische Erkenntnisse erlauben eine kausale Behandlung von Verhaltensstörungen im Kindesalter und verhindern damit eine spätere psychische Erkrankung. Für manchen setzt das ein Umdenken voraus, denn Gehirn und Psyche bilden eine Einheit und beeinflussen sich ständig wechselseitig auf biologischer, sozialer und psychischer Ebene.
Ein Kind, das ständig Enttäuschung, Ausgrenzung und Spott erfährt, kann kein Selbstvertrauen entwickeln. Es reagiert verunsichert und wütend auf sich und die anderen. Statt sich auf jeden neuen Tag zu freuen, entwickelt es Ängste und Aggressionen. Es beginnt schließlich seine Umwelt verzerrt und gegen sich gerichtet wahrzunehmen. So gerät dieses Kind in einen Kreislauf, der seine emotionale, kognitive und soziale Entwicklung hemmt. Eine psychisch instabile Persönlichkeit ist die Folge, die sich von allen benachteiligt und ungeliebt fühlt. Ein solches Kind kann seine noch so guten Fähigkeiten nicht ausschöpfen, wenn es keine Hilfe bekommt.
Seine Eltern sind leider viel zu oft mit ähnlichen Problemen aufgewachsen und leiden noch immer an deren Folgen. Um ihrem Kind zu helfen, nehmen sie ihm alle Schwierigkeiten ab und verwöhnen es. Was als positiv empfunden wird, kann für die Entwicklung jedoch sehr negativ sein.
Trotz reichlicher Liebe und Zuwendung von Seiten der Eltern entwickeln einige Kinder Ängste, Aggressionen und andere Verhaltensstörungen. Diese Symptome sind meist nur der Gipfel eines Eisberges, der größte Teil der Problematik verbirgt sich unter der Oberfläche. Wie es im Inneren aussieht, wird von Außenstehenden kaum wahrgenommen.
Bisher wurde vorwiegend nur das sichtbare und deutlich störende Verhalten symptomorientiert behandelt. Noch immer werden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen allein als Folge von Beziehungsstörungen angesehen. Für die Eltern eine Schuldzuweisung, die sie als Fazit ihrer erzieherischen Bemühungen so nicht akzeptieren können und auch nicht sollten. Das trifft auf das Asperger-Syndrom genauso zu wie auf die Borderline-Störung. Beide werden als Beispiele für viele ausführlich beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie durch neue Erkenntnisse über deren Ursachen eine bessere und erfolgreichere Behandlung möglich ist. Mit dem Wissen über die Auswirkung einer angeborenen Regulationsstörung auf die Beziehungsgestaltung in Familie und Schule kann vielen Betroffenen frühzeitig geholfen werden, damit ihre Kindheit nicht mehr von Enttäuschungen geprägt wird, die sie über Ängste oder Aggressionen abreagieren.
Eine als traumatisch erlebte Kindheit hinterlässt irreversible Schäden, die den Erwachsenen sein Leben lang begleiten.
Diese Dynamik, die ich immer wieder bei der Behandlung verhaltenssauffälliger Kinder und deren Eltern erfahren habe, muss durchbrochen werden. Welche Möglichkeiten es dazu gibt und wie verhindert werden kann, dass eine Kindheit zum Trauma wird, darüber soll dieses Buch informieren.
Mainz, im Herbst 2007Dr. med. Helga Simchen
1 Ängstlich und aggressiv als Kind – psychisch krank als Erwachsener
1.1 Die Kindheit prägt unser Verhalten
Die meisten Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensproblemen suchen in ihrem Elternhaus oder in der Schule nach den Ursachen ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst, um ihre über Jahre bestehende Hilflosigkeit zu überwinden. Aus Selbstschutz und zur eigenen psychischen Entlastung richten sie gegen andere in ihrem persönlichen Umfeld Schuldzuweisungen.
Bisher wurde, ausgehend von den Thesen der Psychoanalyse, eine von den Eltern ausgehende Beziehungsstörung als Hauptursache für psychische Auffälligkeiten im Kindesalter angesehen. Die Grundlagen dieser Theorie wurden vor gut 100 Jahren von Sigmund Freud formuliert, dessen Konzept auf dem sog. »Ödipus-Komplex« basiert. Dieser sieht, kurz gesagt, in der Rivalität von Mutter und Tochter um die Zuneigung des Vaters und der Rivalität zwischen Vater und Sohn um die Gunst der Mutter die Ursache für die Entwicklung einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung mit den verschiedensten Folgen. Die aktualisierte Grundidee der Psychoanalyse ist, dass viele psychische Probleme auf unbewussten Konflikten, verdrängten Emotionen und frühen Erfahrungen beruhen, die in der Therapie aufgedeckt und somit behandelt werden.
Die neurobiologisch orientierte Forschung der letzten Jahrzehnte zeigt jedoch immer deutlicher, dass Beziehungsstörungen durch Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen selbst – in Wechselwirkung mit ihrem häufig ebenfalls verhaltensauffälligen Umfeld – entstehen. Dabei beeinflusst die »besondere« Art der Verarbeitung von Wahrnehmungen und Informationen die Entwicklung von Selbstwertgefühl und Sozialverhalten.
Eine meist angeborene Regulationsstörung erschwert es den Kindern von klein auf, den Anforderungen, die an sie gestellt werden und die sie an sich selbst stellen, gerecht zu werden. Die Betroffenen sind durch Überforderung ständigen Enttäuschungen ausgesetzt, sowohl im Leistungs- als auch im sozialen Bereich. Das vorwiegend erfolglose Streben nach gewünschter Veränderung beeinträchtigt ihr Selbstwertgefühl und Verhalten. Das gezeigte Verhalten irritiert Eltern, Geschwister, Freunde, Klassenkameraden und Lehrer, die es sich nicht erklären können und als gegen sich gerichtet deuten. So entsteht ein Kreislauf, der vom betroffenen Kind keinesfalls so gewollt ist, und bei dem es selbst am meisten unter dem Gefühl der Hilflosigkeit und der Isolation leidet.
Häufige Aussagen eines betroffenen Kindes lauten: »Alle sind gegen mich!«, »Niemand versteht mich!« oder »Mich mag sowieso keiner.«
Die Betroffenen entwickeln je nach Veranlagung ängstliche oder aggressive Verhaltensweisen, die ohne Behandlung an Dauer und Intensität zunehmen, bis sie schließlich nicht mehr tolerierbar sind.
1.2 Reaktionen der Umgebung
Durch erzieherische Maßnahmen wie Nichtbeachtung unerwünschter Verhaltensweisen, ständiges Kritisieren, dauerndes Zurechtweisen oder gute Ratschläge (»Strenge dich mehr an!«, »Es geht schon, wenn du dir mehr Mühe gibst!«, »Du kannst es, wenn du willst!« usw.) fühlen sich viele Kinder noch ungerechter behandelt und überhaupt nicht mehr verstanden. Denn ihr Problem ist es gerade, dass ihnen die Änderung des Verhaltens trotz großer Bemühungen ohne Hilfe von außen nicht gelingt.
Manche Kinder reagieren aggressiv, andere mit Rückzug oder mit verschiedenen Ängsten, je nach genetischer Veranlagung und Umwelteinfluss.
Die Ängstlichen geben sich selbst für alles die Schuld, ziehen sich zurück und entwickeln Autoaggressionen. Sie leiden am meisten, was häufig von der Umwelt gar nicht bemerkt wird. Der oberflächliche Betrachter bemerkt wohl ihr introvertiertes Verhalten, ansonsten hinterlassen sie einen angepassten, liebenswerten und unauffälligen Eindruck, solange ihre Fähigkeit zur Kompensation ausreicht. Ist diese erschöpft, führen ihre aufgestauten Emotionen zu unerwartet heftigen Reaktionen, die den Beginn einer schweren psychischen Störung einleiten können.
Die Aggressiven leiden psychisch weniger, sie reagieren ihren Unmut nach außen hin ab. Sie geben für ihr Verhalten als Selbstschutz den anderen die Schuld. Das wird noch durch ihren oberflächlichen Wahrnehmungsstil und durch ihre Fähigkeit, Unangenehmes auszublenden begünstigt. Deshalb können sie über lange Zeit die Reaktionen der Umwelt auf ihr Verhalten besser ignorieren oder verdrängen.
Abb. 1.1:Von den Eltern mitgebrachte Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen, die auf ein Aggressionspotenzial hinweisen
1.3 Dauerstress – Ursachen und Folgen
Aggressivität und Ängste als Folgen einer angeborenen Reifungsstörung mit veränderter Verarbeitung von Wahrnehmungen können Defizite im Leistungs- und Verhaltensbereich verursachen und so über einen langen Leidensweg zum Kindheitstrauma werden. Je schwerer die Störung der Wahrnehmungsverarbeitung ist, umso stärker wird die Entwicklung der Persönlichkeit beeinträchtigt, deren erste Anzeichen immer Verhaltensauffälligkeiten sind. Sie signalisieren den Beginn einer psychischen Störung, deren Ursachen beim Kind selbst oder in seinem sozialen Umfeld liegen. Beide beeinflussen sich gegenseitig und lösen im Körper Stressreaktionen aus. Jede schwere und anhaltende psychische Belastung erzeugt Dauerstress, der wiederum Körper und Psyche noch mehr belastet.
Ständige Enttäuschungen beeinträchtigen das Selbstwertgefühl, verunsichern, verursachen Ängste oder Aggressionen – deren Folge eine psychisch instabile Persönlichkeit mit Dauerstress sein kann. Ein ständig erhöhter Spiegel an Stresshormonen im Blut verringert die Bildung von Serotonin, dem sog. »Wohlfühl- oder Glückshormon«, dessen Mangel wiederum zu Ängsten, Zwängen und Depressionen führt.
1.4 Was tun bei mangelhafter Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung?
»Auffälliges Verhalten« als Folge innerer Verunsicherung kann aber auch bedeuten, dass Kinder und Jugendliche eigentlich anders sein wollen, es aber aus vielerlei Gründen nicht können. Diesem Konflikt sind sie hilflos ausgesetzt und erleben ihn als sehr belastend. Meist können sie ihre Probleme nicht verbalisieren, weil sie diese selbst nicht verstehen. Deshalb sollte auffälliges Verhalten möglichst von Beginn an hinterfragt werden. Dazu muss nicht immer gleich ein Therapeut hinzugezogen werden, sondern die Eltern sollten mit den Lehrern und natürlich mit dem Kind nach den möglichen Ursachen suchen. Eltern und Lehrer sollten ihre Kompetenzen und Möglichkeiten, die Kinder im Leistungs- und Sozialverhalten zu beurteilen oder durch entsprechende Maßnahmen deren Verhalten zu beeinflussen, nutzen. Gelingt das nicht, sollte ein Neuropädiater, ein Kinder- und Jugendpsychiater oder -psychologe die möglichen Ursachen für das veränderte Verhalten erforschen. Es muss immer das Ziel sein, die Ursachen zu beseitigen. Da es aber noch viel zu wenige entwicklungsneurologisch ausgebildete Ärzte und Psychologen gibt, brauchen viele Betroffene eine Anleitung zur Selbsthilfe. Bei der Vielzahl der angebotenen Therapien ist es erforderlich, dass sich die Betroffenen zuerst ausführlich über mögliche Ursachen und deren therapeutische Maßnahmen informieren. Die Selbsthilfegruppen leisten hierbei eine hervorragende Arbeit und sollten neben dem Kinderarzt die ersten Ansprechpartner sein.
1.5 Wann sollte ein Verhaltenstherapeut befragt werden?
Jede Therapie sollte den Betroffenen als Ganzes in seiner bio-psycho-sozialen Einheit sehen und das soziale Umfeld mit einschließen. Bei allen psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten sind die Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und der Leidensdruck der Betroffenen die wichtigsten Parameter für die Schwere der Symptomatik und entscheiden über die Dringlichkeit einer professionellen Hilfe.
Ein gutes Selbstwertgefühl in der Kindheit zu erlangen, ist die wichtigste Voraussetzung für psychische Stabilität im Erwachsenenalter. Das Selbstwertgefühl entwickelt sich in der frühen Kindheit, etwa zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr, und ist später nur noch sehr schwer zu verändern, da es viele Denk- und Verhaltensweisen prägt, die sich dann einschleifen (automatisieren). Die Fähigkeit zur Gefühlssteuerung und somit auch zur Steuerung von aggressivem Verhalten kann sowohl angeboren als auch erworben sein. Entsprechende angeborene Störungen können in den ersten Lebensjahren schon beobachtet und erzieherisch beeinflusst werden.
Es ist immer die Summe verschiedener Störungen, die die Entwicklung des Kindes traumatisch belasten und professionelle Hilfe erfordern. Eine frühzeitige Behandlung kann helfen, Häufigkeit und Schwere von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen zu reduzieren. Hier reicht eine Verhaltenstherapie allein oft nicht aus; eine entwicklungsneurologische und psychiatrische Diagnostik sollte deren Ursachen klären. Dazu dient die Beantwortung folgender Fragen:
Wie ist der Selbstanspruch des Kindes und wie sind seine Möglichkeiten, ihm gerecht zu werden?
Wie ist sein Verhältnis zu seinen Eltern, zur Umwelt und umgekehrt?
Wie ist seine Wahrnehmungsverarbeitung und wie sein Entwicklungsstand?
Wie sehr leidet es und wie auffällig ist sein Verhalten?
Was wurde unternommen und warum blieb es erfolglos?
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Notwendigkeit, die Frühdiagnostik möglichst vielen Kindern zugänglich zu machen. Denn psychische Erkrankungen nehmen immer mehr zu und werden schon als »Epidemie des 21. Jahrhunderts« bezeichnet. Leider werden ihre ersten Symptome, die schon im Kindesalter zu finden sind, als solche bis heute nur unzureichend bewertet oder fehlinterpretiert.
1.6 Jahrzehnt der Verhaltensstörungen
In den USA wurde der Zeitraum von 2000 bis 2010 zum Jahrzehnt der Verhaltensstörungen erklärt, weil sie ständig an Bedeutung zunehmen und ihre gesellschaftlichen Folgen noch immer unterschätzt werden. Folgen von Verhaltensstörungen können sein:
Traumatisierung der Kindheit
negativer Einfluss auf die Schulperspektive
Reiferückstand in der Persönlichkeitsentwicklung
instabile psychische Persönlichkeit mit geringer Belastbarkeit
reaktive Fehlentwicklungen
psychische und psychosomatische Erkrankungen
Suchtpotenzial für Einnahme von legalen und illegalen Drogen
Bildung von Gruppen mit kriminellen Handlungen
Entwicklung von Aggressionen gegen sich selbst (Autoaggressionen) oder gegen andere (Amok-Reaktionen)
Um Verhaltensstörungen mit diesen möglichen Folgen zu verhindern, muss das Verhalten der Kinder hinterfragt werden und es muss ihnen geholfen werden, ihre Gefühle, Wahrnehmungen und Reaktionen besser steuern zu können. Nicht selten ist ihre soziale Wahrnehmung beeinträchtigt durch eine veränderte Verarbeitung sozialer Informationen. So werden z. B. anderen Personen oft feindliche Absichten unterstellt, durch die sich ein aggressives Kind schnell bedroht fühlt. Wenn diese Kinder über weniger alternative Methoden zur Konfliktlösung verfügen, geraten sie schnell in eine Stressreaktion und reagieren sich aggressiv ab. Später bereuen sie dann ihr unkontrolliertes Verhalten oder geben anderen die Schuld dafür.
Verhaltensstörungen sind fast immer multifaktoriell bedingt und gehen oft mit Lernstörungen einher. Sie sollten früh erkannt und behandelt werden. Denn von einer ungestörten psychischen Entwicklung hängt nicht nur der Erfolg der Kinder in Schule und im Beruf ab, sondern sie ist auch die wichtigste Voraussetzung, um später den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Dabei brauchen Kinder Grenzen, sie geben ihnen Sicherheit und Orientierung. Kinder sollten frühzeitig lernen, soziale Normen, die ihnen von ihren Eltern vorgelebt werden, zu akzeptieren.
2 Selbstwertgefühl und Verhalten
»Beobachte dein Kind, wie es sich verhält,und es zeigt dir, wie es sich entwickeln wird.«
2.1 Das Selbstwertgefühl
Mit einem guten Selbstwertgefühl besitzt ein Mensch psychische Stabilität und die Gewissheit, den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Ein gutes Selbstwertgefühl ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern auf ihren Lebensweg mitgeben können und in das viel investiert werden sollte. Als Voraussetzung für eine psychische Stabilität bestimmt es heute mehr denn je den Erfolg in der Schule, im Beruf, in der Bewältigung des ganzen Lebens und ist eine Grundbedingung für psychische Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schreibt dieser psychischen Komponente einen großen Wert in der Definition des Begriffes Gesundheit zu:
»Gesundsein bedeutet nicht nur Freisein von Krankheiten, sondern den Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.«
Das Selbstwertgefühl wird definiert als »ein wohl gefügtes Selbst, in welchem die verschiedenen Selbstaspekte dynamisch zu einer harmonischen Ganzheit organisiert sind« (Kernberg, 1975). Solche Selbstaspekte einer jeden Person sind: Willenskraft, Antrieb, Interesse, Motivation, Anstrengungsbereitschaft, Entscheidungsfähigkeit, Gefühlstiefe sowie die Möglichkeit, die vorhandenen Fähigkeiten optimal anwenden und genießen zu können.
Das Bewusstsein vom eigenen Selbst als eine sich wiederholende positive Erfahrung durch Anerkennung vom sozialen Umfeld und der Zufriedenheit mit eigenen Erfolgen hat einen ungemein großen Stellenwert in der Persönlichkeitsentwicklung.
Abb. 2.1:Kinder zeichnen sich und ihre Familie in Tiergestalt. Den Zeichnungen kann man erste Informationen über deren Selbstwertgefühl entnehmen und darüber, wie das Kind sich und die anderen in seiner Familie wahrnimmt.
Ein schlechtes Selbstwertgefühl mit wenig Selbstvertrauen, anhaltender Verunsicherung, sich wiederholenden Enttäuschungen und psychischen Belastungen kann psychische Störungen verursachen. Diese rangieren nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Platz 2 aller Krankheiten und beginnen fast immer mit Verhaltensauffälligkeiten in der Kindheit. Doch dieser Zusammenhang wird noch zu wenig beachtet. Beginnende psychische Störungen werden oft zu spät diagnostiziert und einzelne Symptome mit den unterschiedlichen therapeutischen Strategien behandelt, ohne nach deren Ursache zu fahnden. Dadurch vergeht kostbare Zeit, weil die Symptome wechseln können, aber deren eigentliche Ursache bleibt unerkannt bestehen.
Die manchmal noch vorherrschende Meinung, dass die Hauptursache für Verhaltensauffälligkeiten eine Beziehungsstörung zu einem oder beiden Elternteilen ist, wird zunehmend durch die Ergebnisse der aktuellen neurobiologischen Forschung widerlegt. Denn Beziehungsstörungen sind meist nicht die Ursache, sondern die Folge des auffälligen Verhaltens des Kindes. Je stärker dieses von der Norm abweicht, umso wahrscheinlicher sind solche Beziehungsstörungen, die sich ungewollt intrafamiliär entwickeln können.
2.2 Kindliches Verhalten
Im Folgenden sollen einige Beispiele aus der Praxis demonstrieren, wie das Kind mit seinem Verhalten Aussagen über seine innere Befindlichkeit und damit über sein Selbstwertgefühl macht.
Andreas, 6 Jahre alt
Andreas ist ein 6-jähriger Junge, der bald eingeschult wird, aber nicht in die Schule gehen möchte. Sich ängstlich an die Mutter klammernd, wird er in die ärztliche Sprechstunde gebracht. Er versteckt sich hinter seiner Mutter, die berichtet, dass seine Kindergärtnerin ihn nicht für schulfähig hält und er selbst immer wieder erklärt, nicht in die Schule gehen zu wollen. In der Sprechstunde lehnt er über mehrere Sitzungen hinweg jede Mitarbeit ab. Auch im Kindergarten, zu Hause und in der Ergotherapie ist Andreas z. B. nicht zum Malen zu bewegen: »Er ist motorisch ungeschickt«, so die Aussage seiner Ergotherapeutin. Mit Fremden spricht er ungern, aber im Kindergarten ist er lebhaft, oft laut und manchmal auch aggressiv. Dort nimmt er eher eine dominante Rolle ein. Mit Kritik oder Zurechtweisungen kann er schlecht umgehen. Er ist sehr sensibel, motzt und läuft häufig weg mit der Bemerkung: »Immer ich!« Zu Hause ist er fast unauffällig und nur fremden Kindern gegenüber sehr zurückhaltend.
Andreas ist sehr wissbegierig, interessiert sich für Tiere und hört gern Geschichten, aber am liebsten spielt er mit seinem Tablet. Dagegen hat er keine Lust zu zeichnen oder zu malen.
Wir beziehen seine ältere Schwester, die sehr gut mit ihm umgehen kann, in die Behandlung mit ein und bitten sie, mit ihrem Bruder zu malen, was ihr auch nach einiger Zeit gelingt. Aus den mitgebrachten Zeichnungen lässt sich eine deutliche Störung in der Fein- und Visuomotorik erkennen. Die weitere Diagnostik ergibt ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit deutlicher Beeinträchtigung in der Wahrnehmungsverarbeitung bei sehr hoher Intelligenz, aber schlechtem Selbstwertgefühl.
Andreas erkennt seine Schwächen, die er auch durch Üben nicht beseitigen kann, und reagiert darauf mit Verweigerung. Die begründet er damit, »dass er in der Schule bestimmt sowieso sitzen bleibt, weil er nicht schreiben kann«. Er hat Schwierigkeiten mit dem Schreiben, hält den Stift mit vier Fingern krampfhaft fest, drückt viel zu sehr auf und führt ihn mit dem Unterarm. Dabei kann er keine Linien einhalten und nach kurzer Zeit schmerzt seine Hand.
Erst eine Behandlung der Ursache, nämlich ein AD(H)S mit ausgeprägter Symptomatik, bessert seine Probleme. Er bekam eine multimodale AD(H)S-Therapie, auch mit Stimulanzien, noch vor der Einschulung. – Inzwischen besucht er mit gutem Selbstbewusstsein die 5. Klasse des Gymnasiums und gehört zu den besten Schülern.
Marcus, 17 Jahre alt
Marcus ist ein 17-jähriger Jugendlicher, der schwarz gekleidet, mit vielen schwarzen Tattoos und einem lila Haarteil in die Praxis kommt. Seine Schulleistungen sind schlecht und zu Hause macht er, was er will. In seiner reichlichen Freizeit hat er sich einer Gruppe »Gleichgesinnter« angeschlossen. Er berichtet über seine Gruppe, dass es »ganz normale Jugendliche und junge Erwachsene« seien, die, wie er, mit sich und der Gesellschaft unzufrieden seien. In der Gruppe würden sie vor allem reden, rauchen und in Maßen Alkohol trinken, aber aggressive oder kriminelle Handlungen ablehnen.
Aus den weiteren Gesprächen ergibt sich, dass Marcus eine Schwäche in Mathematik hat, deshalb keine Zulassung zum Abitur erhielt und das Gymnasium verlassen musste. Danach sah er für sich keine schulische Perspektive mehr. Zu Hause hält man ihn für »faul«, weil er in der Grundschule zwar gut, aber nur sehr langsam rechnen konnte. Niemand versteht sein Versagen in Mathematik und er verliert immer mehr die Lust am Lernen. Anerkennung findet er schließlich in seiner Gruppe, die ihm Struktur und Halt gibt. Hier herrschen feste Regeln, die er bisher nicht kannte. Bei seinen Kumpels gilt er als zuverlässig und klug und er genießt aufgrund seines Wissens und seiner kreativen Ideen das Vertrauen der anderen, die sich oft bei ihm Rat und Hilfe holen. Er bezeichnet sich selbst als den »Sozialhelfer« seiner Gruppe.
Die Untersuchung von Marcus ergibt, dass seine Schwäche in Mathematik nur der »Gipfel« seiner Problematik ist. Marcus hat wenig Selbstvertrauen, reagiert überempfindlich, hat einen hohen Selbstanspruch und eine ausgeprägte Frustrationsintoleranz. Trotz seiner sehr guten Intelligenz hat er keine altersgerechte Einstellung zu Pflichten entwickelt und denkt ausgeprägt nach einem Schwarz-Weiß-Schema (»einmal schlechte Noten – immer schlechte Noten«).
Seine Schwäche in Mathematik als Teilleistungsstörung weist auf eine beeinträchtigende Störung in der Wahrnehmungsverarbeitung hin, die bei ihm AD(H)S-bedingt war. Durch eine entsprechende multimodale Behandlung seiner AD(H)S-bedingten Probleme bei der Verarbeitung von Informationen besuchte er eine Abendschule und konnte nach einem Praktikum eine Fachhochschule absolvieren mit dem Ziel, später in der Mediengestaltung zu arbeiten.
Manuela, 13 Jahre alt
Manuela geht in die 7. Klasse einer Realschule, deren Besuch bei ihr Ängste auslöst. Häufig klagt sie morgens über Bauchschmerzen und Übelkeit, die mittags verschwunden sind. Ihre Schulleistungen sind gut, irgendwelche Probleme sind den Eltern nicht bekannt, jedenfalls spricht sie nicht darüber. Zu ihren Freundinnen bestehen zunehmend weniger Kontakte. Die besorgte Mutter erkundigt sich bei der engsten Freundin, die meint, dass Manuela »so anders geworden sei«, man könne »gar nicht mehr mit ihr sprechen, ohne dass sie gleich alles auf sich bezieht«. Den Lehrern fällt nichts auf – Manuela war schon immer eine sehr ruhige Schülerin. Die Schulpausen verbringt sie mit ihrer Freundin und am Unterricht beteiligt sie sich wenig.
Wegen des Verdachts auf psychosomatische Beschwerden wird Manuela in der ärztlichen Praxis vorgestellt. Sie macht einen selbstbewussten Eindruck und meint, ihr »fehle nichts«, die Beschwerden am Morgen würden »sicher wieder vorübergehen«. »Morgen« könne sie »mit Sicherheit wieder in die Schule gehen«. Dies verspricht sie immer wieder, aber es gelingt ihr nur selten. Nach einigen Diagnostikstunden stellt sich heraus, dass Manuela in der Schule gemobbt wird, weil sie anders reagiert als erwartet, die anderen ihre Unsicherheit spüren und sie sich nicht adäquat verteidigen kann. Sie hatte schon immer Probleme, sich zu behaupten, ärgert sich schnell und reagiert kleinkindhaft. Durch ihr unsicheres und steuerungsschwaches Verhalten verliert sie leicht die Kontrolle über ihr Handeln. Das veranlasst die anderen erst recht, sie zu provozieren, worauf sie wiederum überempfindlich reagiert.
Als Kleinkind wurde Manuela von ihrer Mutter sehr verwöhnt. Seit dem zweiten Schuljahr, in welchem Manuela schon einmal den Schulbesuch verweigerte und als deren Ursache eine »Schulphobie« diagnostiziert und behandelt wurde, bemüht sich ihre Mutter, die Überbehütung durch Anleitung zur Selbständigkeit zu ersetzen.
Die Ursache der jetzigen Problematik mit Schulangst, schlechtem Selbstwertgefühl, unzureichender emotionaler Steuerung und mangelnder sozialer Kompetenz könnte möglicherweise ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität sein.
Jonas, 19 Jahre alt
Jonas, ein begabter 19-jähriger Student, beginnt nach einem sehr guten Abitur ein anspruchsvolles Studium, versagt aber am Ende des ersten Studienjahres in allen Prüfungen, was für ihn und seine Familie eine Katastrophe ist. Er droht, das Studium abzubrechen, da er glaubt, auch die Wiederholungsprüfungen nicht zu schaffen.
In der Schule brauchte Jonas nie viel zusätzlich zu lernen, da er viel aus dem Unterricht im Kopf behalten konnte. Die Schule mit ihrer Struktur formulierte täglich klare Anforderungen, die er ohne Schwierigkeiten erfüllte, was sich auf der Universität schlagartig änderte. Er freundete sich mit einem Mädchen an, dem er seine ganze Zeit widmete, Partys feiern wurde zu seiner Hauptbeschäftigung. Bei seinen Freunden war er aufgrund seiner kreativen und klugen Art beliebt, aber an Lernen dachte er nicht.