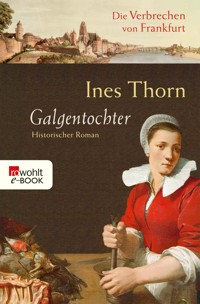9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau und das wilde Meer.
Sylt im 18. Jahrhundert: Die junge Maren lebt als Tochter eines Fischers in Rantum. Ihre Zukunft liegt klar vor ihr: Sie wird Thies Heinen heiraten, mit dem sie aufgewachsen ist. Doch plötzlich hält der mächtigste Mann der Insel um ihre Hand an: Kapitän Rune Boys. Maren wagt das Undenkbare. Sie lehnt ab. Als ihre Familie jedoch nach einem Sturm finanziell ruiniert ist, muss sie ausgerechnet Boys um Hilfe bitten. Er macht ihr einen ungeheuerlichen Vorschlag: Sie soll mit ihm auf Walfang gehen, danach seien alle Schulden beglichen ...
Eine große, schicksalhafte Liebesgeschichte vor historischer Sylt-Kulisse. Von einer Meisterin des historischen Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über Ines Thorn
Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Zuletzt erschienen ihre Romane »Das Mädchen mit den Teufelsaugen«, »Teufelsmond« und »Wolgatöchter«.
Informationen zum Buch
Eine Frau und das wilde Meer
Sylt im 18. Jahrhundert: Die junge Maren lebt als Tochter eines Fischers in Rantum. Ihre Zukunft liegt klar vor ihr: Sie wird Thies Heinen heiraten, mit dem sie aufgewachsen ist. Doch plötzlich hält der mächtigste Mann der Insel um ihre Hand an: Kapitän Rune Boys. Maren wagt das Undenkbare. Sie lehnt ab. Als ihre Familie jedoch nach einem Sturm finanziell ruiniert ist, muss sie ausgerechnet Boys um Hilfe bitten. Er macht ihr einen ungeheuerlichen Vorschlag: Sie soll mit ihm auf Walfang gehen, danach seien alle Schulden beglichen.
Eine große, schicksalhafte Liebesgeschichte vor historischer Sylt-Kulisse. Von einer Meisterin des historischen Romans
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Inhaltsübersicht
Über Ines Thorn
Informationen zum Buch
Newsletter
I. Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
II. Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
III. Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Impressum
Sylt, im Jahre 1764
I. TEIL
Erstes Kapitel
Auf Sylt gab es einen Gott für den Sommer und einen anderen für den Winter: Der Sommergott wurde in der Kirche angebetet und der Allmächtige genannt. Der andere, der Wintergott, war Kapitän Rune Boys, und der stand eben ganz oben auf den Dünen, die Beine in den schweren Lederstiefeln weit auseinander, die Arme im Rücken verschränkt, und betrachtete wohlwollend seine Schäfchen, die eifrig und gebückt auf dem hellen Sandstrand hin und her liefen. Er war ein großer Mann mit einem dichten schwarzen Bart, hellen, beinahe stechenden Augen und Haaren, die mindestens so lang waren wie die vom gekreuzigten Jesus, so wie er in der kleinen Kirche von Rantum hing. Er trug dunkelgraue Hosen aus Hirschleder und seine Seemannsjacke, doch er sah damit keineswegs nur wie irgendein Seemann aus, sondern – groß und stolz wie er war – eben wie der Mann, der im Winter über die gesamte Insel herrschte. Wie Rune Boys zum Wintergott von Sylt wurde, wussten nur noch die alten Leute. Er war schon sehr früh zur See gefahren, gerade einmal elf Jahre war er alt gewesen. Er hatte seinen Vater und seinen Schwager auf einem Walfänger als Schiffsjunge begleitet. Und dann war das Schiff im Eis vor Grönland steckengeblieben, und beinahe die gesamte Mannschaft war verhungert. Nur Rune Boys und seinem Schwager war es gelungen, der eisigen Todesfalle zu entkommen. Es hieß, der Junge hätte dabei seinen Schwager gerettet, doch das ließ sich nicht mehr feststellen, denn der Schwager war nach dem Tod seiner Frau – Rune Boys’ Schwester – ein Jahr später aufs Festland geflohen. Und wieder hieß es, dass die Flucht auf Veranlassung von dem damals zwölfjährigen Rune Boys geschah. Niemand wusste genau, was damals wirklich passiert war – niemand außer einer Frau. Fest stand nur, dass der Schwager nicht freiwillig gegangen war. Aber was immer die Leute auch sprachen, eines war klar: Rune Boys hatte die Insel fest in seiner Hand. Er war zwar nicht der Landvogt, doch sein Wort hatte großes Gewicht. Selbst die Älteren hörten auf das, was er sagte, denn seit seinem Überleben draußen im Eismeer hieß es, er sei von den Göttern begünstigt und habe mehr Kräfte und mehr Grips als jeder andere Mann auf der Insel. Er wusste, was in jedem einzelnen Haus vor sich ging, er sorgte für Recht und Ordnung und wurde aufgrund seines Gerechtigkeitssinnes von allen respektiert und von den Frauen sogar bewundert und verehrt. Trotz der allgemeinen Bewunderung, die er genoss, war er doch ein Einzelgänger, und keiner wusste, wie es in seinem Herzen und in seinem Kopf wirklich aussah. Auch jetzt nicht, wo er auf der Düne thronte und wie Gottvater im Himmel seine Schäfchen betrachtete.
In der Nacht war vor der Insel wieder einmal ein Schiff gesunken, wahrscheinlich ein Hamburger Handelsschiff auf dem Weg nach Norwegen. Die raue See hatte sich einen Teil der Beute geholt und unzählige rote Winteräpfel – wohl aus dem Alten Land bei Hamburg – an den Strand geworfen. Dort lagen sie jetzt, rote Tupfen auf dem hellen Sand, die darauf warteten, gepflückt zu werden. Noch immer war der Himmel bedeckt und grau, bleigrau wie auch das Meer, das die rauschenden Wellen mit den weißen Schaumkronen an den Strand warf, während die sprühende Gischt sich in die Kleider, die Haare und sogar auf den Gesichtern absetzte. Am Himmel kreischten ein paar Möwen, es roch nach Salz und Tang, und darüber war das feine Aroma der zahllosen Äpfel zu riechen.
Es herrschte eine ungewöhnliche Stille unter den zahlreichen gebückten Menschen. Jeder hielt den Blick auf den Sand geheftet, eifrig bemüht, einen Apfel zu schnappen, bevor der Nachbar ihn sich holte. Von oben, von den Dünen, sah es aus, als liefen Ameisen durcheinander, streng darauf bedacht, einander nicht in den Weg zu kommen und doch begierig auf jeden einzelnen Apfel. Die alte Meret, von der es hieß, sie könne mit den Toten reden, schleppte einen halbvollen Sack die hohen Dünen hinauf, das Gesicht vor Anstrengung verzogen. Zwei alte Männer trugen eine schwere Kiepe, die sie alle paar Schritte absetzen mussten. Eine Mutter, den Säugling vor die Brust gebunden, hatte ihren Rock hochgeschlagen bis zu den weißen Schenkeln, um darin die Äpfel zu sammeln. Ein Hund, der niemandem gehörte, stieß mit der Nase eine rote Frucht vor sich her, zwei Jungen füllten ihre Mützen, ein Kleinkind, dass jemand einfach in den nassen Sand gesetzt hatte, versuchte, in einen Apfel zu beißen, und schrie laut auf, als das misslang. Ganze Familien hatten sich zusammengerottet und hoben auf, was ihnen vor die Füße rollte. Sie füllten Schürzen und Körbe, Säcke und Wannen, und manch einer hatte schon den Duft von Bratäpfeln in der Nase. Selbst die uralte, zahnlose Mine, die nicht mehr laufen konnte, war von ihrer Schwiegertochter einfach mitten auf den Strand gesetzt worden. Und nun hockte sie da und versuchte mit einem Stock nach den Früchten zu angeln. Äpfel waren rar auf Sylt. Besonders im Januar. Eine hagere Frau drängte mit der Hüfte eine andere zur Seite, ein junges Mädchen kreischte auf, als ihr ein anderes zuvorkam.
»Da! Sieh! Dort ist noch einer!« Thies Heinen, einer der wenigen Männer, die sich an der Apfeljagd beteiligten, wies Maren auf eine prallrote Frucht hin, die sich ein wenig unter dem Strandhafer verborgen hatte. Maren richtete sich auf, strich sich eine gelöste Strähne aus der Stirn und lächelte Thies an. Wie immer, wenn sie ihn ansah, wurde ihr warm ums Herz. Seit gut einem Jahr gehörten sie zusammen, und es galt für sie längst als abgemacht, dass sie eines Tages heiraten würden. Thies Heinen, der schönste Mann der Insel. Gut, er war nicht reich, doch er war stark und zuverlässig. Seine Brust war so breit wie die eines Aufladers am Hafen, sein Haar blond und immer so, als käme er gerade aus einem Sturm. Die blauen Augen blitzten.
»Was denkst du gerade?«, wollte er nun wissen. »Du siehst so verträumt aus. Muss ich mir Sorgen machen?«
Maren lachte hellauf. »Ist das hier nicht wunderbar?« Sie deutete auf ihren mehr als zur Hälfte gefüllten Weidenkorb. »Das heißt ja nicht, dass wir bis zum Frühjahr nicht hungern müssen, aber eine Hilfe ist das schon. Oh, ich kann jetzt schon den Geschmack von Apfelkuchen auf der Zunge spüren.«
Die meisten Sylter waren bitterarm. Viele Männer fuhren mit klapprigen Booten hinaus zum Heringsfang, doch seit Jahren schon war der Bestand ausgedünnt, und die Fangnetze blieben oft leer. Andere fuhren auf Walfangschiffen bis nach Grönland, doch auch dieses Geschäft war unbeständig, denn der Lohn richtete sich nach der Anzahl der gefangenen Wale. Es kam durchaus vor, dass ein Walfänger mit weniger in der Tasche nach Hause kam, als er losgefahren war, weil nicht jedem Schiff ein Wal vor den Bug kam. Nur die Kapitäne und Offiziere der Walfangschiffe machten stets gutes Geld, selbst wenn ihr Schiff leer in den Hafen zurückkehrte. Viele konnten es sich sogar leisten, gute, mit Reet gedeckte Friesenhäuser zu bauen. Freilich nicht im Dorf Rantum, welches an der schmalsten Stelle der Insel lag und der Witterung und den Naturgewalten ziemlich hilflos ausgeliefert war. Zwischen der Nordsee auf der Westseite und dem Wattenmeer auf der Ostseite Sylts waren es gerade mal eintausend Schritte. Bei Gott, nicht viel. Und nach jedem Sturm fehlte wieder ein Stück. Es gab kaum Wiesen, keine Bäume und schon gar keine Ackerflächen. Nur Dünen, die mit Strandhafer, Sandsegge, Kriechweide, Krähenbeere, mit gelb blühenden Dünenrosen und Seemannstreu bewachsen waren, so dass kein Schaf und schon gar keine Kuh davon satt wurde. In den Dünentälern fand man Glockenheide und seltener auch Lungenenzian, aus dem Heiltränke gemacht wurden. Auch Sanddorn wuchs dort, den die Sylter zu Punsch, Marmelade und Saft verarbeiteten. Ansonsten war die Landschaft karg und nicht gerade mit Farben verwöhnt. Und schon gar nicht im Januar, in dem die Dünenpflanzen nur trübe graue und braune Färbungen aufwiesen.
Die Häuser der Rantumer, zumeist ärmliche Hütten, schmiegten sich an die Wattseite der Dünen, um wenigstens ein bisschen Schutz vor den starken Winden zu haben. Auf den Wäscheleinen flatterten nicht nur Hemden, Hosen und Kleider, sondern immer auch Fischernetze. An den geschützten Hauswänden stapelte sich getrockneter Schafsdung zum Heizen, und in der windstillsten Ecke war ein Beet mit Grünkohl angelegt. Die Häuser waren klein. Neben der Küche mit den Wandbetten gab es noch eine Wohnstube und bei den reicheren Leuten eine »gute Stube«, genannt Pesel, daneben, auf der windgeschützten Westseite und nur durch einen Flur von den Wohnräumen getrennt, befanden sich eine Tenne, die Rauchkammer und ein kleiner Stall.
Die, die hier in Rantum wohnten, waren zumeist Heringsfischer. Außerdem gab es noch eine Schmiede, einen kleinen Laden, in dem man Tran für die Lampen, Seife, Mehl, Bohnen und Erbsen kaufen konnte. Insgesamt bestand das Dorf aus nicht mehr als einer winzigen Kirche und zwanzig Häusern, und nicht eines davon war auch nur halb so prächtig wie ein richtiges Kapitänsfriesenhaus.
Die Kapitäne bauten in Keitum. Dort, wo die Insel schön breit war und man auf den beiden Wattseiten ein paar Schafe halten konnte. Schöne, fette Salzschafe mit weicher Wolle, aus der sich warme Sachen stricken ließen, die wegen des Salzgehaltes sogar der Feuchtigkeit trotzten. Strümpfe für die Fischer und Walfänger, dicke Westen im Winter, gefütterte Jacken und Decken, die selbst dann noch wärmten, wenn das Feuer ausgegangen war. Und Ackerland gab es, weitgehend geschützt vom Meer. Ackerland, auf das man Gerste und Saathafer, Roggen und Pferdebohnen anbauen konnte. Die Leute dort hatten richtige Gemüsegärten, zogen Möhren, Kohl und Rüben, manche hielten sich sogar ein paar Hühner.
In Rantum gab es nur auf der Wattseite ein paar schmale Streifen mit dürrem Gras. Legte ein Wagemutiger doch mal ein Feld an, säte und hegte es, dann kam bestimmt der nächste Sturm, die nächste hohe Flut, und schon waren die Äcker versalzen. Nur das Wattenmeer gab ein bisschen was her. Die jungen Leute wurden ausgeschickt, um Muscheln und Vogeleier zu suchen. Aber auch das ging nicht das ganze Jahr so. Möweneier zum Beispiel wurden ungenießbar, wenn sie angebrütet waren. Manche stellten den Wattläufern, Austernfischern und anderen Vogelarten Fallen, aber nur selten geriet ein Vogel dort hinein, und der Hunger war in den Wintermonaten ein häufiger Gast in den Häusern der Rantumer. Doch nicht nur der Hunger war ein Problem für die Sylter. Es gab auch kein Brennholz, weil keine Bäume auf der Insel wuchsen. Nur Wasser, Sand, Heide und eben die Dünen gab es. Wer es sich leisten konnte, ließ sich Brennholz vom Festland bringen. Doch das waren die wenigsten. Die meisten zogen schon im Frühjahr los, sammelten den Dung der Schafe, trockneten ihn und verbrannten ihn im Winter. An den Gestank konnte man sich schon gewöhnen. Nicht aber an die Verfolger, die meinten, nur weil ihnen die Schafe gehörten, gehörte ihnen auch der Dung. Und auch Obst war selten und überaus kostbar, gab es doch keine Pflaumen- und Quittenbäume, keine Reineclauden- und auch keine Apfelbäume auf Sylt.
Thies, der einen Sack bei sich hatte, den er langsam und bedächtig mit dem Strandgut füllte, nickte. »Heute haben wir Äpfel, und morgen, wenn wir Glück haben, werden Schiffsteile angespült. Gute Planken, Maststücke, Dielen. Dann haben wir auch wieder etwas zum Heizen.«
Maren schüttelte sich. Sie wusste, dass mit den Schiffsteilen die Leichen kamen. Und ebenso gut wusste sie, dass dann wieder alle Rantumer am Strand sein würden. Sie würden über die Toten herfallen, ihnen die Stiefel ausziehen, die Röcke, die Hosen. Sie würden ihnen die Taschen leeren und darauf hoffen, im Jackenfutter ein paar eingenähte Geldstücke zu finden. Sie würden ihnen die Ohrringe ausreißen, würden nach den Seekisten der Schiffer suchen und diese roh aufbrechen. Sie würden die Bibeln darin stehlen, die Tranlampen, das Werkzeug. Und der Strandvogt würde so tun, als merke er davon nichts, und würde erst kommen und die Reste bergen, wenn die Rantumer weg waren.
Maren hasste die Leichenfledderei, aber natürlich beteiligte sie sich daran. Wie alle anderen. Wie sollte man sonst hier auf Sylt durchkommen? Sie bückte sich nach dem roten Apfel, der unter dem Strandhafer lag. Plötzlich wurde sie rüde angerempelt und zur Seite gestoßen. »Pfoten weg! Das ist meiner!« Maren blickte auf. Vor ihr stand Grit Wilms und fixierte sie mit zusammengekniffenen Augen. Das Haar war unter der Haube rausgerutscht und klebte ihr auf den Wangen, welche vor Eifer ganz rot waren. »Ich habe den Apfel zuerst gesehen. Deshalb gehört er mir.«
Maren zuckte mit den Achseln. »Thies hat ihn mir schon vor einer Weile gezeigt. Er ist mein. Aber wenn du ihn unbedingt haben möchtest, bitte. Es gibt ja noch mehr davon.«
Grit Wilms, groß, schlank, mit schmalen, tückischen Augen und Haaren, die die Farbe des nassen Sandes hatten, schon mit leicht verhärmten Zügen um Mund und Nase, schnaubte ein wenig. »Pfft! Thies! Thies! Ich höre immer nur Thies! Wenn ich nur gewollt hätte, so würde er jetzt für mich die schönsten Äpfel sammeln, und du würdest von ihm nicht einmal seinen Hintern sehen.«
»So?« Maren strich ihr Kleid glatt. Das tat sie stets, wenn sie aufgeregt war. Und aufgeregt war sie immer, wenn sie Grit traf. Grit, die ihr seit Jahren das Leben schwermachte. Grit, die nichts und niemand zufriedenstellen konnte und die jedem die Laune verdarb mit ihrer Sauertöpfigkeit. Grit, die Dinge aussprach, die niemand gern hörte, und die bis zuletzt darauf beharrte, recht zu haben. Grit, die so tat, als wäre das ganze Leben eine unendliche Folge von Verzicht, Aufopferung und Mühsal. Ach, Maren hatte sie so satt. Und gerade heute hatte sie wirklich keine Lust, Grits schlechte Stimmung auszuhalten. Barscher als gewollt antwortete sie: »Und warum hast du ihn dir dann nicht genommen? Jeder hat doch sehen können, wie dir bei seinem Anblick das Wasser im Mund zusammenlief. Noch heute ist das so.« Sie musste laut sprechen, denn nur wenige Meter hinter ihr schlug das Meer seine Wellen gegen das Ufer. Gestern Nacht hatte es einen kräftigen Sturm gegeben, keinen Orkan, einen Wintersturm nur, doch das Meer war noch immer aufgewühlt. Über dem ganzen Strand lag eine feine Gischt von aufgeworfenem Wasser, die sich auf Haut und Haare setzte. Wenn Maren sich über die Lippen leckte, dann schmeckten sie salzig. Ein paar Möwen trieben sich über dem Strand herum, begierig auf das, was die Menschen ihnen übrig lassen würden.
Grit hob den Apfel auf, rieb ihn an ihrer Schürze blank und biss triumphierend hinein. »Jeder hier weiß, dass du mir den Thies weggenommen hast.« Sie hob einen Arm und stieß Maren gegen die Schulter.
Maren nahm den Schubs hin und blickte sich nach Thies um. Der bückte sich in einiger Entfernung nach einem weiteren Apfel. »Ich habe ihn dir nicht weggenommen. Und das weißt du, Grit. Auch, wenn er sich einmal beim Maientanz mit dir gedreht hat.« Maren dachte an das Fest vor knapp drei Jahren zurück. Sie war gerade dreizehn gewesen und hatte gesehen, wie Thies und Grit an diesem Abend zusammen gefeiert hatten. Und sie hatte auch gesehen, dass Thies viel zu viel Branntwein getrunken und nur deshalb mit Grit getanzt und sie gar geküsst hatte. Doch das war lange her. Thies war damals mit seinen fünfzehn Jahren noch fast ein Kind gewesen, ein Junge voller Neugier, der alles ausprobieren wollte. Auch die Liebe. Jetzt war er ein Mann.
»So, hast du nicht? Wir waren einander versprochen. Vom Maifest an. Grit und Thies. So hieß es immer und überall. Grit und Thies, Thies und Grit. Aber du hast schon immer gewollt, was andere haben, hast es nicht aushalten können, nicht erwählt zu sein.«
Maren wollte etwas erwidern, doch dann biss sie sich auf die Zunge. Es hatte keinen Zweck, mit Grit zu streiten. Sie hatte nie gehört, dass jemand »Grit und Thies« gesagt hatte, und auch ihre Freunde wussten nichts davon. Doch das war ganz egal. Jetzt zumindest behauptete das Grit, und die wenigsten wagten es, ihr zu widersprechen. Und seit ein paar Monaten hatte Grit sich in den Kopf gesetzt, dass Maren ihr Thies weggenommen hatte. Das war natürlich Unfug, denn Thies und Maren waren Nachbarskinder von klein auf. Und schon früher hatten sich manchmal ihre Mütter nur halb im Spaß ausgemalt, wie es wohl wäre, wenn Thies und Maren einmal heirateten. Aber so weit war es noch nicht.
»Aber jetzt bist du ja verheiratet. Und Thies noch nicht. Außerdem hast du damals einem fünfzehnjährigen Jungen ein Versprechen gegen einen Becher Branntwein abgerungen, dessen Folgen er gar nicht absehen konnte. Eine Kinderei war das, mehr nicht.« Maren wurde langsam ärgerlich. »Thies lacht heute darüber. Und außerdem seid ihr Vetter und Base. Verwandte sollten nicht heiraten, sonst bekommen sie blöde Kinder.« Sie richtete den Blick auf Grits Bauch, der auch nach zwei Jahren Ehe noch immer so flach war wie das Meer bei Windstille.
»Verheiratet bin ich, das stimmt wohl. Aber mit einem Mann, den ich nicht liebe. Mit einem, der an die dreißig Jahre älter ist als ich und einen Buckel hat. Heiraten hab ich ihn müssen, weil der Vater nicht das Brot für uns Kinder auf den Tisch bringen konnte. Es war meine Tochterpflicht. Und Thies und du, ihr könnt lachen, soviel ihr wollt. Kennst du das Sprichwort nicht? Wer zuletzt lacht, lacht am besten.«
Maren zuckte mit den Achseln. »Du hättest den alten Wilms nicht nehmen müssen. Niemand hat dich vor den Altar gezwungen.«
Grit stemmte die Fäuste in die Hüften und beugte den Kopf vor wie ein Huhn, das ein Korn picken will. Ihr Kinn zitterte, und ihre Stimme war vor Wut ganz rau: »Natürlich musste ich den alten Wilms nehmen. Der Thies hätte mich und die meinen doch nicht ernähren können. Der hat ja selbst nichts. Nur eine Mutter und seine verdammte Schwester.«
»Die kranke Mutter und die lahme Antje, meinst du wohl? Die beiden, um die du dich nach der Hochzeit nicht kümmern wolltest, die du nicht am Hals haben wolltest. Viel lieber war dir da der alte Wilms, der nichts von dir verlangt, aber dir gibt, soviel er kann. So ist es doch.« Maren wusste ganz genau, dass Grit nicht faul war. Es war üblich auf Sylt, dass sich die jungen Leute um ihre alten Eltern kümmerten, und Grit hätte sich ganz sicher neben ihren Eltern auch um Antje und Thies’ Mutter gekümmert. Doch sie hatte die ständigen Vorwürfe so satt! Es wurde wirklich Zeit, dass Grit mal jemand den Mund stopfte. Und im Augenblick sah es ganz so aus, als hätten Marens Worte gewirkt. Tränen glitzerten in Grits Augen, und sie sah aus, als wären alle sieben biblischen Plagen nur ihr allein zugestoßen. Die Mundwinkel hingen nach unten, der magere Busen bebte.
»Aber wenn du nicht wärst, dann könnte ich den Thies heiraten, sobald der alte Wilms ins Gras gebissen hat. Dann könnten wir von dem leben, was der Wilms mir hinterlässt.« Der letzte Satz kam nicht großspurig wie sonst, sondern leise und beinahe bittend, und obgleich Grits Kleid keines nach der neuesten Festlandmode war und der alte Wilms nie auch nur eine Runde Branntwein in der Schänke ausgab, so hieß es doch, er habe einiges unter dem Kopfkissen.
Maren lachte. Herzlos und laut. Sie warf den Kopf in den Nacken und breitete die Arme aus. »Noch lebt dein Mann. Und noch ist der Thies zu haben. Samt Mutter und Schwester, denn wir sind einander nicht versprochen. Nicht offiziell zumindest. Aber der Wilms muss sich mit dem Sterben schon ein bisschen beeilen, denn zum Biike-Brennen werde ich mit dem Thies gehen.«
Dann nahm Maren ihre Kiepe, ließ Grit einfach stehen und lief zu Thies, der ihr weiter half, Äpfel aufzusammeln. Aus einiger Entfernung warf sie ihr noch einen Blick zu, der eine Mischung aus Mitleid und Triumph war. »Hast du gehört, was die Grit gesagt hat?«, wollte Maren wissen. »Dass ihr beide zusammengehört seit dem Maifest? Und dass sie dich heiraten will, sobald der alte Wilms gestorben ist?« Wieder lachte sie, hoffte, Thies würde einstimmen in ihr Gelächter, aber er schüttelte nur den Kopf und blickte Grit nachdenklich hinterher. »Lass sie doch. Sie hat es nicht gerade leicht. Und gute Seiten hat sie auch.« Gern hätte Maren widersprochen, doch ihr Blick fiel auf Kapitän Boys, der noch immer hoch oben auf den Dünen stand und ihr zulächelte. Auf der Stelle fühlte Maren sich, als wäre sie bei etwas Unrechtem ertappt worden. Hoffentlich, dachte sie, hat er das Gespräch zwischen Grit und mir nicht belauscht. Eigentlich war dieser Gedanke absurd, denn das Meer spie nach wie vor mit großer Kraft seine Wellen ans Ufer. Doch Kapitän Boys war der Gott von Sylt. Er konnte alles hören, was auf der Insel auch nur geflüstert wurde, wenn er es denn wollte. Doch umgekehrt war das nicht der Fall. Und so hörte Maren nicht, was der Kapitän zu sich selbst sagte: »So ist es recht, meine Kleine«, murmelte er. »Genau so will ich dich haben.«
Zweites Kapitel
Kapitän Rune Boys stand im Kööv, dem Alltagswohnraum seines Hauses, und blickte aus dem Fenster zum Himmel, der grau, aber aufgelockert über der Insel hing. Der Wind blies aus südwestlicher Richtung, das hieß, dass es heute wohl trocken bleiben würde. Vielleicht würde die Wolkendecke auch ganz aufreißen, und die Sonne könnte die letzten Schneereste in leuchtendes Geschmeide verwandeln. Boys war normalerweise nicht so romantisch gestimmt, und Schnee konnte er schon gar nicht leiden, denn wenn er vor Grönland nach Walen fischte, war er meist von Eis und Schnee umgeben. Aber heute war ein besonderer Tag. Er trug seine Kapitänsuniform, obgleich er an Land war. Heute Abend war ein besonderer Abend. Heute wurde das Biike-Feuer abgebrannt, heute wurde dem Winter eingeheizt und heute würde er das tun, worauf er seit Jahren wartete. Er fuhr mit einem Polierlappen über die goldglänzenden Messingknöpfe und dachte an das, was er vorhatte. Auf See hatte er verlernt, an Gott zu glauben. Sonst hätte er vielleicht um Beistand gebetet. Er glaubte auch nicht an Wotan, den heidnischen Gott des Meeres und des Sturmes, wie es auf Sylt so mancher noch im Geheimen tat. Und deshalb glaubte er auch nicht an die reinigende Kraft des Biike-Feuers, nicht daran, dass mit dem Biike-Brennen der Winter vertrieben und Wotan Ehre erwiesen werden sollte. Er glaubte sehr wohl aber an den Thing, den Gerichtstag, der morgen abgehalten werden sollte, bevor die Walfänger sich auf den Weg nach Hamburg oder Amsterdam begaben. Viel würde morgen nicht verhandelt werden. Ein paar unersättliche Strandräuber, angezeigt vom Strandvogt, würden Federn lassen müssen. Die alte Meret, von der es hieß, sie könne mit den Toten reden und die – da war sich Rune Boys ganz sicher – noch immer an die alten Götter glaubte und ihnen bestimmt sogar Opfer darbrachte, würde wieder einmal der Hexerei angeklagt werden, doch mit einer Strafe hatte sie nicht zu rechnen. Auf Sylt hielten die Leute zusammen, und solange Meret niemandem etwas antat, würde auch ihr niemand etwas antun. Aber es gab da noch etwas, das verhandelt werden könnte. Oder sogar musste. Nur wusste niemand davon. Niemand, außer Rune Boys und einem anderen Bewohner der Insel. Und er würde sich hüten, sein Geheimnis vor den Thing zu bringen. Zumindest jetzt nicht. Der Kapitän war ein kluger und geduldiger Mann. Er wusste genau, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem er das Geheimnis offenbaren sollte. Doch jetzt war es noch nicht soweit.
Er bückte sich, tunkte den Lappen in Walfischtran und polierte damit seine Stiefel. Dabei pfiff er ein Lied. Als er damit fertig war, sah er sich in diesem schönsten Zimmer des ganzen Hauses um. Er war stolz auf das, was er sich geschaffen hatte: Das große Zimmer hatte einen wunderbaren Ofen und war ganz und gar mit Delfter Kacheln bestückt. Um einen großen Tisch aus Kirschbaumholz standen sechs Hochlehnstühle, deren Sitze mit Leder gepolstert waren. Eine Anrichte barg wunderschöne Stücke, die Boys von seinen Reisen mitgebracht hatte: eine Meerschaumpfeife mit Porzellankopf, Geschirr aus China, ein Messer vom Mittelmeer, Schalen aus Olivenholz, Kannen und Dosen aus Silber, funkelnde Leuchter und eine in rotes Safranleder gebundene Bibel. Der Boden war mit rötlichen Dielen belegt, darauf ein paar Teppiche, die Boys in Amsterdam von einem Händler aus dem Orient gekauft hatte. Eine mannshohe Standuhr mit prächtigen Schnitzereien und vergoldeten Zeigern schlug jede Stunde. Unter den Fenstern standen breite, schön bemalte Truhen, die mit Fellen und Kissen belegt waren. Und in einer Ecke befand sich ein Schreibtisch, der so groß war, dass Kapitän Boys bequem daran sitzen konnte. Der Sekretär, ein englisches Möbel, glänzte frisch poliert, und in den vielen Schubfächern befanden sich weitere Schätze und Geldstücke aus aller Herren Länder. Auf dem Tisch reihten sich mehrere Tintenfässer aneinander, eines davon aus purem Silber, und ein Ständer mit gut gespitzten Gänsefedern stand daneben. Über dem Schreibtisch hing eine Seekarte, auf der Boys mit Tinte alle Routen markiert hatte, die er schon gefahren war. Vor den Fenstern bauschten sich gefütterte Vorhänge aus festem grünem Wollstoff, die im Winter den Wind abhalten sollten. Ja, Kapitän Boys hatte wirklich ein schönes, gemütliches Heim, in dem es nach Bienenwachskerzen und Lavendelsäckchen roch. Ein Heim wie gemacht für eine Familie. Zufrieden pfiff er ein neues Liedchen, das von einem Seemann erzählte, auf den die Liebste wartet.
Die Magd in der Küche zog verwundert die Augenbrauen hoch. Der Kapitän pfiff. Das tat er selten. Aber wenn er es tat, dann konnte man sich auf eine Überraschung gefasst machen.
Den ganzen Tag schon hatte Maren ein merkwürdiges Gefühl im Magen. Als ob Ameisen darin herumkribbelten. Und das Kribbeln machte sie fahrig. Nach dem üblichen Frühstück, Grütze mit Dünnbier, ließ sie einen Teller fallen, dann blieb sie mit der Schürze an der Türklinke hängen und riss sich ein Loch hinein, und zu guter Letzt stach sie sich noch mit der Nadel in den Finger, als sie das Loch stopfen wollte.
»Kind, was ist denn los mit dir?« Finja Lürsen betrachtete ihre Tochter mit leisem Argwohn. »Du bist doch sonst nicht so schusselig.«
Maren lachte auf, dann steckte sie sich den blutenden Finger in den Mund, lutschte das Blut ab und erwiderte: »Heute Abend brennt das Biike-Feuer. Der höchste Festtag auf Sylt. Die ganze Insel ist aufgeregt. Wie kann ich da ruhig bleiben?«
»Das Biike-Feuer regt dich auf. So, so.« Finja warf einen Blick zu ihrem Mann, doch Klaas Lürsen stopfte seine Seemannspfeife und tat, als ob er nichts gehört hätte. »Weißt du was, was ich nicht weiß?«, wollte sie von ihm wissen. Aber Klaas sog an seiner Pfeife, stieß eine gewaltige Rauchwolke aus und lächelte, so dass sich um seine Augen ein feiner Kranz bildete. »Über das Biike-Feuer weiß ich genauso viel wie du.«
»Du weißt genau, was ich meine.«
Klaas warf einen Blick auf seine Tochter, und Finja verstand den Wink. »Maren, geh bitte und ernte den letzten Grünkohl, damit wir morgen für das traditionelle Grünkohlessen einen vollen Topf haben.«
Maren, noch immer den Finger im Mund, nickte und erhob sich, dann verließ sie die warme Küche und begab sich in den winzigen Garten. In jedem Frühjahr holte Klaas eine ganze Wagenladung mit Erde aus dem Nachbarort, schüttete sie auf, so dass die Mutter darin etwas pflanzen konnte. Wenigstens Grünkohl. Ansonsten bestand der Boden am Fuß der Düne aus Sand, auf dem nichts wuchs außer ein paar struppigen blattlosen niedrigen Sträuchern und kratzigem Heidekraut.
Kaum war die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen, wollte Finja wissen: »Also, was hast du im Wirtshaus gehört? Wer wird sich heute zu wem bekennen? Welches Mädchen wird morgen früh verlobt sein?«
Wieder stieß Klaas eine dicke Rauchwolke aus. Er war ein schweigsamer Mann, so wie die meisten Inselfriesen. Schließlich sagte er: »Der Kapitän will heiraten, heißt es.«
Es gab viele Kapitäne auf Sylt. Unter den knapp dreitausend Einwohnern waren es gute achtzig. Aber Finja wusste sofort, welcher Kapitän gemeint war, denn es gab nur einen, der beinahe mehr Macht und Einfluss auf die Insulaner hatte als Gott. Niemand wusste mehr, wieso Boys eine solche Macht auf Sylt hatte, aber alle waren sich einig, dass er es sein musste, der hier den Ton angab. Doch wenn Finja so recht darüber nachdachte, dann kannte ihn eigentlich keiner wirklich. Er lebte zurückgezogen. Zwar hieß es von ihm, dass er in jedem Hafen ein Liebchen haben sollte, doch hier auf der Insel hatte er sich bisher keiner genähert. Er war ein gutaussehender Mann, aber auf eine ganz andere Art als Thies. Während Thies feinfühlig, verständnisvoll und manchmal sogar ein wenig wankelmütig war, schien Boys wild, eigensinnig und ungezähmt. Jeder hier konnte sich gut vorstellen, was geschah, wenn er seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Sein Kinn wurde dann ganz kantig, und seine eigentlich rauchgrauen Augen konnten sich vor Ärger verdunkeln, so dass sie beinahe schwarz wirkten. Sein ausgeprägter Amorbogen zwischen Nase und Mitte der Oberlippe verhieß den Frauen unendliche Freuden. So sagten jedenfalls die Alten hinter seinem Rücken. Maren hatte gehört, wie die alte Meret ihre Mutter Finja darauf aufmerksam gemacht hatte. »Unser Kapitän ist ein echtes Mannsbild. Noch jung und ungezähmt, seine Frau wird es am Tag nicht gut haben, aber in der Nacht für alles entschädigt werden.«
Die Alte hatte ein wenig gekichert, und Finja stieg eine zarte Röte in die Wangen. »Ach was«, sagte sie. »Als ob eine Furche zwischen Nasen- und Oberlippenmitte so etwas bewirken könnte.« Und Meret hatte sie angesehen. »Schon einmal gab es einen auf der Insel, der trug dieses Liebeszeichen auch im Gesicht. Und ich denke, auch du kannst dich noch gut an ihn erinnern.« Finjas Wangen wurden noch ein wenig röter. »Das ist alles schon lange her«, sagte sie leise. »Niemand denkt mehr daran, keiner will sich mehr daran erinnern.« Maren hatte diese Worte, die aus der Waschküche des kleinen Friesenhauses kamen, gehört und zugleich gewusst, dass sie nicht für sie bestimmt waren.
Maren mochte Boys nicht. Allerdings hätte sie nicht sagen können, warum das so war. Manchmal hatte sie das Gefühl, er könne direkt in ihren Kopf hineinsehen und alle ihre Gedanken und Gefühle lesen. Gedanken, die sie selbst im Schutze der Nacht nicht zu Ende denken konnte. Gefühle, die sie schamrot werden ließen. Ja, Maren glaubte wahrhaftig, dass Kapitän Boys in die Menschen hineinblicken konnte. Und das machte ihr Angst. Zumal er selbst nur wenig über sich zu erkennen gab. Und doch wusste er alles, was auf der Insel vor sich ging. Nichts blieb ihm verborgen: keine heimliche Liebelei, kein handfester Streit unter Nachbarn, kein noch so kleiner Diebstahl. Und wenn es jemanden ganz übel erwischte, so half Kapitän Boys, ohne auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren. Ja, dachte Maren, er führt sich auf, als ob die ganze Insel ihm gehörte. Die Insel und vor allem auch die Insulaner.
Und doch musste sie immer wieder zu ihm sehen, wenn sie ihn bei einem Fest oder in der Kirche traf. Er war so dunkel, so geheimnisvoll, und hinter seinem Rücken erzählten die Walfänger von seinen Heldentaten auf hoher See vor Grönland. Es hieß, er sei der Kapitän, der die meisten Wale zur Strecke bringe. Er war der, der sich mit seinem Schiff in Gewässer traute, die die anderen mieden. Er schonte weder seine Männer noch sich selbst. Und war er im Hafen von Amsterdam oder Hamburg, dann konnte er Unmengen an Branntwein schlucken, ohne auch nur ein wenig zu lallen oder zu torkeln. Es wurde viel erzählt über Boys, nur die Männer, die mit ihm auf See gewesen waren, schwiegen und lächelten, wenn die Rede auf ihn kam.
»Wen will er heiraten, der Rune Boys?«, fragte Finja.
Klaas zuckte mit den Achseln. »Manche sagen so und andere so.«
Finja, die allmählich die Geduld verlor, setzte sich zu ihrem Mann auf die Küchenbank. »Wer sagt was, will ich wissen.« Im Grunde glaubte sie nicht, was ihr Mann ihr da erzählte. Rune Boys und eine Frau! Unvorstellbar. Warum sollte ein Mann, der einfach jede hier auf Sylt und in den Häfen haben konnte, sich festlegen? Er war zwar schon um die dreißig, doch eine Ehe mit Kindern und Heim und Herd passte einfach nicht zu ihm. Er war immer ein Abenteurer gewesen. Ebenso zu Hause auf den Meeren und den Häfen der Welt wie auf Sylt. Oder war er ruhiger geworden? Bereit, einen Hausstand zu gründen? Finja hatte viele Mädchen gesehen, die geweint hatten, weil er ihnen nicht das gab, was sie wollten. »Ich bin nicht gemacht für die Ehe«, hatte er jeder beschieden, die ihm nahegekommen war. Und jetzt wollte er tatsächlich heiraten?
»Viel weiß ich nicht. Auf eine aus Rantum hat er es abgesehen, heißt es.«
Finja zog die Augenbrauen hoch. »Aus unserem Dorf? So viele Mädchen zum Heiraten gibt es hier nicht. Warum nimmt er sich keine aus Keitum? Dort, wo die Kapitänstöchter hausen?«
Klaas zuckte schweigend mit den Schultern, und in diesem Augenblick kam auch schon Maren zurück, die Wangen rot vom Wind, die Arme voller Grünkohl. Draußen war Geschrei zu hören, und Finja, froh über die Ablenkung, eilte zum Fenster, um zu sehen, was dort los war. Eine Gruppe halbwüchsiger Jungen zog einen Holzkarren, bis zum Rand mit Holz beladen, den höchsten Dünenhügel hinauf. Zwei andere näherten sich ihrer Haustür. Finja wandte sich um. »Hast du was für das Feuer?«
Es war nicht nur üblich auf Sylt, etwas zum großen Biike-Feuer dazuzugeben, es war eine heilige Pflicht, heiliger sogar als die jährliche Weihnachtsspende für die Seemannswitwen und -waisen. Insbesondere, da Holz auf der Insel so knapp war. Deshalb sammelten die Sylter schon vier Wochen vorher Treibholz, das an den Strand gespült worden war. Sie durchstöberten ihre Scheunen und Ställe nach losen Brettern, und wer gar nichts hatte, der gab wenigstens ein paar Bündel Stroh oder Lumpen. Als die Jungen klopften, ging Klaas mit ihnen in den westlichen Teil des Hauses, der als Stall und Vorratskammer, als Scheune und Räucherei diente, und übergab ihnen einige lose Schiffsplanken. »Habt ihr vielleicht auch noch ein Kännchen Tran oder Öl, damit unser Rantumer Biike-Feuer am höchsten und längsten lodert?«, wollte der kleine Hauke wissen, dessen Vater in den nächsten Tagen als Schiffsoffizier nach Hamburg aufbrechen würde.
Klaas sog wieder an seiner Pfeife. »Was denkst du denn, Junge? Ich bin Heringsfischer. Tran ist bei mir nicht zu holen. Gehe zu denen, die auf Walfang waren.« Dann reichte er ihnen aber doch ein Kännchen mit Rapsöl. »Und wehe, wenn du etwas davon verschüttest.« Er sah den Jungen nach, bestieg dann selbst die Düne, an deren Kante sich sein kleines Haus schmiegte, und blickte nach dem gegenüberliegenden größeren Hügel, auf dem das Feuer errichtet wurde. Es war eine komplizierte Maßnahme, an der alle jungen Männer des Dorfes beteiligt waren, während die alten danebenstanden und gute Ratschläge erteilten. Klaas lächelte vor sich hin, als die alte Meret zu ihm stieß, in der Hand ein Büschel getrockneten Tang.
»Weißt du noch, als du ein kleiner Junge warst?«, fragte sie und blickte dabei nach dem Holzhaufen hin. »Damals hast du auch noch an die alten Götter geglaubt. Und jetzt, Klaas Lürsen, woran glaubst du jetzt?«
Klaas antwortete nicht, aber Meret schien auch gar keine Antwort erwartet zu haben. Eben wurde drüben auf dem Hügel unter großem Gejohle die Strohpuppe, die den Winter symbolisieren sollte, auf einen Pfahl in der Mitte des Holzhaufens gesteckt.
»Wer denkt heute noch an die alten Bräuche?«, fragte Meret weiter. »Wer von den jungen Leuten weiß noch, dass das Feuer dem großen Gott Wotan zu Ehren entzündet wurde. Der Winter sollte vertrieben und der Frühling geweckt werden. Und dann, dann springt sie über die heiligen Flammen, die törichte Jugend, weil sie glaubt, so Gesundheit und Liebe zu erlangen.« Meret kicherte ein wenig. »Denkst du noch manchmal dran, Klaas, wie du früher gesprungen bist? Um die Finja bist du gesprungen. Weiter und höher als alle anderen. Und du hast sie gekriegt. Aber gedankt hast du Wotan nicht dafür.«
»Wenn er so mächtig ist, wie du sagst, dann braucht er meinen Dank nicht.«
Die alte Meret fuhr bei diesen Worten zurück. Sie hob den Finger. »Versündige dich nicht, Klaas Lürsen. Es gibt ein Unglück, wenn man Wotan nicht gibt, was ihm zusteht.«
Kaum hatte Klaas das Haus verlassen, eilte Finja von der Küche in den Pesel. Dort, in der guten Stube, stand ihre frühere Aussteuertruhe. Ihr Vater hatte sie ihr gezimmert, und er hatte ein geheimes Fach in die Truhe gebaut. »Jedes Mädchen hat dann und wann ein Geheimnis«, hatte er gesagt, die Truhe angekippt und ihr den doppelten Boden darin gezeigt. Im Allgemeinen hatte Finja keine Geheimnisse vor Klaas. Nur eines gab es, das er nicht wusste, das er niemals erfahren durfte. Sie öffnete den doppelten Boden und holte aus dem Spalt ein kleines Holzkästchen hervor, das mit Samt überzogen war. Auf dem Deckel prangten das Siegel eines Sylter Hauses und dessen Hausname: »Ran Hüüs« – Haus der nordischen Meeresgöttin Ran. Und in dem Kästchen lagen ein Siegelring mit der Göttin Ran und ein großer schwerer Goldanhänger, der ebenfalls die Meeresgöttin zeigte. Sie betrachtete aufmerksam die Dinge, wog sie in der Hand und seufzte dann. Eine dunkle Ahnung stieg in ihr auf, eine Ahnung, die sie seit Jahren begleitete, und immer, wenn Finja dachte, sie sei verschwunden, tauchte sie wieder auf. Finja drückte das Gold an ihre Brust und seufzte wieder. Dann sprach sie ein stilles, aber inbrünstiges Gebet und versteckte die Dinge wieder im doppelten Boden ihrer Truhe.
Maren hatte ihre Festtagstracht angezogen, den weißen knielangen Rock, die roten Strümpfe, das rote Brustband und darüber eine dicke, warme Weste aus dem Fell junger Seehunde. Sie hatte ihr helles Haar so lange gebürstet, bis es glänzte, hatte es zu einem dicken Zopf geflochten, ja, sie hatte sich sogar ein wenig Rote-Bete-Saft auf die Wangen und die Lippen gerieben. Klaas verzog den Mund, als er das sah: »Was soll das, Maren? Du gehst nicht zum Brauttanz.«
Maren kicherte. »Vielleicht doch.«
Jetzt ergriff Finja das Wort: »Was hast du vor?« Sie hatte den Kopf schräggelegt und blickte Maren streng an. »Du bist sechzehn Jahre alt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen.« Sie hatte energisch gesprochen, doch Maren lächelte weiter.
»Andere in meinem Alter sind schon verheiratet. Sieh dir nur die Grit an. Seit zwei Jahren schon teilt sie das Bett mit dem alten Wilms.«
»Du nicht. Du hast Zeit. Außerdem bist du um zwei Jahre jünger als Grit.« Selten sprach Finja so streng, konnte sie doch Maren nie einen Wunsch abschlagen.
Selbst Klaas war überrascht. »Lass, Finja, sie ist zwar noch jung, aber dumm ist sie nicht. Denk an das Sprichwort: ›Jung gefreit hat nie gereut.‹« Er verzog den Mund zu einem Lächeln. »Denk nur daran, wie alt du gewesen bist.«
Finja blickte Maren so an, als hätte sie sie zuvor noch nie gesehen, dann schüttelte sie den Kopf. »Kind, du hast ja keine Ahnung, was du tust. Ich weiß, dass du uns für alt hältst, hoffnungslos hinterher hinter den neuen Zeiten. Und doch sage ich dir: Lass dir Zeit mit den Männern. Schon manch eine ist viel zu früh in ihr Unglück gestapft.«
Maren schluckte. Die Worte ihrer Mutter hatten sie verunsichert. Nein, es waren weniger die Worte als vielmehr der Ton. Finja war eine sanfte Frau. Eine, die Mann und Kind nicht beherrschen wollte. Doch jetzt zeigte ihr Gesicht eine verbissene Strenge.
»Aber ich werde mit Thies zum Feuer gehen«, erklärte Maren.
»Du gehst mit uns«, befahl die Mutter. »Du kennst die Bräuche. Erst wenn du verlobt bist, kannst du mit dem Liebsten zum Biike-Brennen gehen. Und soviel ich weiß, bist du noch nicht verlobt. Wenn du nicht mit uns gehen willst, so musst du zu Hause bleiben. Und jetzt ziehe dich an, wenn du mit möchtest. Die anderen haben sich schon alle auf den Weg gemacht.«
Maren schaute bestürzt zum Vater. Sie hatte es sich so schön vorgestellt, Hand in Hand mit Thies auf die Düne zu klettern. So, dass alle es sehen konnten. So, dass vor allem Grit sie beide zusammen sehen konnte. Und nun würde sie hinter ihren Eltern hertraben wie ein Kleinkind. Aber Finja und Klaas würden noch sehen, dass sie längst erwachsen war. Bereit, das Leben einer erwachsenen Frau zu führen.
Missmutig stapfte Maren wenig später in einer Reihe mit den Ottensens, den Lorenzens, den Thakens, den Hennings, den Bohns und den anderen Rantumer Familien die Düne hinauf. Den ganzen Tag über war ein feiner Nieselregen über die Insel gezogen und hatte den Sand fest wie Stein gebacken. Jetzt aber hatte der Regen aufgehört, und die Dämmerung wusch die wenigen Farben der winterlichen Insel zu einem immer dunkler werdenden Grau aus. Es war ein Tag, an dem man am liebsten hinter dem Ofen hocken wollte, doch so feucht und kalt es auch war, jeder hier zog hinauf auf die Düne. Klaas lief langsam, musste hin und wieder ausruhen, denn das Gliederreißen machte ihm heute besonders zu schaffen. Die Kleine von den Ottensens hustete so stark, dass man es schier in ihrer Brust rasseln hören konnte, und der alten Frau Thaken hatte man einen heißen Stein vor den Bauch gebunden, damit sie nicht fror. Die Vorfreude auf das Fest brach sich in Gelächter, hin und her gerufenen Scherzworten, Liedfetzen und einem allgemeinen Gemurmel und Getuschel Bahn. Den ganzen Winter hatten die Sylter in ihren Häusern gehockt, hatten den schweren Stürmen und der bitteren Kälte getrotzt, doch jetzt war es an der Zeit, den Frühling zu rufen.
Alle hatten sich in ihre besten Kleider geworfen. Die Haare glänzten vom vielen Bürsten, die Wangen leuchteten rot vor Vorfreude, und die Augen blitzten. Sämtliche Schuhe waren auf Hochglanz poliert, die Kleider repariert und ausgebürstet, und an den Hälsen und Händen der Frauen schimmerte alles, was sie an Schmuck besaßen. Die Frauen trugen ihre frisch gelüfteten Trachten, doch keine trug sie so hochnäsig wie Grit. Und sie hatte auch allen Grund dazu, denn nur an ihrer Tracht klimperten ein paar echte Goldstücke, die im Lichte der mitgebrachten Fackeln leuchteten. Nacheinander liefen sie wie die Gänse den schmalen Dünenpfad hinauf, reckten schon vorher die Hälse, um auch wirklich jeden kleinen Augenblick des Festes zu genießen. Unter Marens Schritten knirschte leise der Sand. Die Kinder plapperten aufgeregt und zerrten ihre Eltern vorwärts, und selbst die Alten, die kaum noch laufen konnten, hockten auf den Schultern ihrer starken Söhne und wurden den Hügel hinaufgetragen.
Kurz vor dem Dünenkamm stieß Thies zu ihnen. Maren fasste nach seiner Hand und warf ihrer Mutter einen triumphierenden Blick zu, und gemeinsam erkletterten sie die Dünen, kamen beinahe als Letzte. Der Platz auf dem Kamm war mit Menschen gefüllt. Auf einem alten Rost brieten zwei Fischer ein paar Heringe, über einer Tonne wurde gewürzter Wein erhitzt. Die Rantumer standen in Grüppchen beieinander, und immer wieder hallte ein Lachen durch die Dunkelheit. Maren fand, dass die Stimmung so war wie in der Kirche am Weihnachtstag. Noch war nichts Aufregendes geschehen, doch die Luft flimmerte und flirrte vor Spannung. Thies fest bei der Hand haltend, blickte Maren zu Grit, deren Rock zwar mit Goldstücken besetzt war, ihr Gesicht aber leuchtete nicht das geringste bisschen. Wütend sah sie zu Maren und Thies, dann warf sie den Kopf hochmütig in den Nacken und drehte sich weg.
Die Rantumer umstellten den mannshohen unangezündeten Feuerstapel, als endlich alle Bewohner des Ortes auf dem Kamm versammelt waren. Eine feierliche, fast heilige Stille lag jetzt über dem Hügel. Nur die Kinder, bunte Laternen oder Fackeln in den Händen, lachten und trippelten unruhig hin und her, einige Männer schwangen brennende Strohbunde. Der Brauch wollte es, dass nun Boys einen Schritt auf das Feuer zutrat, aber da schritt die alte Meret aus dem Kreis und ganz nahe an den Holzstoß, so dass ihre kleine Gestalt von den brennenden Fackeln der Rantumer leuchtete, als wäre sie in Gold getaucht. Maren stieß Thies in die Seite. »Sie sieht aus wie eine Heilige, nicht wahr?«
Thies aber schüttelte den Kopf. »Manche sagen, sie wäre eine Hexe, und gerade jetzt weiß ich nicht genau, ob das nicht stimmt. Was tut sie da?«
Jetzt hob Meret die Arme, warf den Kopf in den Nacken und hielt das Gesicht gegen den dunklen Nachthimmel, der nur von einem fahlen Streifen Mondlicht erhellt wurde. »Wotan, Herrscher über Sturm und See, Wächter über die Meerfahrt und den Fischfang, Lenker von Rad und Schwert, ist unser großer, guter Gott. Seine Gunst zu gewinnen, opfern wir ihm heute in fressender Flamme Tier und Gut«, rief sie mit eindringlicher dunkler Stimme, die manch einem einen Schauer über den Rücken jagte.