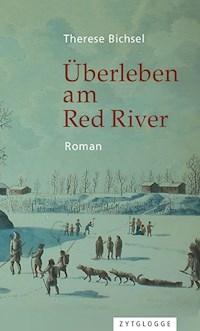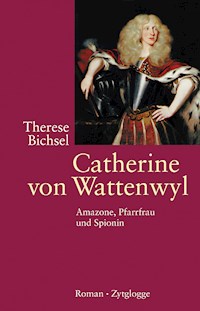29,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familie wandert durch die Jahrhunderte Historischer Roman über eine Schweizer Auswandererfamilie vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert Weitgehend auf Tatsachen beruhende Aus- und Rückwanderungsschicksale auf verschiedenen Zeitebenen Stimmungsvolle exemplarische Darstellung einer Walser Wanderung Im Jahr 1300 verlässt die junge Walserin Barbara mit ihrem Mann und Mitwanderern das von Armut und Naturkatastrophen geprägte Lötschental und lässt sich im hinteren Lauterbrunnental nieder, wo die Siedler Mürren, Gimmelwald und den Weiler Ammerten begründen. Im 18. Jahrhundert stirbt Ammerten aus, nicht aber die Familien, die diesen Namen tragen. Sie lassen sich im vorderen Lauterbrunnental nieder. Doch auch dort wird es Ende des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich eng. 1879 wandert Elisabeth Ammeter mit Mann und Kindern in den Kaukasus aus. Um die Jahrhundertwende reist Anna Stücker aus Thun nach Georgien und heiratet dort Elisabeths Sohn Fritz. Bei der Russischen Revolution wird die Familie enteignet und ist zunehmender Verfolgung ausgesetzt. Deshalb müssen 1929 die Ammeters Georgien verlassen. Anna unternimmt einen Abstecher nach Thun und folgt dann der restlichen Familie nach Kanada. Lediglich Elisabeths jüngste Tochter Martha Siegenthaler-Ammeter kehrt dauerhaft in die Schweiz zurück und erlebt einen schwierigen Neubeginn im Emmental der 1930er und 1940er Jahre. Die Autorin verwebt verschiedene Zeitebenen zu einer eindrücklichen Familiensaga über mehrere Jahrhunderte, die exemplarisch für viele Auswandererschicksale in der Schweiz steht. 'Die […] Autorin […] hat seit Jahren historische Frauenbiografien aus dem Dunkel ans Licht gehoben und für eine moderne Leserschaft mit Leben erfüllt.' Beatrice Eichmann-Leutenegger, Der Bund, 14. September 2012
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Therese Bichsel
Die Walserin
Therese Bichsel
Die Walserin
Eine Familie wandert durch die Jahrhunderte
Roman – Zytglogge
Für meinen Mann Hannes und die Monte-Rosa-Gruppe,
die mich auf vielen Walserwanderungen begleiteten
Die kursiv gedruckten Briefauszüge von Anna Ammeter-Stücker sind Originalzitate.
2. Auflage 2015
© 2015 Zytglogge Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Hugo Ramseyer
Cover: Steinfrau am Oberhornsee, Lauterbrunnental (Foto: Therese Bichsel)
Umschlagrückseite: Wetterlücke zwischen Breit- und Tschingelhorn (Foto: Therese Bichsel)
Gesamtherstellung Schwabe AG, Muttenz/Basel
ISBN 978-3-7296-0898-6
eISBN (ePUB) 978-3-7296-2044-5
eISBN (mobi) 978-3-7296-2045-2
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
www.zytglogge.ch
Inhalt
Vorwort
I Barbara (Mittelalter)
II Barbara (Mittelalter)
Elisabeth Ammeter-Ammeter (19. Jahrhundert)
Anna Ammeter-Stücker (20. Jahrhundert)
Martha Siegenthaler-Ammeter (20. Jahrhundert)
III Barbara (Mittelalter)
IV Barbara (Mittelalter)
Personen
Literatur / Quellen
Karten
Dank
Über das Buch
Über die Autorin
Vorwort
Der Name ist sofort da: Barbara.
Schemenhaft erscheint sie, entschwindet, taucht wieder auf. Eine junge Frau im späten Mittelalter. Sie lebt im Lötschental, dann im hinteren Lauterbrunnental, abgeschieden von der Welt. Die Sonne bestimmt ihr Leben, die Jahreszeiten, die Natur, ihre Nächsten – Mann, Sohn, Vater, Schwester, Schwager. Und der weltliche Herr, dem diese Leute gehören.
Barbara, denke ich, war auch in ihrer Heimat ein bisschen fremd. In der engen Gemeinschaft im Lötschental fiel sie auf, man grenzte sie aus. Im Lauterbrunnental waren alle Ausgewanderten Fremde. Man nannte sie die Walser oder Lötscher. Sie waren Teil der grossen Wanderbewegung der Walser, vom Wallis in die Alpentäler südlich des Monte Rosa, ins Graubünden und Tessin, in den Vorarlberg und ins Berner Oberland.
Die Lütschine im Lauterbrunnental erhielt ihren Namen wohl von den Lötschern. Auch andere Namen gehen auf die Walser zurück – bekannte Familiennamen wie von Allmen, Brunner, Feuz, Rubi und Ammeter. Sie besiedelten die hohen Alpen im Tal – Mürren und Gimmelwald sind Walsergründungen. Nicht alle hatten Bestand. Vom Weiler Ammerten blieben nur Hausfundamente, ein Mühlstein und die Schneide eines Beils.
Die Ammeters zogen weiter ins kleine Dorf Isenfluh im vorderen Lauterbrunnental und waren dort das häufigste Geschlecht. Aber im späten 19. Jahrhundert wurden die wirtschaftlichen Verhältnisse in Isenfluh so eng wie einst im Lötschental. Deshalb wanderten einige Ammeter-Familien in den Kaukasus aus.
Zur ersten grossen Wanderung im Spätmittelalter gibt es kaum Quellen. Die Auswanderung der Ammeters im 19./20. Jahrhundert dagegen ist gut dokumentiert.
Die Geschichte dieser Wanderung durch die Zeiten nahm ihren Anfang mit Barbara, stelle ich mir vor. Sie wanderte über die Alpen in die Fremde. Ihr Weg war schwierig – wie jener der späteren Auswanderinnen Elisabeth, Anna und Martha auch.
Th. B.
I BARBARA
Lötschen, Hornung 1300
Ein dumpfer Knall. Brausen, Krachen. Ihr Traum zersplittert. Sie ist hellwach, versucht das Halbdunkel zu durchdringen. Conrad. Seine Augen sind geweitet, er hat sich auf dem Stroh aufgerichtet, horcht wie sie auf das Tosen, das immer lauter wird. Ein Hund heult auf in der Nachbarschaft. Er greift nach ihrer Hand und drückt sie so fest, dass es schmerzt.
Sturmluft fährt durch die Stube, ein ungeheurer Druck trifft das kleine Haus, dann ein Stoss. Das Haus ächzt in seinen Grundfesten. Conrads Fingernägel bohren sich in ihre Hand. Sie schreit auf vor Angst und Schmerz. Das Haus aber, dessen Stämme erst im vergangenen Jahr zusammengefügt und verstrebt wurden, birst nicht, jedenfalls nicht in diesem Augenblick.
Conrad ist aufgesprungen, er zieht sie hoch. Atemlos stehen sie an den Gucklöchern, die Lederhaut zur Seite geschoben. Die Schneemassen stürzen auf beiden Seiten am Haus vorbei. Sie glaubt Balken auszumachen, die vorbeigeschleudert werden. Und da – ist das nicht ein Arm, der aus der Flut herausragt und wieder verschwindet? Die Lawine treibt Bäume mit sich in einem letzten Schwall, ergiesst sich in die Tiefe, ins Bett der Lonza. Schneestaub erfüllt die Luft, dann ist es vorbei. Stille senkt sich übers Haus, über das Tal. Die übliche Stille der Nacht – wie wenn nichts geschehen wäre.
Barbara zittert. Sie weiss es in diesem Moment, dreht sich zu Conrad. Er hat sich aus der Erstarrung gelöst, versucht vergeblich die Aussentür zu öffnen, schlägt gegen das Holz, stösst mit seiner Schulter dagegen. Die Tür wird nicht aufgehen, nicht jetzt. Aber wenn im Frühjahr der letzte Schnee von den Dächern getropft ist und die Schneefelder im Tal oben geschmolzen sind, ist es Zeit zu gehen.
Sie sieht ein Bild vor sich. Der Prior segnet das Paar, das vor ihm kniet. Das war im vergangenen Herbst, in der Kapelle von Kippel. Sie war knapp sechzehn, die Väter hatten die Hochzeit abgemacht. Ihr war es recht gewesen – und der Vater froh, sie aus dem Haus zu haben. Da Conrad, der zweitjüngste von fünf Brüdern, in seinem Heimatdorf Lötschen nur wenig Boden erben wird, hatte ihnen sein Vater ein Stück Land zwischen Wiler- und Tännerbach am Talhang gegenüber abgetreten.
Giätrich heisst der kleine Weiler auf der Schattseite. Bis vor einigen Jahren duckten sich nur ein paar Stadel unter die Tannen und Lärchen am auslaufenden Hang. Nun sind ein paar neue Häuser entstanden, denn wo will man sonst hin, in Lötschen wird das Land unter den vielen Nachkommen in immer kleinere Äcker aufgeteilt.
Man sagt so einiges über Giätrich. Früher sollen die Schurtendiebe – kurzgewachsene, dunkle Gestalten mit furchterregenden Masken – von hier aus in Lötschen eingefallen sein. Man sagt, diese Leute seien von der Sonn- auf die Schattseite verdrängt worden, als die jetzigen Bauern über die Berge hierherzogen. Auf der Schattseite hätten sie Not gelitten und darum Raubzüge in die neuen Häuser auf der Sonnseite gemacht. Inzwischen sind die wilden Gesellen verschwunden, nur Steine ihrer Feuerstellen und einige Stämme ihrer Häuser sind geblieben. Conrad und Barbara haben sie für ihren Hausbau verwendet. Haben sie sich versündigt?
Conrad gibt sein nutzloses Poltern und Anrennen gegen die Tür endlich auf, lässt sich aufs Stroh sinken und schliesst die Augen. Barbara legt sich neben ihn, zieht die Decke über beide. Sie sind vom Schnee eingeschlossen, aber unversehrt. Sie schmiegt sich an ihn. Eine kleine Atemwolke ist vor ihrem Mund, als sie spricht. «Erinnerst du dich an die Worte des Priors in der Mitternachtsmette an Weihnachten?»
Er antwortet fast tonlos, die Augen noch immer geschlossen. «Im Namen des Herrn Peter von Turn hat er den Armen Land versprochen. Über die Schneeberge wandern müssten wir. Aber wir haben doch unser Haus hier auf der Schattseite.»
«Wir können dort unter den hohen Alpen auswählen, hat er gesagt.» Sie netzt die Lippen mit der Zunge. «Conrad, es geht nicht um Äckerchen und kleine Alpen wie hier im Tal. Wir werden ein grosses Stück Land für uns haben und ein neues Zuhause schaffen, für uns und unser Kind.»
Er reisst die Augen auf. «Unser Kind?»
«Das Blut blieb aus, schon zweimal. Mein Bauch wölbt sich ein bisschen. Das sind untrügliche Zeichen, sagt meine Schwester. Annamaria muss es wissen mit ihren drei Kindern.»
Freude zuckt über sein Gesicht, dann verschliesst es sich wieder. «Ich weiss noch nicht einmal, ob unser Vieh noch lebt – unser einziger Besitz. Wie willst du die Wanderung über die Lücke zwischen den Bergen überstehen, wenn du hochschwanger sein wirst?»
«Wir sind Ende Hornung. Das Kind wird im Herbst kommen, meint Annamaria. Dann sind wir längst drüben und haben uns eingelebt. Wir werden ein grösseres Haus bauen als dieses hier – an einem Ort, der sicher ist vor der weissen Gefahr. Wir sind verschont geblieben. Aber wir dürfen das Schicksal nicht herausfordern», sagt sie bestimmt. «In Giätrich haben wir keine Zukunft, Conrad, hier wächst kaum etwas, der Wind pfeift um unser Haus, der Schnee von den Bergen bedroht es im Winter, der Tännerbach im Sommer. Die Schurtendiebe zürnen, dass wir aus ihren Steinen und Stämmen neue Häuser bauten.» Ihr Ton ist beschwörend. «Bitte, Conrad. Nicht nur unser weltlicher Herr rät uns, drüben neu anzufangen, und gibt uns die Erlaubnis dazu. Das war ein Zeichen unseres obersten, geistlichen Herrn.»
Zweifel nagen an ihm. Sie wirft das Haar zurück, blickt ihm herausfordernd ins Gesicht. Barbara ist am vierten Tag des Christmonats geboren, ihre Eltern haben sie nach der tapferen, heiligen Barbara benannt. Der Name passt. Ein anderer wollte die Babe auch, hatte ihr Vater gesagt. Sie spricht nicht darüber, und es kümmert ihn nicht – der Vater hat sie ihm gegeben. Nach der Heirat sind sie nach Giätrich gezogen, weil die Kammern in seinem Elternhaus, die sie mit den Brüdern und deren Ehefrauen teilten, zu eng wurden. Der Vater, die Brüder und viele Leute aus dem Dorf haben geholfen, dieses Haus zu bauen. Einige runzelten die Stirn: «Nach Giätrich an den Schattenhang zieht man nicht, hier treiben die bösen Geister ihr Unwesen», hiess es. Sie haben Recht bekommen. Und nun will Babe weiterziehen. Land will sie und ein neues Haus, jenseits der Berge.
Man hat ihm gesagt, sie sei eigensinnig. Trotzdem wollte er sie und keine andere. Viele Jahre schon hat er sie beobachtet, wie sie, stolz, grossgewachsen, mit der Schwester durchs Dorf schritt. Am Brunnen krümmte sie sich nicht über die Wäsche wie die andern Frauen und Mädchen, sie rieb sie mit geradem Rücken, richtete sich zwischendurch auf, strich sich eine Strähne aus der Stirn. In der Kapelle setzte er sich immer so, dass er Barbara, die auf der Seite der Frauen zuäusserst sass, im Auge hatte. Dann schienen ihm die lateinischen Messen des alten Priors nicht gar so lang. Er musterte ihr dunkles, geflochtenes Haar, die glatte Stirn und gesenkten Lider, und eine grosse Ruhe überkam ihn. Und nun erwartet sie ein Kind. Die Lawine ein Zeichen? Vielleicht.
Er legt den Arm um Barbara. Ihre Züge zeichnen sich im frühen Morgenlicht deutlicher ab, sie schaut ihn an, und seine Worte formen sich wie von selbst. «Wir gründen drüben einen neuen Hausstand», erklärt er. «Ich bin bereit, unser Tal zu verlassen. Ich tue es für unseren Herrn. Und für dich, Babe, für unser Kind.»
«Danke, Conrad.»
Stimmen sind zu hören, Conrads Vater ruft nach seinem Sohn, seine Stimme zittert. Conrad läuft zum Guckloch, ruft dem Vater zu, dass sie unversehrt sind.
«Wir graben euch aus, habt Geduld» – die Stimme von Walter, seinem jüngsten Bruder. Conrad hört das Stechen und Kratzen von Schaufeln.
Von neuem packt ihn der Zweifel. Soll er sie alle verlassen, Lötschen verlassen? Es gibt andere Täler, der Prior erzählt manchmal davon, wenn er mit dem Lateinischen fertig ist und in ihrer Sprache redet. Er, Conrad, ist noch nie durch die Lonzaschlucht ins grosse Tal hinuntergestiegen. Es gab keinen Grund dafür. Die Berge besteigt man bis zur Höhe der Alpen, die man im Sommer bestösst, wenn der Schnee zurückgewichen ist. Und nun soll er mit Sack und Pack über die versteckte Lücke zwischen den Schneebergen hinten im Tal und nie mehr heimkehren?
Er springt hoch und geht zur Tür, dreht Barbara den Rücken zu, horcht. Erst als die Stimmen lauter werden, die Schaufeln gegen die Tür stossen und sie endlich aufgeht, der Vater im Türrahmen steht, wird ihm wohler. Er hat vorhin unter dem Eindruck der Lawine, die sie fast unter sich begraben hat – er bekreuzigt sich –, überstürzt seine Zustimmung gegeben. Jetzt aber dringt helles Tageslicht ins Haus, das standgehalten hat, der Vater und die Brüder schlagen ihm auf die Schulter, er ist zurück im Leben, wird mit ihnen die andern Häuser ausgraben. Er schaut zu Barbara. Sie starrt hinaus auf den Schnee.
Barbara geht auf den Wegen, die durch die Schneemauern links und rechts noch enger geworden sind, zwischen den von der Sonne dunkelbraun gebrannten Häusern hindurch, manchmal rutscht sie mit ihren um die Füsse gebundenen Schuhen, fängt sich auf. Der Himmel ist bedeckt, aber es schneit nicht mehr, nachdem in den vergangenen Tagen fast ununterbrochen grosse Flocken aus den Wolken fielen. Wie Decken haben sie sich über die Felder, Wiesen und Wälder gelegt, alle Geräusche erstickt. Im Dorf türmt sich der Schnee zu grossen Haufen.
Die Leute im Dorf grüssen sie mit Ehrfurcht. Die Barbara und der Conrad haben überlebt. Gott hat sie am Leben gelassen. Das hat einen Sinn. Den Paul und die Cresentia hat er nicht verschont, vielleicht haben sie gesündigt, wer weiss es schon. Ihr Haus stand weiter oben am Hang, der Ausläufer der Lawine, die sich mit grosser Wucht den Weg vom Bietsch Horn hinunter gesucht hat und seitwärts ausgebrochen ist, hat das Haus erfasst und mitgerissen. Die übrigen Bewohner am Schattenhang und das Vieh sind nicht betroffen. Man weiss doch, dass Giätrich Gefahren ausgesetzt ist, dass sich dort die Schurtendiebe herumtreiben. Dieses Wissen missachtet man nicht ungestraft. Trotzdem: Man hat geholfen, die Toten aus dem Schnee zu graben, hat sie ins Dorf zurückgetragen, wird ihnen Weihwasser spenden. Sie liegen aufgebahrt in der Wohnstube des Ignaz, Vater von Paul. Der Prior hat den Versehgang gemacht und für das Seelenheil von Paul und Cresentia gebetet. Am Abend werden alle noch einmal hingehen und in der Stube der Toten dreimal den Rosenkranz vor sich hinmurmeln.
Auch Barbara wird noch einmal bei den Toten beten. Nun aber schreitet sie durchs Dorf dem Martibiel zu, wo die Kapelle steht. Sie trägt wie die andern Frauen im Dorf eine schwarze Haube, auch Jacke und Rock sind schwarz. Aber ihre Schürze leuchtet blau, das ist unüblich, Blau ist selten und kostbar. Barbara hat die Schürze von ihrem Vater erhalten, als er einmal ins grosse Tal des Rottens hinuntergestiegen ist, zum Markt. Am Abend hat er ihr die Schürze hingelegt. Sie hat den glänzenden Stoff zwischen den Fingern gerieben und sich ungläubig bedankt. Wortlos hat er das Haus verlassen.
Und nun, als hätten ihre Gedanken ihn herbeigerufen, tritt er plötzlich zwischen den Häusern hervor, stockt in ihrem Angesicht. «Guten Tag, Vater.» Sie will auf ihn zugehen, erklären, wie sie gerettet wurden, denn er wird wie alle von der Lawine in Giätrich gehört haben. Aber er dreht sich um, geht mit grossen Schritten davon, wie wenn er verfolgt würde.
Der Vater meidet sie, wie er es immer getan hat. Die Mutter hat sie bei der Geburt verloren. Wenn Annamaria nicht gewesen wäre, ihre Schwester, hätte er sie weggegeben. Annamaria, sechs Jahre älter, war ihr eine kleine Mutter. Und dann kam Conrad, sie spürte seinen Blick auf sich in der Kapelle. Er war anders als ihr Vater. Gedankenverloren streicht sie über den schimmernden Stoff. Sie hat die Schürze erstmals im vergangenen Jahr am Tag ihrer Vermählung getragen.
An diese Hochzeit, an die stolze Braut, herausgeputzt mit schwarzer Samtkappe und diesem himmlischen Blau, erinnern sich auch die Leute in Lötschen, die ihr mit den Augen folgen. Aber jetzt ist nicht einmal Sonntag, und Barbara trägt ihre leuchtend blaue Schürze, man schüttelt den Kopf. Gerade erst ist sie verschont worden, und nun das. Wenn das nur gut kommt.
Barbara spürt die Blicke, lässt sich aber nicht aufhalten, nicht heute. Sie biegt ein nach Kippel, wo sich die dunklen Häuser wie eine Herde Schafe um die Kapelle drängen. Einen Moment hält sie inne, blickt in die Ferne, wo sie das tief im Schnee versunkene Häuschen über dem Einschnitt der Lonza wahrnimmt, ihr kleines Haus, das sie an genau jener Stelle errichteten, die den Blick zur Kapelle freigibt. Vielleicht hat die Muttergottes darum ihr Haus geschützt? Barbara öffnet die Tür der hölzernen Kapelle, stellt fest, dass sie allein ist und laut beten kann. Sie taucht die Finger ins Weihwasser und bekreuzigt sich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Vor dem Bild der Maria mit dem Jesuskind fällt sie auf die Knie.
«Heilige Muttergottes, ich danke dir. Du hast Conrad und mich vor der Lawine bewahrt. Ich hatte nicht einmal mehr Zeit, um deinen Beistand zu bitten, es ging alles so schnell. Die Schneemassen rissen das Haus von Paul und Cresentia mit, der Herr sei ihnen gnädig. Um unser Haus teilten sie sich. Du hast uns verschont. Vielleicht, weil es der Wille des Herrn ist, der noch etwas mit uns vor hat? Ich habe es als Zeichen genommen, verehrte Muttergottes. Als Zeichen, dass wir nicht hierbleiben, sondern die Reise auf die andere Seite der Schneeberge antreten sollen. Diese Reise, von welcher der Prior in der Messe sprach im Auftrag unseres weltlichen Herrn. Bin ich vermessen, versündige ich mich? Conrad teilte meine Meinung in der Früh. Aber dann, nach unserer Rettung, sah ich Zweifel in seinen Augen. Vielleicht habe ich ihn zu etwas gedrängt, das nicht gut ist. Bitte, heilige Maria, Muttergottes, lass mich wissen, was ich tun soll. Bitte.» Sie hebt das Gesicht zu jenem der Muttergottes, tastet es mit den Augen ab nach Spuren des Wiedererkennens, nach einer Antwort. Aber da ist nichts. Das Gesicht der Muttergottes ist glatt und undurchdringlich, der goldene Heiligenschein blendet Barbara fast.
Der Boden ist kalt unter ihren Knien, sie erhebt sich, beugt das Knie noch einmal, schaut zur Muttergottes mit flehendem Blick, erhält keine Antwort, geht durch den Mittelgang davon. An der Tür dreht sie sich noch einmal um. Und da sieht sie, was sie wissen will, es ist ein Wunder: Ein Sonnenstrahl fällt durchs kleine Fenster, die Muttergottes mit dem Kind auf dem Arm wirkt belebt, blickt sie an. Barbara dreht sich um und geht hinaus, erfüllt von diesem Zeichen. Bereits versteckt sich die Sonne wieder hinter einer Wolke, das Licht ist erloschen. Nun ist sie sicher. Barbara ist warm, auch wenn der Schnee unter ihren Schuhen knirscht und ihre Knie schmerzen.
Sie klopft an die Tür der Schwester, und Annamaria macht auf, Jakob und der kleine Paul hängen an ihrer Schürze, Maria, die Kleinste, trägt sie auf dem Arm. Annamaria beugt sich vor und legt die Arme um sie.
«Gott sei gelobt für deine Rettung, Babe.» Sie setzt die Kleine auf den Boden, die ihren Brüdern nachkriecht, die weggerannt sind. Die beiden Schwestern setzen sich auf die Bank bei der Feuerstelle. Annamarias blaue Augen sind weit aufgerissen unter dem krausen, hellen Haar, sie mustert die Schwester, wie wenn sie nicht glauben könnte, dass sie unversehrt ist.
Barbara nimmt ihre Hände. «Annamaria. Wir werden im Frühjahr über die Lücke zwischen den Bergen wandern und in einem Tal drüben ein neues Leben anfangen.»
«Über die Lötschenlücke auf den Gletscher wollt ihr?», fragt die Schwester verständnislos.
«Ich meine die andere Lücke zwischen den Bergen hinten im Tal, jene, die uns hier verborgen bleibt, dort, wo manchmal die Wolken heraufquellen. Der Prior hat in der Christnachtmesse davon gesprochen, du erinnerst dich? Nicht nur Joseph und Maria seien aufgebrochen. Auch einige von uns sollten es tun, damit wir nicht verarmen im Tal. Wir können neu anfangen jenseits der Berge, und euch bleibt mehr Boden, um hier zu überleben.»
«Aber doch nicht du, Babe – Barbara. Gerade erst seid ihr errettet worden. Conrad und du seid frisch vermählt, du bist mit Kind!»
«Gerade darum, Annamaria – unser Kind soll nicht auf dem kargen Boden von Giätrich aufwachsen. Es soll es gut haben auf einer fruchtbaren Alp jenseits der Berge. Davon hat der Prior gesprochen, nicht wahr? Die Lawine ist ein Zeichen, und in der Kapelle vorhin habe ich ein weiteres Zeichen erhalten.» Sie erzählt der Schwester vom Sonnenlicht auf dem Gesicht der Muttergottes. «Es war, wie wenn sie zu mir gesprochen hätte. Die Muttergottes wird mit uns sein auf unserem Weg. Der Prior wird uns seinen Segen geben und der Herr von Turn unsere Reise wohlwollend zur Kenntnis nehmen – er will das Land nutzen, das sein Sohn Johann durch die Heirat mit Elisabeth von Wädenswil erworben hat. Einige Lötscher werden mit uns kommen. Vielleicht auch eure Familie, Annamaria?»
Es poltert in der Stube, Werner, Annamarias Mann, den sie nicht bemerkt haben, steht plötzlich in der Tür. «Du weisst nicht, was euch auf der andern Seite der Berge erwartet. Könnt ihr tatsächlich Land nehmen? Werdet ihr fruchtbare Äcker bestellen können? Ich bin Lötscher und werde nirgendwo anders hingehen, mein Weib und meine Kinder auch nicht.» Werner schlägt mit der Faust auf den Tisch, blitzt die Frauen unter seinen buschigen Augenbrauen an. Er stampft aus der Stube, wirft die Haustür hinter sich zu.
Annamaria ist zusammengezuckt, sie setzt sich gerade hin. «Es ist nicht nur Werner, Barbara. Auch ich kann mir nicht vorstellen, hier wegzugehen. Ich kenne nur unser Tal und möchte nichts anderes kennenlernen. Hier bin ich zu Hause. Unser Vater ist alt, vielleicht wird er mich bald noch mehr brauchen als jetzt. Und dich auch, Babe.»
«Der Vater braucht nur dich, Annamaria. Du hast ihm das Haus geführt, dich hat er in seine Entscheidungen einbezogen. Über mich schaut er hinweg. Erst vorhin, auf dem Weg zur Kapelle, bin ich ihm begegnet, und er ist vor mir geflohen wie vor einer Erscheinung, hat mich nicht einmal gegrüsst.»
Annamaria ringt mit sich. «Barbara. Du gleichst Mutter so sehr mit deinen dunklen Augen und Haaren, auch wenn du grossgewachsen bist im Gegensatz zu ihr. Vielleicht quält ihn dein Anblick.»
Barbaras Kehle ist trocken. «Ich bin ihr Ebenbild? Aber dann müsste er doch umso mehr meine Nähe suchen. Ich verstehe Vater nicht.» Sie erhebt sich. «Du wirst mir fehlen, Annamaria.»
Die Buben streiten nebenan, die Kleine schreit. Annamaria steht auf, nimmt Maria auf den Arm. «Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, nicht wahr? Was meint Conrad?»
«Conrad denkt gleich wie ich.» Barbara umarmt die Schwester zum Abschied. «Wir brechen auf, wenn der Schnee geschmolzen ist.»
Lötschen, Ostermonat 1300
Barbara ist am Spinnen, stetig zupfen ihre Hände Fasern vom Spinnrocken, die Handspindel dreht emsig, der Faden wird immer länger, bis sie nach der Spindel greift und ihn aufwickelt, bevor sie mit dem Zupfen fortfährt. Es ist dunkel in der kleinen Stube, obwohl draussen heller Tag ist. Alles Dunkle lastet auf ihr. Sie erhebt sich, entfernt die Lederhaut von den Gucklöchern. Das hereinfallende Licht zeigt ihren leicht gerundeten Körper, bei ihrer Grösse aber fällt die Rundung nicht ins Gewicht, sie bewegt sich noch immer behende. Sie dreht sich um und setzt sich wieder auf den dreibeinigen Hocker. Zupfen, Faden spinnen, rasches Drehen der Spindel. Sie muss kaum hinschauen, es geht alles wie von selbst.
Plötzlich hält sie inne, der Faden bricht ab. Sie horcht. Plopp – plopp-plopp. Es tropft. Der Schnee tropft von den Dächern. Tauwetter hat eingesetzt. Sie springt auf, wirft alles hin, ist im Nu vor dem Haus, streckt die Hände aus. Ein Tropfen formt sich am Rand der Schindel, er ist durchsichtig, wird grösser, zieht sich in die Länge und fällt auf ihren Daumen, kühl ist er, läuft an ihrer Hand entlang, fällt in den Schnee, der matschig in ihre mit Riemen um die Füsse gebundenen Schuhe dringt, sie erschauert.
Sie blickt zum spitzen Bietsch Horn, das sich hoch über Giätrich auftürmt. Seit dem Hornung ist keine weitere Lawine auf Giätrich heruntergekommen, das Horn hat sie verschont, hat die Schneemassen auf anderen Wegen – um Giätrich herum – ins Tal geschickt, die Schurtendiebe, die vielleicht dort oben den Schnee anstossen, haben ihre ehemalige Wohnstätte von weiterem Unbill verschont.
Conrad und sie sind aus freiem Willen auf die Schattseite gezogen. Eigentlich war es ihr, Barbaras, Willen. Eine Frau nimmt sich hinter den Willen ihres Mannes zurück. Wenn sie es nicht tut, straft er sie dafür. Nicht Conrad. Die Falte zwischen seinen Brauen wird schärfer, wenn sie ihm widerspricht, aber er lässt sie gewähren. Manchmal liest sie etwas wie Bewunderung in seinen Augen. Sie schämt sich dafür, dass sie sich erhebt. Sie kann nicht anders.
Barbara schabt mit dem Fuss eine Linie in den Schnee. Sie war es, die nach Giätrich wollte. Es war ihr zu eng mit den Schwägerinnen und Schwägern. Das Stöhnen und Knarren in der nächtlichen Kammer, das Seufzen, Schnarchen und die unterdrückten Laute, wenn sich einer der Männer im Dunkeln sein Recht nimmt. All das ist sie nicht gewöhnt, war mit Annamaria allein in der Kammer, aber die Schwester ist schon lange weg, sie haben nicht neben dem Vater in der Stube geschlafen, bei ihnen ist alles anders.
Sie, Barbara, ist anders. Ihre Füsse sind kalt vom Schnee, aber es macht ihr nichts aus. Sie zeichnet eine zweite Linie quer in den Schnee, nun ist es ein Kreuz. Unwillkürlich richtet sie sich auf, blickt in die Ferne, da, das spitze Türmchen der Kapelle auf dem Martibiel in Kippel, dongdong, die kleine Glocke ruft, Barbara lässt sich auf die Knie fallen, sie spürt die Tropfen nicht, die ihr ins Haar fallen, über das sie wieder einmal keine Haube gezogen hat.
Muttergottes, heiliger Martin, heilige Barbara, betet sie, den Blick noch immer auf die Kapelle gerichtet. Nun hat das Tauen eingesetzt, es lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich bin es, die hier weg will, weg aus dem Schatten, weg aus Giätrich, über die Berge, vielleicht ist es vermessen. Aber unser Herr schickt uns, er will es so, es ist nicht nur mein Wille. Ihr Heiligen seid mit mir. Ich werde euch vermissen, heiliger Martin, deine Kapelle in Kippel, heilige Barbara, deine Kapelle in Ferden. Das Murmeln des Priors, seine Segnungen, die Wärme der Kerzen, der Duft des Weihrauchs. Nirgendwo sonst ist es so hell und warm wie bei euch in euren Kapellen. Die Muttergottes ist mit uns, sie wacht über uns. Und die heilige Barbara wird mich begleiten, nach ihr bin ich benannt. Letzthin war ich in ihrer Kapelle in Ferden. Ich habe mir das Bild von ihr mit dem Turm eingeprägt. Sie liess sich nicht einsperren. Ich auch nicht. Danke für alles, Muttergottes, heilige Barbara. Amen.
Sie bekreuzigt sich, steht auf, streicht sich über die Stirn. Plopp-plopp-plopp. Sie lächelt. Ihr Haar ist nass, sie spürt es jetzt, ihr Rock trieft. Es ist ihr alles einerlei. Sie hebt den Rock an, geht rasch hinein. An der Feuerstelle schiebt sie die Glut zusammen, bläst hinein, bis die Flammen züngeln, schiebt den Kessel über das Feuer. Sie wird das Essen bereiten für Conrad, der bald aus dem Dorf zurückkommt, wo er mit andern zusammen der Familie der verstorbenen Cresentia hilft, ein neues Haus aufzurichten. Man traut sich nicht mehr, in Giätrich zu bauen.
Recht haben sie. Auch sie traut Giätrich nicht mehr. Sie weiss nicht, was ihr den Mut gibt, nicht nach Wiler zurückzukehren, sondern es anderswo zu versuchen. Ist es der Wille des Herrn? Andere kommen ihm nicht nach. Wenn nur Conrad nicht kleinmütig wird – sie braucht ihn an ihrer Seite. Barbara streicht sich über den Leib. Conrad, sie und das Kind. Zu dritt können sie es schaffen.
Lötschen, Wonnemonat 1300
Sie hat es noch im Ohr, das Fallen der Tropfen vom Dach, das Platschen auf die Steinplatten vor dem Haus, endlos, plingplong, platsch, platsch, den ganzen Frühling über. Es kam ihr vor, wie wenn die Tropfen für die Meinung der Lötscher stünden. Ein Tropfen fiel rechts vom Dach, platsch, er war für das grosse Wandern, dann fiel ein Tropfen links, platsch, und sprach sich dagegen aus, und so ging es hin und her. Im Dorf hat man sich gestritten, manche waren dafür, andere dagegen. Einige sahen das Auswandern im Zeichen des Herrn. So sah auch sie es: Hatte sie nicht der Prior von der Kanzel herab dazu aufgefordert, standen nicht der weltliche und der geistige Herr dahinter? Andere sprachen vom Teufel, der sie in die Bergwildnis locke und sie zwischen Felsen und Abgründen in Schnee und ewigem Eis begraben werde. Man werde nur gehen, wenn der weltliche Herr sie zwinge – solle er doch seine Landsknechte schicken.
Barbara schüttelt den Kopf, setzt Schritt vor Schritt – so stetig, wie die Tropfen gefallen sind. Die Tropfen haben sie nicht von ihrem Weg abgebracht, so wenig wie die Steinplatten davon ausgehöhlt wurden. Conrad jedoch war einer der Zweifler gewesen, er hatte sich in der Nacht endlos auf seinem Lager gewälzt, sie hatte es gehört, sich schlafend gestellt. Es war alles gesagt, er war einverstanden. Aber dann starrte er sie auf einmal an wie eine Fremde, wie wenn der Teufel ihr die Worte eingeben würde. Im Handkehrum schloss er sie in die Arme, drückte sie so fest, dass ihr die Luft wegblieb. «Babe», stöhnte er, «was wird nur aus uns, welches ist der richtige Weg?» Sie hatte ihm vom Zeichen erzählt, das ihr die Muttergottes in der Kapelle gegeben hatte, in seinem Gesicht zuckte es. «Wenn du nur Recht hast, Babe, wenn nur alles gut kommt …».
Jetzt stehen sie vor ihrem Haus, die Lasten bereits am Rücken. Conrad zieht die Tür zu und schaut am kleinen Haus mit seinen festgefügten Stämmen hoch. Barbara weiss, was er denkt: Dieses Haus hat uns Schutz geboten, auch zur Zeit der grossen Lawine. Und nun verlassen wir es, ziehen ins Ungewisse. Sie senkt den Kopf. Schon zieht er los, setzt seinen Stab mit Nachdruck, rammt ihn fast in den Boden bei jedem Schritt. Sie spürt das nasse Gras an ihren Beinen, geht hinter ihm her. Auf dem Steg überqueren sie die Lonza, er reicht ihr die Hand. Dann schreiten sie auf Kippel zu, das Bietsch Horn zu ihrer linken Seite zeichnet sich gross und schwarz ab vor dem verblassenden Nachthimmel.
Als Treffpunkt haben die Auswanderer die Kapelle bestimmt, der Prior will ihnen den Segen spenden. Barbara kann es nicht glauben, dass sie die vertrauten Umrisse zum letzten Mal sieht. Der Kerzenschein in der Kapelle, die Stimme des Priors, die die Weltenläufe und das Jenseits erklärt, der Duft von Weihrauch – wie soll sie ohne auskommen? Gibt es jenseits der Berge etwas Ähnliches, wenn da kaum Menschen sind?
Als Erste langen sie vor der Kapelle an. Er lehnt sein schweres Traggestell mit Arbeitsgerät, Werkzeugen, Kochkessel und Vorräten gegen die Kirchenmauer und nimmt ihr den Rückenkorb ab, der Decken und Kleider enthält, darunter auch die blaue Schürze. Die zwei Ziegen, die sie am Strick mit sich führen, meckern laut, als sie sie festbinden.
Unsicher blickt sie sich um. In den Gucklöchern glaubt sie Gesichter zu sehen, aber wenn sie genauer hinsieht, sind sie weg. Nur eine Tür öffnet sich plötzlich, und Annamaria tritt aus dem Haus, im Hintergrund ist Werners polternde Stimme zu hören. Annamaria umarmt die Schwester, schiebt ihr ein Säcklein mit Dörrschnitzen in die Schürzentasche, drückt Conrad die Hand und verschwindet im Haus, dessen Tür sich geräuschlos hinter ihr schliesst. Der Vater lässt sich nicht blicken.
Die Stille ist gespenstisch. Sie versuchen die Dämmerung mit den Augen zu durchdringen. Da. Gestalten erscheinen im Halbdunkel an der Hausecke: der bärtige Wilhelm, die verhärmte Elsi und ihre drei Söhne mit ausgefransten Hosen, Elsi hat die Augen gesenkt. Heinrich und Agathe, ein kräftiges, junges Paar in zerlumpten Kleidern, ebenfalls aus Ferden, stellt sich neben die Familie, in Heinrichs Hand liegt ein Rosenkranz. Auch aus Kippel tauchen Leute auf: Ulrich und Ursula mit den Töchtern Lena und Agnesa, deren Wohnhaus letztes Jahr abgebrannt ist, und Jacob und Greta, ein älteres, kinderloses Paar. Und auf einmal ist auch Walter da, Conrads jüngster Bruder, mit seiner Frau Christina aus Wiler. Walter blickt trotzig in die Runde, die schüchterne Christina, deren hellblondes Haar im Halbdunkel leuchtet, verbirgt sich hinter ihm. Barbara mustert die Gesichter und nickt für sich. Alle haben gute Gründe zu gehen.
Die Glocke setzt ein mit ihrem Geläut, die Wanderer betreten die Kapelle, knien vor dem Altar nieder. Der alte Prior zündet die Kerzen an. Er betet mit ihnen und zeichnet jedem mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn. «Möge Gott mit euch sein auf eurer Wanderung, eure Familien sollen gedeihen und sich vermehren», murmelt er. Dann dreht er ihnen den Rücken zu und fällt selbst auf die Knie vor der Muttergottes und Christus am Kreuz, laut fleht er und bittet um ihren Segen, mehrmals schlägt er mit der Stirn auf den Boden. Die Auswanderer scheint er vergessen zu haben. Mit gesenkten Häuptern verlassen sie die Kapelle. Draussen schultern sie ihre Lasten, binden die Ziegen los und machen sich auf den Weg.
Der Morgen ist frisch, obwohl es Ende Wonnemonat ist. Bald ist Brachmonat, dann Heumonat, so viel Arbeit wartet – sie darf nicht daran denken. Jenseits der Berge wird es noch viel mehr zu tun geben. Auf der Höhe von Wiler sieht sie ihr Häuschen gegenüber, klein steht es am auslaufenden Hang zusammen mit ein paar anderen – es wird nun als Heustadel gebraucht werden, niemand will mehr an die Schattseite ziehen, vom zerstörten Haus von Cresentia und Paul ist nur ein kahler Fleck am Hang geblieben, Conrad und Barbara sind die letzten, die Giätrich verlassen. Sie beschleunigt den Schritt. Im Dorf bleiben die Türen geschlossen, als die Wanderer durchziehen. Als sie die enge Reihe der dunkelbraunen Häuser abgeschritten haben, dreht sich Barbara um. Und siehe da: Alle stehen sie vor ihren Häusern mit bleichen Morgengesichtern und schauen ihnen nach – geräuschlos sind sie auf die Schwellen getreten und verschwinden wieder.
Auch im kleinen Ried zeigt sich niemand. Aber in Blatten ist alles anders: Burkhard, der zweitälteste Müllersohn, der die Mühle nicht erben wird und schon gegen dreissig geht, tritt ihnen mit schweren Schritten entgegen, gefolgt von seinen Brüdern und anderen jungen Burschen. Ein Wort gibt das andere, noch einmal wollen ihn die Brüder abbringen von seinem Vorhaben, doch er lacht nur, klopft ihnen auf die Schultern, stösst die Burschen in die Rippen und setzt sich an die Spitze der kleinen Gruppe. Barbara würdigt er keines Blicks, obwohl sie weiss, dass sie ihm früher gefallen hat, denn immer wenn sie am Dorfbrunnen wusch, war er plötzlich da, scherzte mit den Frauen und Mädchen, schaute aber nur sie an. Der Vater mag ihn nicht, er schickte ihn weg, als er vorsprach. Burkhard winkt den Männern und Frauen beim Abschied zu, bald liegt auch Blatten hinter ihnen.
Es ist nun hell, Licht fällt auf die Gruppe, die braunen Kittel, kurzen Hosen und Hüte der Männer, die schwarzen Röcke und Hauben und weissen Schürzen und Ärmel der Frauen. Alle wanken sie unter den Lasten, Breithacken, Sensen und Heugabeln sind auf die Tragen der Männer gebunden, Sicheln glänzen in den Körben. Die grösseren Kinder gehen ernst neben den Eltern her, die Ziegen zerren an ihren Stricken.
Beim Kreuz am Dorfeingang von Eisten warten Ruedi und Anni, ihren Bub mit der Spaltlippe versteckt Anni hinter ihrem Rücken. Wegen Gilyan leben sie ausserhalb des Dorfs, die Leute wollen ihn nicht sehen, man sagt, der Kleine bringe Unglück, Gott habe das Paar gestraft mit diesem Kind. Sie schliessen sich ihnen an. Die Gruppe teilt sich, nimmt die kleine Familie auf, man begrüsst sie nicht freudig, aber Ruedi ist willkommen, er ist der beste Erbauer von Häusern in Lötschen, man zieht ihn bei, wenn gebaut wird, und vergisst das Kind mit der Spaltlippe.
Barbara bleibt stehen, sie zählt mit den Fingern und braucht zweimal beide Hände, um die Wanderer zu zählen. Einundzwanzig sind es. Zweiundzwanzig werden es sein im Herbst, sie streicht über ihren Leib, einen Moment fällt die Schwere des Tages von ihr ab. Conrad mahnt, weiterzugehen, sofort spürt sie wieder die Last auf ihren Schultern.
Das hölzerne Kreuz am Dorfausgang von Eisten bleibt hinter ihnen zurück, jetzt steigt der Weg an nach Fafler. Sie kennt die Alp hinten im Tal, vor dem Alpabzug spielen dort manchmal Fiedler auf. Das helle Grün der Lärchen und das dunkle Grün einzelner Tannen leuchtet in der ersten Sonne, der Pfad führt in Schlaufen nach oben auf die Alp. Ein paar Hütten stehen hier, noch verschlossen, im Brachmonat wird die Alp bestossen.
Burkhard, der sich an die Spitze gesetzt hat, gewährt ihnen eine kleine Rast am Bach, sie nehmen die Tragen und Körbe von den Schultern, schöpfen Wasser. Keiner schaut zurück ins Tal, alle mustern heimlich die Felsen und Schründe, den Schnee und das Eis und die Berggipfel, die sich vor ihnen türmen und unbezwinglich scheinen. Demütig senken sie die Köpfe. Heinrich lässt den Rosenkranz durch die Finger gleiten und murmelt «Ehre sei dem Vater und dem Sohn», dann das Vaterunser und das Ave Maria, und bei der Wiederholung des Ave Maria stimmt einer nach dem andern ein: «Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir». Gestärkt stehen sie auf, schultern ihre Lasten und stapfen hinter Burkhard her, der ihnen den Weg ins innere Faflertal weist und auf die Lücke oben im Tal zeigt, die mit Schnee überzogen ist.
«Da», sagt er und steht breit vor sie hin, «die Lücke, über die das Wetter zieht. Haben wir nicht Glück? Über der Lücke ist nur Blau, keine Wolke zu sehen. Der Herr ist mit uns. Nach sieben bis acht Wegstunden, vielleicht auch etwas mehr, sind wir am Ziel, zuhinterst im Tal der lauteren Brunnen. Es ist schön, dieses Tal. Aber ihr müsst es euch verdienen, jeder muss sein Bestes geben, damit wir vor dem Einbruch der Nacht ankommen.» Sie mustern den kräftigen Burkhard bewundernd. Er kennt sich aus, hat vor kurzem den Weg erkundet und ist wieder zurückgekommen. «Ich werde euch anführen», hat er gesagt, und das tut er nun. Er missfällt ihr nicht, der Burkhard – aber Conrad ist ihr vertrauter.