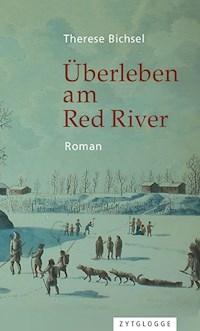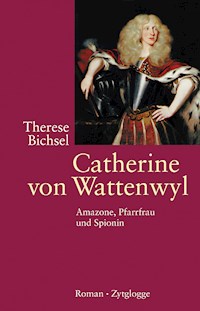26,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elisabeth Grossmann, la belle batelière de Brienz, war eine der berühmtesten Frauen in der Frühzeit des Tourismus anfangs 19. Jahrhundert. Aber das Bild, das man von der schönen Schifferin malte und in Reiseführern zeichnete, zeigt nur eine Seite ihres aussergewöhnlichen Lebens. Therese Bichsel schildert behutsam und eindringlich die Kehrseite der Idylle: eine Frau, deren erste grosse Liebe unerfüllt bleibt, deren Ehe scheitert, und die beispielhaft um ihre Kinder, ihr Ansehen und ihre Existenz kämpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Therese Bichsel
Schöne Schifferin
Für meine Mutter
Therese Bichsel
Schöne Schifferin
Auf den Spuren einer aussergewöhnlichen Frau
© 2017 Zytglogge Verlag AG, Basel Alle Rechte vorbehalten © Printausgabe Zytglogge Verlag Bern, 1997, 2. Auflage 1998 Lektorat: Hugo Ramseyer Umschlagbild: Kolorierte Aquatinta von Emanuel Locher (1769-1840) Besitz der Schweiz. Landesbibliothek, Bern eISBN (ePUB): 978-3-7296-2180-0 eISBN (mobi): 978-3-7296-2181-7
www.zytglogge.ch
«Wissen Sie was Sie mir versprochen haben, und Sie konnten mich so verlassen, und Sie sind nicht vor mich, ich vermag vor Schmerz nicht mehr schreiben.»
Elisabetha Grossmann
Prolog
In einem dunklen Winkel des Restaurants «Brienzerburli» in Brienz steht sie mir das erste Mal gegenüber. Elisabeth, die schöne Schifferin von Brienz, festgehalten in einer kolorierten Aquatinta, einem Genrebild der Zeit.
Als der Wirt das Licht einschaltet, schaut sie mich an, ein bisschen von unten herauf, anmutig erstarrt in der vom Maler gewünschten Pose. Linke Hand zum Hut hochgebogen, rechte Hand entschlossen am Ruder. Klare, blaue Augen, gerade Nase, kleiner Mund. Eine vollschlanke Gestalt, wohlgeformt. Das Haar im Kranz um den Kopf geflochten, kaum ein Löckchen, das sich dieser strengen Frisur entzieht. Ein schwarzes Samtband ziert das Haar, ein rotes Tüchlein den Hals. Das Mieder schnürt ihre Brust ein, die wehende Schürze scheint sie davonzutragen. Die Schürze ein fliegender Teppich für die schöne Schifferin? Fliegt sie ihren Träumen nach in ein anderes Leben, an die Seite eines Mannes aus vornehmer Familie, der ihr so nahe stand wie später keiner mehr?
Nein. Die Kirche bleibt im Dorf. Sie zeichnet sich links von Elisabeth im Bild ab und ist nicht wegzudenken. Elisabeth bleibt ihrer Heimat erhalten, der Berg im Bild umfasst sie, hält sie gefangen. Lieder singt sie bald keine mehr, die Ruder bleiben unbenutzt. Die Maler, Dichter und Reisenden auf ihren Spuren finden sie nicht mehr in Brienz, sondern als Frau des Stadthauswirts in Unterseen. Der Wirt reibt sich die Hände. Die Frau ist gut fürs Geschäft. Er führt sie vor, sie soll sich im Kreis drehen für die Fremden, auch wenn schon ein paar Kinder an ihrer Schürze hängen.
In Unterseen hat sich keiner mehr hingesetzt, um diese Frau zu porträtieren. Sie gehört jetzt zu ihrem Mann, sie ist die Stadthauswirtin. Man besichtigt sie trotzdem noch. Elisabeth zählt zu den Sehenswürdigkeiten des frühen 19. Jahrhunderts im Berner Oberland. Die Reisenden kommentieren ihre fülliger gewordene Figur, ihre mit den Jahren verblassende Schönheit. Sie massen sich ein Urteil an. Elisabeth steht im Schaufenster der Berühmtheiten, sie wird von Häme nicht verschont.
Ich sehe sie vor mir in der Tür des Stadthauses, klein wirkt sie auf einmal, mädchenhaft, obwohl ihre Brienzer Jahre schon lange zurückliegen. Sie hat den Blick abgewendet und lehnt am Türrahmen, die Schultern sind gebeugt. Da geht die Tür zur Schankstube auf, der Wirt ruft unwirsch nach ihr, sie soll endlich kommen, Gäste sind da.
Er schüttelt den Kopf. Wieso steht sie herum und träumt. Sie soll sich zusammennehmen und ihre Pflicht erfüllen. Die Reisenden wollen Elisabeth die Schifferin sehen, bekannt auch von ihrem Porträt, und nicht eine schattenhafte Träumerin.
Elisabeth schreckt hoch und folgt ihrem Mann ins Innere des Gasthauses. Sie hat so wenig Zeit für sich. Das Leben zieht an ihr vorbei, und sie schaut verwundert um sich.
Die ehemalige «belle batelière» hat das Ruder niedergelegt. Unentschlossen steht sie im schwankenden Boot. Wo will sie denn hin? Sie weiss es nicht.
1
Nein, schreit sie, nein. Wieso sagst du nein, wenn du ja meinst? Er biegt ihr die Hände auf den Rücken und schaut ihr in die Augen. Sie senkt den Blick und sammelt ihre Kräfte. Mit einem Ruck reisst sie sich los und rennt davon. Er läuft fluchend hinter ihr her, gibt ihr einen Stoss, und sie fällt ins knisternde Laub des Harderwaldes. Aber bevor er über ihr ist, rappelt sie sich auf. Mit einer Hand hält sie Rock und Schürze hoch und rennt den Felsweg entlang. Sie hört den stossweisen Atem ihres Verfolgers hinter ihr, aber sie schaut nicht in den Abgrund zu ihrer Linken und dreht sich nicht um. Sie läuft und läuft, und als sich der Weg verbreitert, springt sie wie ein Hase bald hinter diesen Baum, bald hinter jenen. Er bleibt ihr auf den Fersen. Sie sieht schon den Kirchturm und die Mündung des Waldwegs ins Wiesland, als sie merkt, dass sich der Abstand verringert. Sie schnappt nach Luft, sie kann nicht mehr.
Elisabeth schlägt die Augen auf, sie legt ihre Hand auf die schmerzende Schulter. Nein. Nicht wieder dieser Traum. Sie setzt sich auf und bewegt die Schultern mit kreisenden Bewegungen. Als sie aufsteht, lässt sie die Nachtschwere hinter sich zurück, und der Traum fällt ab wie ein Stück tote Haut.
Mit ein paar Schritten ist sie am Fenster. Sie starrt über die gleissende Wasserfläche und fühlt sich einen Moment glücklich. Dann greift sie an die Stirn, wendet sich ab. Nein, das ist nicht der Brienzersee. Sie weiss es ja. Das Wasser fällt über eine Schwelle, bricht sich, rauscht weiter. Das ist die Aare. Sie lebt im Stedtli, dem Städtchen Unterseen.
Gegenüber auf der anderen Seite der Schwelle stehen zwei Fischer, ihre Angelruten ragen in das Becken unter der Schwelle. Ein Mann rudert seinen Nachen über den Fluss. Er dreht ihr den Rücken zu. Sie folgt seinen ruhigen Bewegungen, mit denen er stehend das Boot fortbewegt auf das andere Ufer zu. Sie kennt diese Bewegungen in allen Einzelheiten, so viele Male hat sie selbst das Ruder geführt. Sie möchte ihm zurufen, das Ruder etwas flacher einzutauchen. Das Boot würde wendiger, liesse sich besser drehen. Der Nachen gleitet ans Ufer der Spielmatte, der Ruderer springt heraus, bindet das Boot fest und bückt sich nach seiner Angelrute auf dem Boden des Kahns. Der Mann braucht ihren Rat nicht. Rudern ist Männersache. Seit vierzehn Jahren rudert sie nicht mehr. Rudern schickt sich nicht für eine verheiratete Frau. Allein mit fremden Männern im Boot, so etwas ist undenkbar. Peter würde es ihr nie erlauben. Sie ist die Stadthauswirtin, die Frau von Peter Ritter. Das ist ihr Leben.
Das war ihr Leben. Elisabeth dreht sich vom Fenster weg und schaut sich in der kleinen Schlafkammer um. Ein breiter Sonnenstrahl trifft das Bett der Buben. Das mit Laub gefüllte Deckbett bewegt sich, der zerzauste Kopf ihres Sohnes Peter taucht auf. Elisabeth seufzt. Gleich werden auch Johannes und Friedrich wach sein. Der kleine Peter – so nennt sie ihn im Unterschied zu ihrem Mann – kann nie ruhig sein. Er kneift die jüngeren Brüder, schon geht das Geschrei los.
Elisabeth mag nicht zwischen den Streithähnen vermitteln. Sie wirft im Vorbeigehen einen Blick auf ihr eigenes Bett. Dort schläft die kleine Elisabeth, das Elisi. Die glatten, offenen Haare sind wie ein Kranz um das kleine Gesicht ausgebreitet. Die Fünfjährige hat sich in die warme Kuhle gelegt, die die Mutter im Bett zurückgelassen hat. Das Mädchen schläft tief, trotz des Geschreis seiner Brüder.
Elisabeth nimmt Tannenholz von der Beige und feuert den Herd an in der fensterlosen Küche. Die Buben sollen warme Milch trinken, bevor sie in die Schule gehen. Sie schneidet dicke Scheiben Brot vom Laib, den sie gestern gekauft hat, die Buben sind immer hungrig. Jetzt stolpern die drei aus der Kammer, die Hemdzipfel hängen den zwei Kleineren aus dem Hosenbund. Elisabeth zieht ihnen das Hemd zurecht und mustert sie. Als geschiedene Frau muss sie auf das Aussehen der Kinder achten. Sie schickt die Buben zurück in die Kammer zum Wasserkrug, ihr Gesicht ist nicht sauber. Nassgespritzt tauchen sie wieder auf, trinken die Milch stehend aus ihren Kacheln und stopfen das Brot in die Hosentasche, weil Elisabeth bereits unter der Tür steht und sie hinausschiebt. Nur nicht zu spät kommen. Der Schulmeister ist streng und erwartet von den Schülern, dass sie punkt sechs ruhig in der Schulbank sitzen. In den Sommermonaten ist nur am Sonntag von sechs bis acht Uhr Schule. Sie horcht. Sechs Schläge von den Glocken der nahegelegenen Kirche. Zum Glück ist das Schulhaus nur um die Ecke.
Der zehnjährige Peter und Hans, der Achtjährige, sind nur ausnahmsweise da; sie wollten wieder einmal bei ihr und den Geschwistern übernachten. Sonst leben sie bei ihrem Vater. Die Waisenbehörde hatte beschlossen, die Kinder aufzuteilen. Sie trauten ihr nicht zu, für alle Kinder aufkommen zu können. Vielleicht hatten sie recht. Das Geld ist bei ihr immer knapp. Erst vor wenigen Monaten hat Peter die ihr aus dem gemeinsamen Vermögen zustehenden 1500 Franken gezahlt, und das ist alles, was sie von ihm erhalten wird. Dafür musste sie nochmals vor Gericht gehen und ihren Verwandten bemühen, den alten Kirchrneyer Heinrich Grossmann. Als Frau kann sie nicht allein für ihre Rechte kämpfen vor Gericht; sie braucht einen Mann, der sie als ihr Rechtsvogt vertritt.
Peter macht ihr das Leben schwer. Sie hätte nie die Scheidung anstreben dürfen, wirft er ihr vor. Jetzt müsse sie eben büssen dafür. Nur bei den Kindern geizt er nicht. Die vom Gericht verlangten Zinsschriften im Wert von 6000 Franken für den Unterhalt und die Erziehung der Kinder hat er sofort hinterlegt. Die Hälfte der Zinsen, die sie für Fritz und Elisi brauchen darf, haben sie in den letzten zwei Jahren zusammen mit dem Geld aus dem Laden über Wasser gehalten. Dass er jetzt die beiden Buben bei ihr übernachten lässt – ist dies ein Zeichen der Versöhnung? Sie hofft es. Sie haben noch immer einiges gemeinsam. Nicht nur die Kinder. Sie weist ihm Gäste zu. Wer immer sie nach einer guten Unterkunft fragt, wird ins Stadthaus gewiesen. Und er muss ihr wohl oder übel die Fremden herüberschicken, die sich im Stadthaus, dem bekannten Gasthaus von Unterseen, nach ihr erkundigen.
Elisabeth spült die Kacheln im Zuber und fährt mit einem feuchten Tuch über den Holztisch in der Küche. Seit ihrer Scheidung vor zwei Jahren muss sie alles selbst machen. Im Stadthaus waren ihr vier Mägde zur Hand gegangen. Sie hatten die Gastzimmer in Ordnung gehalten, in der Küche geholfen, nach den Kindern geschaut und gewaschen. Jetzt kniet sich Elisabeth selbst hin auf der Treppe an der Aare und wäscht ihre Wäsche, Seite an Seite mit den Stadthaus-Mägden. Sie schrubbt und bürstet die Wäsche auf dem Waschbrett, schlägt und windet sie aus, und der Spott ist ihr gewiss. Sie schüttelt sich. Keine solchen Gedanken jetzt.
Aus der Küche tritt sie in die Schlafkammer. Heute ist Sonntag. Sie muss nicht in ihren Laden auf der anderen Seite der Häuserzeile, gegenüber dem Stadthaus, muss keine geschnitzten Holzwaren verkaufen an die durchfahrenden Reisenden, die sie dort aufsuchen. Sie hat fast zwei kostbare Stunden vor sich, die ihr allein gehören. Die kleine Elisabeth schläft noch immer. Sie streicht ihr übers Haar, das Mädchen murmelt etwas im Schlaf und dreht sich auf die andere Seite. Neben der Tür fällt Elisabeths Blick auf das Kinderbettchen. Es steht leer, seit ihr vor drei Jahren der kleine Rudolf nach wenigen Monaten wieder genommen wurde. Dieser Verlust besiegelte ihr Unglück.
Elisabeth zieht die Tür der Schlafkammer leise hinter sich zu und öffnet die Tür der anderen Kammer. Licht fliesst ihr entgegen, Staub flimmert im Sonnenschein. Sie leistet sich diese gute Stube, obwohl es ihre Mittel kaum erlauben. Hier steht der Tisch mit den sechs Stabellen, an dem sie fast nie essen. Drüben an der Wand ist ihre dunkelgrün bemalte Holztruhe. Elisabetha Grossmann, 1816, steht drauf. Das Jahr ihrer Heirat. Ihr Vorname mit dem A am Schluss geschrieben. Dieses unnütze A hat sie schon lange weggelassen. Peter hatte sich lustig gemacht vor den Gästen über dieses vornehme A, mit dem sie seiner Ansicht nach ihren gewöhnlichen Namen aufbessern wollte. «Sie wollte höher hinaus», hatte er mit einem vielsagenden Grinsen erzählt. «Musste schliesslich froh sein, dass ich sie genommen habe», stichelt er und schlägt sich auf den Oberschenkel. Elisabeth weiss nicht, wohin sie blicken soll. «Kaum habe ich sie gekannt, hatte sie schon eines im Bauch.» Er legt die Hand auf ihren hochschwangeren Bauch. «Und seitdem hat sich das kaum geändert. Ich muss sie nur gut anschauen, und schon wölbt es sich unter ihrer Schürze. Haha. Die hätte als vornehme Dame nicht getaugt. Die ist bei mir viel besser aufgehoben.» Die Fremden schauen betreten zur Seite, Elisabeth möchte in den Boden versinken. Wieso kann sie es nicht. Wieso muss sie dableiben, jeden Tag aufs neue seinen Spott ertragen.
Das ist alles vorbei. Elisabeth setzt sich auf das Sofa am Fenster. Dieser Sonntag, der 20. ist der erste schöne Tag des Herbstmonats in diesem nasskalten Jahr. Sie will sich diesen Tag nicht verderben lassen. Die Wasserfläche unten spiegelt noch immer in der Sonne. Sie schaut in das blitzende Weissgold, bis sie die Augen vor Schmerz schliessen muss. Lichter tanzen hinter ihren Augenlidern und verbinden sich allmählich zu einer roten Fläche. Auf diesem Hintergrund wirbeln Paare durcheinander, Musik erklingt, Pechfackeln lodern.
2
Der Gasthof in Interlaken, zur Zeit des Unspunnenfestes. Vor dem Gasthof, inmitten der Nussbäume, ein roh gezimmerter Tanzboden. Farbige Lampen und Fackeln erleuchteten die Nacht taghell. Brennende Pechkränze markierten die Zugänge. Sie stand staunend davor in ihrem kurzen Rock. Sie war noch ein Mädchen, der Eingang war ihr verwehrt. Ihre Augen weiteten sich. Das hatte sie noch nie gesehen. Da tanzten nicht nur Mädchen vom Land mit jungen Bauern und Handwerkern. Auf dieser ländlichen Bühne vergnügten sich auch vornehme Damen und Herren. Vor ihren Augen drehte sich eine edel gekleidete Dame, eine Gräfin vielleicht, mit einem Hirten. Und daneben umfasste ein Prinz – er konnte nichts anderes sein als ein Prinz mit diesen Gewändern aus kostbaren Stoffen – mit dem Arm die Barbara, eine Küherstochter aus Brienz, die Elisabeth kannte. Die Barbara hatte die schwarze Spitzenhaube an, die ihre Tracht so richtig herausputzte, und sie lachte dem Prinzen ins Gesicht. Sie wirbelten zu der wilden Musik rundum und rundum, bis Elisabeth vom blossen Zusehen schwindlig wurde. Die Barbara nahm sich zuviel heraus. Das konnte nicht gut gehen. Der Prinz würde sie am nächsten Tag keines Blickes würdigen, wenn er mit anderen hohen Herren über den Höheweg flanierte.
Plötzlich war Leni Flück neben ihr. «Der Kehrli will gehen. Wir warten nur noch auf dich, du Träumerin!»
Ein letzter Blick auf die Tanzenden, die sich immer schneller zu drehen schienen. Elisabeth wandte sich ab. Hastig griff sie nach ihrem Korb und eilte ihrem Lehrer Johannes Kehrli und der Mädchengruppe nach. Bald würden sie am Zollhaus Interlaken in ihr Boot steigen und über den nächtlichen See nach Brienz zurückrudern.
Sie fühlte sich überhaupt nicht müde. Was hatte sie nicht alles zu erzählen zu Hause! Von diesem grossen Fest auf der Wiese bei der Burg Unspunnen. Von der Begrüssungsrede des Oberamtmanns. Von den Wettkämpfen im Steinstossen, Schwingen, Alphornblasen und Jodeln. Beim Schwingen hatte sogar ein Brienzer gewonnen, der Jakob Stähli, zusammen mit dem Peter Brog aus dem Hasli. Sie kannte ihn, einen grossen, ungeschlachten Mann, der nur selten von der Alp ins Dorf herunterkam. Eine feine Dame aus Bern hatte ihm den Siegerkranz um den Hals gelegt.
Zwischen zwei Wettkämpfen war der Auftritt ihrer eigenen Gruppe. Inmitten der vornehmen Damen und Herren trugen sie ihre Lieder vor. Besonders der Kuhreihen wurde beklatscht und die Mädchen mit ihrem Lehrer allseitig gelobt.
Am Mittag setzten sie sich im Schatten eines Baumes zu einem kleinen Imbiss nieder. Jedes Mädchen hatte im Korb etwas mitgebracht, und sie teilten alles schwesterlich. Elisabeth staunte. Ganz in der Nähe sass eine vornehme Dame, eifrig über eine Arbeit gebeugt, ein Herr neigte sich ihr dienstfertig zu. Hatte sie eine Handarbeit mitgenommen ans Unspunnenfest? Unter einem Vorwand stand Elisabeth auf und schlenderte an der Dame vorbei. Die Dame malte! Der Herr hielt ihr die Palette mit den Farben hin!
Elisabeth hastete sofort zu den anderen Mädchen zurück und flüsterte ihnen die Neuigkeit zu. Auch Schulmeister Kehrli hatte die Malerin bemerkt. Er entfernte sich einen Moment und zog Erkundigungen beim Maler Franz Niklaus König ein, dem Quartiermeister des Fests. Kehrli kam mit der Neuigkeit zurück, dass die Dame eine bekannte französische Malerin namens Elisabeth Vigée-Le Brun sei. Eine Dame, die anerkannt war als Malerin! Elisabeth blieb der Mund offen.
Der Lehrer nannte noch weitere Namen. Die Dame, die sich eben jetzt über die Skizze der Malerin beuge, sei eine Madame de Staël, eine berühmte Schriftstellerin. Man munkle auch, fuhr Kehrli fort, dass der Kronprinz von Bayern da sei, unter falschem Namen. In seiner Begleitung befänden sich zwei Prinzen und ein Baron. Es seien noch weitere Fürsten anwesend, sowie der Landammann von Wattenwyl, ein General und viele vornehme Pariser.
Elisabeth saugte diese Namen in sich auf. Zwei Namen standen für sie im Vordergrund: Elisabeth Vigée-Le Brun und Madame de Staël. Beide waren verheiratet, auch das hatte Schulmeister Kehrli in Erfahrung gebracht, und doch schienen sie so wichtig zu sein wie Männer. Sie wurden ernst genommen. Die Elisabeth Vigée setzte sich einfach so hin, um zu malen, und ein Herr diente ihr zu, schien sogar stolz darauf zu sein.
Dazu hätte ich nie den Mut, dachte Elisabeth. Lieber zog sie sich zurück, als im Mittelpunkt zu stehen. Männer waren dafür bestimmt, nicht sie. Zu Hause gab der Vater den Ton an. Er war viel älter als die Mutter, seine zweite Frau. Unter den Geschwistern war es ihr älterer Halbbruder Heinrich, der die Entscheidungen traf. Sie hatte sich nie dagegen aufgelehnt. Es war einfach so, sie wollte es nicht anders. Elisabeth brauchte jemanden, der breit vor sie hinstand, der sie schützte. Nur so fühlte sie sich sicher, nur so konnte sie bestehen.
Lange war sie unter dem Baum sitzen geblieben, als die anderen sich schon wieder unter die Leute gemischt hatten. Elisabeth beobachtete, wie der Oberamtmann ein Spässchen machte mit ein paar Bauern, die seinen Weg kreuzten. Die Bauern lachten gutmütig. Sie traute diesem Bild nicht ganz. Bald würden die Bauern wieder vor dem Oberamtmann stehen, der über sie zu Gericht sass; sie würden mehr Freiheit und Rechte verlangen, Rechte, die sie nach dem Abzug der Franzosen unter Napoleon wieder verloren hatten. Und der Oberamtmann würde keine Spässe mehr machen, sondern sie hinter Schloss und Riegel setzen. Oder täuschte sie sich? Auf dieser weiten Wiese, unter den am blauen Himmel dahintreibenden Wolken, schien alles so friedlich. Man war ein einig Volk. Die Städter schienen die Sitten und Bräuche der Bergler zu bewundern. Die Sieger des Steinstossens und des Schwingens, sie waren die Helden hier, die Stärksten und Besten. Es regnete Geschenke nieder auf die Teilnehmer: spanische Schafe, russischer Flachssamen, Gewehre, Kühergürtel, Salztaschen, Sennenkäppi, Medaillen und Liederbücher.
Elisabeth schlägt die Augen auf und setzt sich auf ihrem Sofa zurecht. Was hat sie nur wieder geträumt? Ihr Blick fällt auf das Bücherbord an der Wand. Neben der Bibel steht ein Liederbuch. Auch sie hat ein Liederbuch erhalten, damals am Unspunnenfest 1808. Die Oberen gaben sich grosszügig gegenüber den Landleuten. Und dann kam alles anders. Die Obrigkeit griff wieder hart durch, in den folgenden Jahren wurden im Oberland Aufstände niedergeschlagen. Das zweite war auch das letzte Unspunnenfest.
Doch was war ihr vorhin durch den Kopf gegangen? Die wild Tanzenden, die Wiese mit der Malerin, ein Gesicht. Der alte Baron?
Das war nochmals zwei Jahre früher, 1806. Schon damals hatte sie die Noblen kennengelernt. Sie ruderte sie manchmal mit ihrer Mutter zum Giessbach. So auch diesen vornehmen alten Herrn.
Als Baron Wilhelm von Balk hatte er sich vorgestellt. Während der Überfahrt hin und zurück hatte er sie ab und zu gemustert.
«Wie alt bist du, Mädchen?», fragte er schliesslich.
Sie erschrak ob dieser direkten Anrede, die Mutter antwortete für sie.
«Das Elisi ist bald zwölf, Herr.»
Der Herr Baron sagte lange nichts mehr. Er versank in Gedanken und schien das klare, blaugrüne Wasser des Brienzersees, das um den stetig sich fortbewegenden Kahn plätscherte, nicht mehr wahrzunehmen.
Mit wenigen, gezielten Ruderschlägen brachten die Mutter und sie den Kahn in Brienz Tracht längs ans Ufer, und der alte Herr stieg steif an Land. Er winkte die Mutter zu sich. Elisabeth spitzte die Ohren. «... zu schön, um länger Schiffermädchen zu bleiben», hörte sie ihn zur Mutter sagen, und «... vor Verführung schützen und schirmen». Was wollte er von ihr?
Das Gesicht der Mutter war angespannt, als sie dem Herrn eine Antwort für den folgenden Tag versprach und sich abwandte. Diesen verkniffenen Ausdruck hatte sie immer, wenn etwas Wichtiges anstand. Der Herr redete nun auf eine vornehme Dame ein, die am Ufer auf ihn gewartet hatte. Er deutete auf Elisabeth, die noch immer neben dem Kahn stand. Elisabeth errötete. Die Mutter nahm sie an der Hand. «Komm.» Erst zuhause, während sie Brot und Käse auf den Tisch stellte für das Abendessen, gab sie Elisabeths Drängen nach.
Der Herr Baron wolle sie vor schlechten Einflüssen schützen, erzählte die Mutter. Er schlage vor, sie in ein Erziehungsinstitut nach Bern zu bringen. Dort würde sie gute Formen lernen: wie die Leute ansprechen, wie sich bewegen. Vielleicht sogar ein bisschen Klavier spielen. Er bezahle für dieses Jahr. Es sei ihr dann freigestellt, eine gute Stellung in Russland oder im Baltikum anzunehmen, die er und die polnische Prinzessin, seine Begleiterin, gerne vermitteln würden, oder wieder nach Hause zurückzukehren.
Nach Bern in die Kantonshauptstadt? Vielleicht später sogar nach Russland? Elisabeth schwirrte der Kopf. Sie musste sich auf die Bank setzen hinter dem Esstisch. Den Lärm der kleineren Geschwister, auf die sie aufpassen musste, hörte sie an diesem Abend nur wie aus weiter Ferne. Sie liess ihnen alles durchgehen und ass fast nichts. Bern, Baltikum, Polen, Russland. Sie wusste nicht einmal, wo diese fremden Länder auf der grossen Landkarte im Schulzimmer zu finden waren. Und sie, das Elisi, war eingeladen, dorthin zu fahren. Dort zu leben.
Spät am Abend, als sie bereits zwischen Katharina und der kleinen Anna oben in der Schlafkammer lag, hörte sie unten die erregten Stimmen des Vaters und der Mutter. Sie würden die Sache bereden und entscheiden. Der Vater würde wie immer den Ausschlag geben und die Mutter sich seiner Meinung anschliessen. Elisabeth schlief ein, während sie noch angestrengt horchte und nicht wusste, auf welchen Bescheid sie hoffen sollte.
Am folgenden Nachmittag war Elisabeth bereits mit dem Baron und der Prinzessin Czartorinska unterwegs. Sie wurde gerudert diesmal, musste nicht selbst Hand anlegen. Fremd kam sie sich vor zwischen den beiden, deren Deutsch sie nur schlecht verstand. Die Kutsche über Unterseen nach Neuhaus, die Schifffahrt über den Thunersee, die Kutschenfahrt durchs Aaretal nach Bern – alles zog wie ein Traum an ihr vorbei.
Reisen hatte ihr nie Glück gebracht, auch später nicht, denkt Elisabeth, die für einen Augenblick aus ihren Gedanken auftaucht. Die Träume sind schnell zerstoben.
Im Erziehungsinstitut der Madame Baibe in Bern fühlte sie sich nie wohl. Die anderen Mädchen kicherten ob ihrer unbeholfenen Ausdrucksweise. Sie stammten alle aus der Stadt oder aus bessergestellten Familien vom Land, und Elisabeth war ein Fremdkörper unter ihnen. Zuerst machten sie sich über sie lustig, später beachteten sie Elisabeth nicht mehr. Nie durfte sie sich ans Klavier setzen. «Bauerntölpel» nannte man sie hinter dem Rücken der Erzieherinnen. Nur das Singen gefiel ihr. Ihre volle, hohe Stimme stach heraus. Für ihre Stimme bekam sie Lob von der Madame und den anderen Lehrerinnen.
Elisabeth zog sich in sich selbst zurück, und als das Jahr um war, fügte sie sich gern dem Entscheid ihrer Eltern, vorerst für einige Jahre nach Brienz zurückzukehren, um auf die Kleinen Acht zu geben.
Der Baron, der sich brieflich mehrmals nach ihrem Wohlergehen erkundigt hatte, schien enttäuscht. Er zeigte sich nie wieder in Brienz.
Zurück im Dorf, fühlte sie sich auch hier fremd. War sie in Bern das unbeholfene Bauernmädchen, so galt sie jetzt in Brienz mit ihrer Aussprache und ihrem Benehmen als Angeberin, als Möchtegern-Dame. Erst nach einem Jahr fühlte sie sich wieder daheim. Es brauchte Zeit, bis sie in der Dorfgemeinschaft wieder aufgenommen und von den anderen Schiffermädchen anerkannt wurde.
«Die schöne Elisabetha» nannte man sie schliesslich gutmütig neckend, nicht mehr spottend. Als Elisabetha war sie von Bern zurückgekehrt. Unter den vielen Susannas, Annas, Mariannas und Margarithas im Institut hatte sie sich nicht auch noch durch das fehlende Schluss-A ihres Namens herausheben wollen. Und sie behielt dieses A bei, weil nicht die gleiche Elisabeth nach einem Jahr aus Bern zurückgekehrt war.
3
Ein beharrliches Klopfen reisst Elisabeth aus ihren Gedanken. Sind die Buben von der Schule zurück? Nein, sie würden einfach hereinpoltern. Zudem hat es noch nicht acht geschlagen. Trotz ihrer Tagträume vergisst sie nie ganz die Zeit. Elisabeth zupft ihre Bluse zurecht, streicht den Rock und die Sonntagsschürze glatt. Ein Blick in den kleinen Spiegel mit Holzrand, der neben der Stubentür hängt, zeigt ihr ein leicht gerötetes Gesicht mit Linien um den Mund, die es noch vor kurzem nicht gegeben hat. Sie zupft die kleinen Löckchen um die Stirn zurecht und bemüht sich, den Rücken gerade zu halten. Ein Besuch am Sonntag, um diese Zeit. Wer kann das sein?
Sie öffnet die Tür und wird blass. Peter. Was will er von ihr. Er dreht seinen Hut hin und her in der Hand und schaut sie mit seinem gewinnendsten Lachen an.
«Was willst du?» Elisabeth hat die Tür unwillkürlich zugeschoben, sie ist nur noch eine Handbreit offen.
«Ich will die Buben abholen. Man wird doch bei seiner langjährigen Gemahlin vorbeischauen dürfen?»
«Peter, wir haben in den letzten zwei Jahren nur über das Gericht miteinander verkehrt. Ich schicke die Buben zu dir, wenn sie von der Schule zurück sind. Jetzt gehst du bitte.» Elisabeth spürt, wie ihre Stimme zittert.
Peter schiebt seinen Fuss in die Tür, die sie schliessen will.
«Jetzt sei doch nicht so. Man wird ein paar Worte zusammen reden dürfen. Zählen die alten Zeiten denn gar nicht?»
Diesmal errötet Elisabeth, und sie ärgert sich über sich selbst. Wieso gelingt es ihr auch jetzt nicht, diesem Mann entschlossen gegenüberzutreten. Ihm die Tür zu weisen. Statt sie ihm weiter zu öffnen, was sie jetzt tut. Er setzt noch immer seinen Willen bei ihr durch. Wenn der alte Kirchmeyer Grossmann wüsste, dass sie Peter wieder bei sich einlässt. Nach all diesen Gerichtshändeln.
Peter schiebt sich an ihr vorbei. Er tritt unter die Tür der guten Stube, schaut sich um und setzt sich ohne weiteres auf das rote Sofa.
«Schön hast du es hier», bemerkt er. «Hast du das Sofa von meinem Geld gekauft?»
«Das Sofa ist nicht neu, das kann man gut sehen. Es gehörte meinem Schwager Gabriel Baud und wurde beim Neumöblieren des Hotels in Meiringen überflüssig», erklärt Elisabeth hastig. Wieso muss sie sich schon wieder gegen ihn verteidigen? Wieso bringt es dieser Mann immer fertig, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen?
«Aha, alles klar, die Familie hält zusammen wie immer. Die Schwester in Meiringen, Hoteliersgattin, schenkt das passende Sofa für die neue Wohnung. Die Schwester in Brienz, Schnitzlersgattin, liefert günstige Holzwaren für den Laden der Schwester. Der Schwager in Brienz, Heinrich Thöni, vertritt die Elisabetha bei der Scheidung. Der Brienzer Kirchmeyer, Heinrich Grossmann, erreicht vor Gericht eine fürstliche Versorgung seines Schützlings. Derweil der abgeschiedene Mann seine letzten Batzen zusammenkratzt, um der Frau Gemahlin den Unterhalt zu sichern.»
«Peter, ich werde nicht auf die alten Geschichten eingehen. Ich hatte meinen Teil zugut, und das Gericht hat entschieden. Du hast dir sehr lange Zeit gelassen mit dem Zahlen und hast mich in Schwierigkeiten gebracht. Diese zwei Kammern sind keine Fürstengemächer. Du weisst, dass ich kaum zurechtkomme. Mein Leben ist nicht leichter geworden.» Elisabeth hat sich auf eine Stabelle am Tisch gesetzt, damit sie nicht neben ihm auf dem Sofa sitzen muss.
Er beugt sich vor. «Eben, für dich ist es nicht leicht, und mir fehlt die Frau im Haus. Komm doch mal vorbei, ich tu dir schon nichts, haha. Alles schön bei Tageslicht, unter den Augen der Leute. Schliesslich haben wir manches zusammen durchgemacht. Der kleine Rudolf, du erinnerst dich?»
Er hat ihren wunden Punkt getroffen. Den Tod des kleinen Ruedi hat sie nie verschmerzt. Sogar der Verlust der grossen Elisabeth, ihrer ersten Tochter, die jetzt schon fast dreizehnjährig wäre, hat sie nicht gleich bewegt. Vielleicht traf es sie so empfindlich, weil sie damals unglücklich war. Das Leben tat sich wie eine grosse Schwärze vor ihr auf, es drohte sie zu verschlingen.
Sie wusste vor drei Jahren schon, dass sie sich von Peter trennen musste, wenn sie nicht zugrunde gehen wollte. Ruedis Sterben leistete ihrem Entschluss zur Trennung Vorschub. Der jüngste Spross ihrer Familie war todgeweiht, sie hatten keine Zukunft mehr, es war wie ein Zeichen gewesen. Aber dann sass er in dieser letzten Nacht bei ihr, am Sterbebett des fiebernden Söhnchens. Er hatte für einmal nicht zuviel getrunken und auf seine dummen Sprüche verzichtet, mit denen er sie vor anderen Leuten in Verlegenheit brachte. Er sass einfach nur da, hielt ihre Hand in der seinen und schien den Ruedi, an dem er mehr als an den älteren Söhnen hing, zu betrauern wie sie selbst.
Aber am nächsten Tag war er in der Wirtschaft wie immer. Die Beerdigung hatte er schon organisiert, ein einfaches Tannenholzsärglein bestellt. Für ihn ging das Leben weiter, er trank an diesem Tag mehr als sonst, zahlte Runden bis spät in die Nacht, trank übermässig und wurde noch am gleichen Abend gebüsst wegen Überwirtens, weil er wieder einmal die Wirtschaft nicht rechtzeitig geschlossen hatte.
Für sie stand die Zeit still ab jener Nacht. Sie schleppte sich lustlos durch die Tage, von seinem beissenden Spott verfolgt.
Und doch, er hatte damals um Ruedi getrauert, sein Tod traf ihn tief, sie hatte es gespürt.
Elisabeth steht auf und holt die Flasche Kirsch vom Küchenbuffet und zwei Gläschen. Sie schenkt ihm und sich selbst ein. Wartet er noch immer auf eine Antwort? Er schaut sie an, stürzt seinen Kirsch hinunter. Sie zögert die Zeit hinaus mit kleinen Schlucken, dreht das Glas in der Hand.
Plötzlich ein Poltern auf der Treppe, die Buben stürzen herein. Als sie sich umdreht, sieht sie, dass auch die kleine Elisabeth aufgestanden ist. Sie steht in ihrem Nachthemd in der Tür zur guten Stube und schaut den Vater an. Wie lange schon?
Sie schiebt das Mädchen zurück in die Schlafkammer, es soll sich anziehen. Die Buben setzen sich zu einem zweiten Frühstück, sie sind schon wieder hungrig. Etwas erstaunt haben sie vorhin geblickt, als sie den Vater in der guten Stube sitzen sahen, aber sie sagen nichts. Es geht laut zu und her am Tisch, und Elisabeth ist es recht. Auch Elisi setzt sich zu den anderen, Peter schaut von der Stube aus der fröhlichen Frühstücksrunde zu. Was denkt er dabei?
Als die Buben fertiggegessen haben, steht er mit dem Hut in der Hand in der Küche. «Kommt mit», fordert er die beiden älteren auf, die gewohnt sind zu parieren und sofort aufstehen. Peter beugt sich an der Tür zu Elisabeth vor. «Und dich erwarte ich gelegentlich bei mir im Stadthaus», flüstert er ihr ins Ohr, bevor er den Hut aufsetzt und die Tür hinter sich schliesst.
4
Vor dem Mittag liest Elisabeth mit Fritz und Elisi in der Heiligen Schrift. Doch die Kinder, die sich von den Geschichten in der Bibel oft fesseln lassen, rutschen diesmal nur unruhig auf ihren Stühlen herum. Der sechsjährige Fritz späht immer wieder nach draussen, zu schön ist das Herbstwetter an diesem Septembertag. Sie erzählt die Schöpfungsgeschichte dennoch zu Ende. Wenn sie schon kaum mehr in die Kirche geht, weil sie sich dort geächtet fühlt seit ihrer Scheidung, will sie doch zu Hause das Bibellesen pflegen.
Nach dem Mittagessen gibt sie dem Drängen der Kinder nach. Sie setzt ihren Hut auf, und sie gehen spazieren, einfach so, müssig wie die vornehmen Leute. Der Aare entlang laufen sie in der Goldey bis zur Zollbrücke beim alten Zollhaus. Dann flanieren sie am Höheweg unter den Nussbäumen, inspizieren die vorbeifahrenden Kutschen und mustern die vielen Fremden.
Was ist nicht alles gebaut worden in den letzten Jahren! Elisabeth kann sich noch gut erinnern an Interlaken und Unterseen 1808, beim zweiten Unspunnenfest. Eigentliche Gasthäuser waren damals nur das Stadt- oder Kaufhaus in Unterseen und das Gasthaus Interlaken neben dem Kloster. Die vielen Besucher wurden in Privathäusern untergebracht. Viele Familien übernachteten auf dem Heuboden und stellten den Fremden ihre herausgeputzten Kammern als Nachtlager zur Verfügung. Die Fremden waren beeindruckt von der Gastfreundschaft der Einheimischen und natürlich von den Schneebergen, den Wasserfällen, Wäldern und Seen der Umgebung. Sie trugen die Kunde von dieser schönen Gegend in die Welt hinaus, und es kamen immer mehr Fremde. Pensionen schossen förmlich aus dem Boden.
Wie Perlen an einer Schnur sind die Gebäude aufgereiht, an denen sie entlangschlendern: die englische Kapelle, die Kirche, das Schloss als Sitz des Oberamtmanns, das Gasthaus Interlaken, dort, wo am Unspunnenfest die Tanzbühne aufgestellt war, die Pensionen Greyerz, du Casino, Müller, Hofstetter, Belvédère und Seiler.
Durchs Dorf Aarmühle und über die Aareinsel Spielmatte kehrt sie mit den Kindern zurück ins Stedtli. Auf der Schalbrücke, gegenüber ihrer kleinen Wohnung Unter den Häusern, bleibt Elisabeth einen Moment stehen. Sie liebt diesen Blick auf das Stedtli: links das Schloss Unterseen, anschliessend die dunkelbraune Häuserzeile mit ihrer Wohnung, dahinter das breite Dach des Stadthauses und rechts die Kirche und der Kirchturm. Wie eine Kappe ist das Dach über den hohen, spitzen Turm heruntergezogen.
Beidseits der Schalbrücke rauschen die Aarefälle. Diese stauen die Aare seit langer Zeit, um die Fische ins Fischfach am Ende der Schwelle zu lenken. Elisabeth erinnert sich dunkel an einen alten Streit zwischen dem Stedtli Unterseen und den Mönchen des Klosters Interlaken, von dem ihr Schwiegervater, Peters Vorgänger als Stadthauswirt, einmal erzählt hatte. Die Interlakner Mönche stritten sich mit den Unterseener Bürgern während Jahrhunderten um die reiche Fischausbeute. Jede Partei glaubte, sie allein besässe das Anrecht auf die Fische. Mit dem Bau der Aareschwelle lenkten die Mönche die Fische auf ihre Seite und entschieden den Streit für sich.
Zurück in ihren zwei kleinen Kammern, besorgt Elisabeth noch einige dringend nötige Flickarbeiten. Sie kann nicht immer Rücksicht nehmen auf die Sonntagsruhe. Morgen wird sie wieder früh im Laden stehen.
Erst nach acht Uhr abends hat Elisabeth wieder einige Minuten für sich allein. Fritz und Elisi schlafen, sie hat die Kerze ausgeblasen, die sie ihnen zum Einschlafen brennen liess. Mit dem kleinen Öllämpchen hat sie sich in die gute Stube gesetzt in der Absicht, nochmals in der Heiligen Schrift zu lesen, diesmal allein und ohne Unterbrechungen durch die Kinder. Die Bibel liegt offen vor ihr, aber sie hat nach wenigen Zeilen den Faden verloren, die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Sie streicht mit den Fingern über die weich gewordenen Seiten der alten Bibel, ein Geschenk ihrer Mutter. Seit ihrer Scheidung hat sie mit der Mutter kaum mehr Kontakt.
Ach, manchmal wünscht sie, das Rad der Zeit zurückdrehen zu können. Ihre Mutter hatte ihr die Bibel zur Verlobung geschenkt. Zur Verlobung nicht mit Peter Ritter, sondern mit dem anderen, dem Neuenburger Professor, an dem ihre Gedanken noch immer hängen. Sinnlos, natürlich ist es völlig sinnlos. Auch das Zurückdrehen der Zeit würde nichts ändern am Ausgang dieser Liebschaft. Er konnte nicht zu ihr stehen oder wollte es nicht. Er war zuwenig stark. Die unterschiedliche Herkunft und Bildung – alles sprach gegen sie beide. Es durfte nicht sein.
Elisabeth fährt mit den Fingern durch die Flamme, hin und her, hin und her. Sie starrt in das Licht, hält den Finger in die Flamme, sie muss es einfach tun. Sie zieht den schmerzenden Zeigfinger zurück, springt auf und rennt in die Küche, hält ihn ins kalte Wasser im Zuber und schüttelt den Kopf über sich selbst. Wieso hat sie das nur getan? Sie mustert die Brandblase an ihrem Finger, steckt ihn nochmals ins kalte Wasser. Morgen wird er ihr weh tun, wenn sie den Fremden die Holzlöffel, die kleinen hölzernen Chalets und Gemshörner zeigt und das Geld abzählt.
Aber sie weiss tief innen, wieso sie es tun musste. Sie will spüren, dass sie noch lebt. Auf schmerzhafte Art muss sie es spüren, sich herausreissen aus ihren Gedanken. Vielleicht ist sie wirr im Kopf, Peter würde es bestimmt behaupten. Sie kann nicht alles erklären, all ihre Handlungen, so wie es von einem erwartet wird. Manchmal weiss sie nicht mehr, wer sie ist. Sie ist so allein und hat niemanden, in dem sie sich spiegeln könnte. Sie war schon lange allein, bevor sie von Peter weggegangen ist. Es war alles zu viel für sie. Und Ruedis Tod war das Übermass; dieser Verlust hat ihre Seele zum Überlaufen gebracht. Jetzt ist sie manchmal nicht mehr so, wie man sein sollte. Das Leben hat sie niedergezwungen. Es spannte sie auf ein Folterrad, das nicht nur ihre Schultern, sondern auch ihre Seele verkrümmte.
Es hatte so anders begonnen. Sie zieht den Finger aus dem Wasser, er ist eiskalt, sie spürt den Schmerz nicht mehr. Ruhig geht sie in die Stube zurück, setzt sich wieder an den Tisch, schaut einen Moment in die Flamme des Lämpchens, dann in die schattigste Ecke der Kammer.
Erst war er nur ein Fremder gewesen wie alle anderen. An einem Juliabend 1813 war er ihr erstmals begegnet. Das weiss sie nur von ihm, denn sie konnte sich nicht erinnern. Sie hatte mit ihren Schiffskameradinnen Fremde zum Zollhaus in Interlaken gerudert. Dort angelangt, stützte sie sich stehend aufs Ruder und verabschiedete ihre Gäste mit ein paar freundlichen Worten. Er beobachtete, wie sie lächelnd und von der Anstrengung errötet dastand, und ihr Bild prägte sich ihm unauslöschlich ein. So erzählte er es später.
Er – das war Abram François Pettavel, Ratsherren- und Notarssohn aus Neuenburg. Sie hatte ihn François genannt oder Professor. Er war wirklich Professor, obwohl er noch so jung war, erst 22, und nur etwas mehr als drei Jahre älter als sie. Er unterrichtete am Neuenburger Gymnasium Latein und Griechisch. Vorher hatte er in Zürich und Genf studiert und später im fernen Berlin doktoriert – über einen griechischen Philosophen namens Plato. Das erfuhr sie alles später und schrieb es sich auf. Sie wollte sich nicht blamieren vor ihm. Es war ihr alles so fremd. Sie war damals froh, hatte sie das Jahr bei Madame Baibe durchgestanden. Dort hatte sie etwas Französisch gelernt und, was ihr jetzt sehr zustatten kam, die Umgangsformen der Vornehmen.
Anderntags war François mit seinen Bekannten, einem Zürcher Staatsanwalt und seinen Söhnen, nach Brienz gefahren. Als sie am Abend mit ihren Kameradinnen im Gasthaus «Bären» Lieder vortrug, war er unter den Zuhörern. Feingliedrig, mittelgross, blondes Kraushaar, ein empfindsamer Zug um den Mund – diesmal fiel er ihr auf. Wie zufällig kreuzten sich ihre Augen und fanden sich einen Moment, bevor sie ihren Blick senkte. Es geziemte sich nicht, einen fremden Herrn anzustarren. Hatte einer der Söhne des Gerichtsherrn dieses Augenspiel beobachtet? Frech grinsend näherte er sich ihr. Er fasste sie am Arm – um sie an sich zu ziehen oder ihr etwas ins Ohr zu flüstern? Sie weiss es nicht. Sie riss sich los und lief aus der Wirtsstube. Erst daheim fasste sie sich wieder. Hatte sie mit falschem Benehmen diese Zudringlichkeit herausgefordert? Ausser der kurzen Augenbegegnung mit dem blonden Herrn war sie sich keiner Verfehlung bewusst.
Sie verspürte kein Bedürfnis, zu den anderen Sängerinnen zurückzukehren.
Am nächsten Tag hörte sie, dass die Mädchen noch mit Wein und einem Dessert bewirtet wurden. Am späten Abend hatten sie die Gäste mit einem Lied an der Ländte verabschiedet: Ha a-n-em Ort es Blüemeli g’seh, es Blüemeli roth und wyss ...
Die Melodie und die Worte, erzählte François, waren bis in sein Innerstes gedrungen. Sie hatten sich dort eingegraben zusammen mit ihrem Bild, dem Porträt der «belle batelière».
Dieses Bild hatten damals auch viele Maler festgehalten. Wer war nicht alles bei ihr gewesen. Franz Niklaus König, Maler aus Bern, der etliche Jahre im Schloss Unterseen gelebt hatte, wurde als erster vorstellig, um sie für ein Porträt zu gewinnen. Das war etwa 1811. Die Mutter und der Vater willigten ein, weil König bekannt war als Quartiermeister der Unspunnenfeste 1805 und 1808. Mit Schwefelhütchen und buntem Halstuch sass sie ihm, die Hände in den Schoss gelegt, und er erzählte ihr bei diesen Sitzungen manches von den beiden Festen und den illustren Gästen, das ihr noch nicht zu Ohren gekommen war.
Die Malerin Elisabeth Vigée-Le Brun sei damals bei ihm im Schloss untergekommen. Die Madame habe im ganz neuen Himmelbett mit den grünen Vorhängen übernachtet. Auf Spaziergängen habe er ihr Unterseen und die Umgebung gezeigt, und sie sei begeistert gewesen von dieser malerischen Landschaft. Nach ihrer Skizze vom Fest hätten er und ein anderer Maler das grosse Ölbild des Unspunnenfests 1808 gemalt.
König beschrieb ihr das Bild so gut, dass sie es vor Augen hatte. Sogar Madame Vigée war darauf verewigt und der malschachtelhaltende Graf, und Madame de Staël und ihr Begleiter. Aber auch die einfachen Leute waren abgebildet.
Königs Porträt von ihr, der knapp Siebzehnjährigen, gefiel Elisabeth. So hübsch hatte er sie dargestellt, so natürlich. Und viel zu schön, schien ihr.