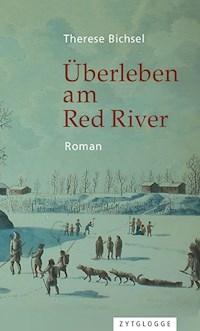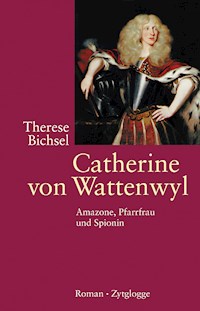Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Linden hatten schon immer eine besondere Bedeutung. Uralt ist die Linde von Linn (AG). Der Roman greift sieben Schicksale aus verschiedenen Zeiten auf: Magdalena (1348) und Samuel (1668) fanden in Pestzeiten Schutz und Trost unter dem Baum. Die Magd Elsbeth, ledig und schwanger, suchte dort 1708 nach einem Ausweg. Hans Jakob versammelte 1817 seine Auswanderer unter der Linde, Lili lernte 1923 dort ihren Mann kennen, Jürg hilft bei der Baumsanierung 1979, Susann besucht den Baum in der Gegenwart. Geschickt verwebt die Autorin Geschichte und Fiktion zu einem Episodenroman mit der Linde im Zentrum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Karte
Impressum
Titel
Susann, 2021
Magdalena, 1349
Susann, 2021
Samuel, 1668
Susann, 2021
Elsbeth, 1708/1709
Susann, 2021
Hans Jakob, 1817
Susann, 2021
Lili, 1923/1932/1943
Susann, 2022
Jürg, 1979
Susann, 2022
Nachwort
Dank
Literatur / Quellen
Über die Autorin
Backcover
Therese Bichsel
Unter der Linde
Autorin und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Thomas Gierl Korrektorat: Anna Katharina MüllerUmschlagbilder: Therese BichselUmschlaggestaltung: Isabelle BreuVorsatz: Landeskarte, Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopoeBook-Produktion: 3w+p, Rimpar
Therese Bichsel
Unter der Linde
Die Linde Linn und ihre Menschen einst und jetzt
Roman
Für Menschen, die die Faszination für alte Bäume teilen – und speziell für alle, die je unter der Linde saßen, und jene, die dort noch sitzen werden ...
«Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt.»Khalil Gibran «Sand und Schaum» «In ihren Wipfeln rauscht die Welt, ihre Wurzeln ruhen im Unendlichen ...»
Susann, 2021
Ende Mai
Endlich wieder Sonne im Gesicht nach dem vielen Regen. Die Strahlen wärmen ihre Haut. Sie beugt sich über den Lenker des E-Bikes, das sie in der Innenstadt gemietet hat, hält Ausschau nach dem Veloweg, folgt ihm. An diesem Freitag hat sie ein Ziel.
Die Marktstände des Wochenmarkts von Brugg tauchen auf. Sie steigt ab, flaniert an den Auslagen vorüber, kann sich als Farbenliebhaberin nicht sattsehen am Purpurrot der Radieschen, am vollen Rot der Erdbeeren und Rotgrün der Rhabarberstängel. Ihre Augen wandern weiter zum gebrochenen Weiß des Blumenkohls und des Spargels, zum hellen Grün der Blattsalate und dunklen Grün der Mangoldblätter, Braun der Morcheln und Goldgelb des Honigs. Was für ein Farbenfest nach all dem Regengrau in diesem Mai! Die Bäuerinnen der Gegend preisen ihre Waren an, tauschen sich mit den Kundinnen aus. Scherzworte fliegen hin und her, man kennt sich. Gern würde Susann zugreifen, sie hat sich aber eine Tour vorgenommen, kann die Velotasche jetzt nicht mit Gemüse füllen. Die rote Farbe des Hauses gegenüber fällt ihr auf – das Hotel-Restaurant heißt passend Rotes Haus.
Sie schwingt sich wieder auf den Sattel, folgt der Signalisierung, gelangt endlich über die Aare, die hier viel weiter ist als in Interlaken, blaugrün und mächtig fließt sie dahin. Sie fährt durch das Dorf Umiken, der Weg steigt an, irgendwo liest sie Galgenacher, eine Ortsbezeichnung, die sie unangenehm berührt, dann aber folgen Orte mit den versöhnlichen Namen Hafen und Ursprung, Wiesen und Wälder ziehen sich der Straße entlang. Einzelne Bauernhöfe und Weiler tauchen auf und schließlich nach verschiedenen Steigungen und Biegungen das Ortsschild Bözberg. Das muss die Passhöhe sein. Bären heißt das Gasthaus, das aus der Zeit gefallen wirkt und geschlossen ist, wohl schon seit Langem.
Einen Moment überlegt sie, was sie hier will. Der Sinnspruch fällt ihr ein, der ihr gestern beim Blättern in einem Buch begegnet ist: «Ich komme, ich weiß nicht, von wo? Ich bin, ich weiß nicht, was? Ich fahre, ich weiß nicht, wohin? Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.» Heinrich von Kleist hatte diese Zeilen bei seinem Aufenthalt in Thun an einem Haus entdeckt. Nachdenklich hat sie das Buch weggelegt. Wie soll man wissen, wer man ist, woher man kommt, wohin man geht? Meist stellen sich die großen Fragen nicht, man kommt und geht fraglos.
Die Passhöhe ist menschenleer. Früher war der Bözberg eine wichtige Verbindung zwischen Basel und Zürich, hat sie vorhin auf dem Smartphone gelesen. Wo sind all die Leute hin? Susann schließt die Augen, hört Pferdegetrappel, Wiehern, das Knarren von Kutschenrädern, Knallen von Peitschen, «Hü-hott»-Rufe, ein Stimmengewirr vor der Wirtschaft, es wird angestoßen. Sie öffnet die Augen, blickt auf die kaum befahrene Straße und das verlassene Gasthaus, das schon lange keinen Gast mehr beherbergt hat, und besteigt von Neuem das Fahrrad.
Vieles ist ungewiss, Fröhlichkeit vielleicht fehl am Platz. Aber Neugier? Neugier darf sein. Sie ist 57 und immer noch neu-gierig. Bis jetzt hat sie über das Wort nie nachgedacht: Aber ja, sie ist gierig auf Neues. Neugier packt sie, wenn sie am Morgen im Laden die frisch angelieferten Bücher auspackt, die Umschläge mustert, blättert und den unverwechselbaren Geruch des bedruckten Papiers einatmet. Oder wenn sie an einem Ferienort ankommt. Oder wenn jemand eine Geschichte erzählt.
Jetzt ist sie neugierig auf die Linde und folgt dem Wegweiser nach Linn. In einem Artikel ist sie auf die Linde Linn gestoßen, deren Alter man auf bis zu 800 Jahre schätzt. Die Gründung der alten Eidgenossenschaft 1291? Die Linde war vielleicht schon da, ein kleiner, zäher Baum. Die mittelalterliche Pest, die sich 1348/49 in Europa und auch in der Schweiz ausbreitete? Die Linde war fast sicher schon da. Unglaublich, sich diese Zeitläufte vorzustellen, in ihrem Kopf rauscht es. Sie radelt durch den Wald auf die Wiese hinaus.
Die Linde taucht auf, hinter einem hellgrünen Gerstenfeld. Der Baum wird immer größer und stattlicher, je näher sie ihm kommt. Sie stellt das Velo neben dem Autoparkplatz ab und nimmt ihr Ziel in Augenschein.
Da bin ich, Linde, weiß nicht woher, weiß nicht, wohin. Mir scheint aber, dass das in deiner Gegenwart nicht zählt. Du bist da, ein alter, mächtiger Baum, spendest Schatten in der hellen Frühlingssonne, breitest deine Äste über den Besuchern aus, ich darf mich bei dir ausruhen.
Sie gleitet mit der Hand über die weichen Gerstenähren des Ackers, nähert sich dem Baum. Der Stamm der Linde ist unglaublich breit, knorrig, mit Schrunden übersät. Im Zeitungsartikel waren ein Mann und eine Frau abgebildet, die den Baum umarmen und sich an ihn klammern. Jetzt spürt sie das gleiche Bedürfnis, sie möchte sich an den Stamm lehnen, ihn spüren. Sie wird es nicht tun, nicht jetzt. Die Bänke unter dem Baum sind besetzt, die Leute betrachten die Neuankömmlinge, sie will sich nicht lächerlich machen. Alles hat seine Zeit. Jetzt wird sie erst einmal ihr Picknick auspacken.
Auf einer Bank sitzt ein einzelner Mann. Sie fragt ihn, ob das andere Ende der Bank frei sei, er nickt abwesend. Sie packt ihr Sandwich aus, hofft, dass ihn das Rascheln des Papiers nicht stört. Es ist aber sowieso recht laut unter der Linde, die Leute essen und sprechen durcheinander. «So schlimm wie die Pest im Mittelalter war Corona niemals», sagt eine Frau. «Es war schlimm genug», meint ein Mann, «sogar die Linde haben sie zu Beginn der Pandemie abgesperrt.» Die Gespräche drehen sich nun ausschließlich um die Linde. Und von der Habsburg wird gesprochen, die von hier zu sehen sei.
«Können Sie mir die Habsburg zeigen?», fragt sie den Mann am anderen Ende der Bank. Er hat graumelierte Haare, trägt Brille, ist in Gedanken versunken, wahrscheinlich stört sie ihn.
Er erhebt sich, geht ein paar Schritte über die Wiese, winkt sie zu sich. «Da drüben auf dem Hügelzug ist sie, grau, eine Trutzburg. Sie ist so alt wie die Linde. Die beiden stehen sich schon ewig gegenüber, nur durch wenige Kilometer Luftlinie getrennt.»
«Die Burg wirkt abweisend.»
«Im Sommer kann man sie besichtigen, sie beherbergt ein Museum. Jetzt ist sie noch geschlossen. Fahren Sie mit dem Auto hin – die Aussicht ist gut, man kann von dort auch die Linde erkennen.»
«Ich bin mit dem Fahrrad da, so schnell komme ich nicht zur Burg.»
Er zuckt die Achseln, sie setzen sich wieder.
Susann nimmt ihr gekochtes Ei hervor, merkt, dass sie den Salzstreuer vergessen hat, fragt ihn nach Salz. Etwas widerwillig zieht er eine Plastikschale mit Esswaren aus seiner Tasche und überreicht ihr seinen Salzstreuer. Sie würzt ihr Ei, gibt ihm das Salz zurück, das er für seine Tomaten braucht. Schweigend essen sie.
«Woher kommen Sie?», fragt er schließlich.
Die Frage erinnert sie an Kleist, ist aber ganz einfach gemeint. «Aus dem Kanton Bern, von Interlaken.»
«Was bringt Sie hierher?»
«Die Linde, was sonst? Ich habe in einer Zeitschrift über sie gelesen. In meiner kleinen Buchhandlung in Interlaken habe ich kein Buch gefunden zu diesem Baum. Sie sind auch wegen der Linde hier, nehme ich an?»
«Natürlich. Meine Frage vorhin war dumm. Ich kenne die Linde schon lange und komme oft hierher, fast immer an Freitagen.» Seine Augen sind klein hinter den Brillengläsern, er blinzelt.
«Der Freitagsmann», sie lächelt. «Und ich bin die Freitagsfrau, weil dies mein freier Tag ist, nur Freitag und Sonntag arbeite ich nicht in der Buchhandlung.» Sie erwartet, dass er von seiner Arbeit spricht, das tut er aber nicht. Er versorgt seine Plastikschale, lehnt sich zurück. Fällt sie ihm lästig? Sie erhebt sich, räumt ihre Sachen in die Tasche. «Ich fahre den Berg hoch, um die Linde von oben zu sehen. Wenn ich zurück bin, sind sicher alle Leute weg.» Einige Bänke sind bereits leer, das Stimmengewirr ist leiser geworden.
«Es ist eine gute Idee, auf den Linnerberg zu fahren, Sie werden die Aussicht genießen. Ich bin aber wohl noch da, wenn Sie zurückkehren, Sie werden die Linde nicht ganz für sich haben.» Er mustert sie. Herausfordernd? Gleichgültig?
«Ich heiße Susann. Ich teile die Linde gern mit anderen, habe kein Anrecht auf sie.»
«Mein Name ist Georg – ein altmodischer Name, ich weiß.»
«Vielleicht sehen wir uns noch, Georg.» Sie besteigt ihr Bike, fährt mühelos den Berg hinauf, der, wie sie jetzt weiß, Linnerberg heißt. Die Linde wird kleiner, je höher sie gelangt, sie gleicht sich den beiden anderen Bäumen in der Nähe an, auch dies wohl Linden, aber jüngere Bäume. Susanns Blick schweift über die Landschaft, Felder, Wälder und Wiesen breiten sich vor ihr aus, soweit das Auge reicht, vom Dorf Linn, das sie noch besuchen will, sind nur die Ziegeldächer zu sehen. Sie kommt in einen Laubwald und fährt immer weiter bergauf. Das Sträßchen ist nicht mehr geteert, das Velo rutscht. Sie hofft, aus dem Wald herauszukommen, hofft auf einen Blick vielleicht bis zum Schwarzwald. Oder liegt sie falsch, ist dieser von hier nicht zu sehen? Sie erfährt es nicht, denn es gibt keinen Ausblick, sie bleibt im Wald gefangen, dreht schließlich um, saust die Kurven hinunter und aus dem Wald hinaus, nähert sich den drei Linden. Die alte Linde macht sich breit und steht im Zentrum, nur ein einziger Mensch ist dort noch zu sehen. Georg.
Sie stellt das Bike hinter der Linde ab. Die Sonne brennt heiß wie im Sommer, sie ist müde und sehnt sich nach dem Baumschatten. Sie geht nicht zu Georg, sondern auf die andere Seite, um den Baum zu umarmen. Sie will nicht, dass er das sieht. Sie breitet die Arme aus, umfängt den rissigen Stamm, lehnt ihre Stirn an ihn, fasst mit den Händen in seine Schrunden, schließt die Augen. Eine ganze Weile bleibt sie so, löst sich dann langsam und öffnet die Lider. Georg steht in einigem Abstand zu ihr und schaut in die Weite, hat sie wohl beobachtet. Der Wind streicht kühl über ihre Arme, sie fröstelt.
Er tritt zu ihr. «Hier ist fast immer Wind, oft die Bise, vom Juratrichter begünstigt.»
Ihre Arme sind von Gänsehaut überzogen, sie tritt aus dem Schatten in die Sonne, mustert den Baum. «Die mächtigen Wurzeln erinnern an Elefantenfüße. Der Stamm verzweigt sich in so viele Teile.» Sie geht um die Linde herum, mehrmals, zählt laut, kommt auf sechs Stammteile, dann acht, schließlich sieben.
«Es sind sieben Stämme», bestätigt er. «Die Linde ist uralt und durch ihre Lage auf der Kuppe fast ständigem Wind ausgesetzt. Vielleicht haben Wind und Wetter den Baum gestärkt, er ist nicht verzärtelt, ist Widerstand gewohnt. Sturm Lothar entwurzelte viele Bäume um die Jahrtausendwende, die Linde hielt stand. Früher hat sich die Dorfjugend im hohlen Innern vergnügt. Das ist nicht mehr möglich, zum Glück.»
«Wird der Baum gepflegt, braucht er Hilfe, um zu überleben?»
«Die Linde ist stark, sie erneuert sich ständig. Wenn man zu viel eingreift, nimmt man dem Baum die Eigenständigkeit. Das war früher der Fall, sie schnitten zu viel an ihm herum, verschlossen die Wunden mit Holzschutzmittel und sicherten einzelne Baumteile mit Verstrebungen.» Er zeigt nach oben, im Blätterwirrwarr nimmt sie dünne Stahlseile wahr.
«Bist du Baumpfleger, dass du das alles weißt?»
«Ich bin Ingenieur, baue Brücken.» Georg schaut auf seine Uhr. «Meine Zeit bei der Linde ist um, ich muss mich beeilen.» Er kramt die Schlüssel hervor, blickt zu ihr. «Vielleicht ist die Freitagsfrau an einem anderen Freitag wieder hier?»
«Vielleicht», antwortet sie überrascht und fügt an: «Im Juni bin ich in den Ferien.» Sie fragt sich sofort, warum sie das sagt, sie ist nicht den ganzen Juni weg.
«Und ich bin im Juli unterwegs. Also wird es möglicherweise August», sagt er leichthin und ist schon bei seinem grauen Auto, winkt ihr zu, steigt ein und fährt los.
Susann setzt sich auf die Bank, wo sie das Picknick eingenommen haben, und schaut über das Gerstenfeld in seinem fast unwirklichen Frühlingsgrün. Die Ähren schimmern in der Sonne und bewegen sich im Wind, sie glaubt, ihren Geruch zu riechen.
Stimmen nähern sich, drei sportliche Velofahrer ohne E-Antrieb bewältigen die letzte Steigung, legen die Räder und Helme ab, setzen sich auf eine Bank, trinken aus ihren Flaschen und unterhalten sich über ihre sportliche Leistung. Ein Auto fährt auf den Parkplatz, zwei ältere Frauen steigen aus, umrunden bewundernd die Linde, setzen sich, kommen mit den Sportlern ins Gespräch, diskutieren das Alter des Baums.
Sie erhebt sich, will endlich Linn besuchen, schlägt den Weg hinunter ins Dorf ein. Stattliche Häuser säumen die Straße, ehemalige Bauernhäuser, geschmackvoll renoviert. Eine Tafel erklärt, dass hier vor 200 Jahren Holzhäuser standen, der Bözberg sei schon im Mittelalter besiedelt gewesen, für den Hausbau Holz, Stroh und Lehm verwendet worden. Ein zweiteiliger Brunnen plätschert beim ehemaligen Milchhaus, gegenüber steht ein großer Hof mit gerundeten Stalltüren. Pfingstrosen, Schwertlilien und Glyzinien blühen in den Gärten des schmucken Dorfes, das allerdings keinen Laden und keine Wirtschaft vorweisen kann. Durstig geht sie zur Linde zurück, ihre Flasche ist bereits leer.
Die Besucher sind verschwunden, sie setzt sich noch einmal unter den Baum, auf einen seiner Elefantenfüße. Die Lindenblätter rascheln, der Wind hat zugelegt, er biegt die Gerstenähren, zeichnet Muster in die Felder. Das Blätterdach über ihr ist dicht, auf dem Lindenfuß fühlt sie sich sicher.
Zeitlos ist der Baum, zeitlos das Dorf. Menschen sind gekommen, haben sich hier getroffen und sind gegangen, über Jahrhunderte hinweg. Der Baum war schon immer ein Treffpunkt. Sie spürt seine Stärke im Rücken, den Wind im Haar.
Magdalena, 1349
Der Himmel bleicht aus. Ein Hahn kräht. Die Habsburg zeichnet sich schwarz ab in der Ferne. Sie bekreuzigt sich vor dem Heiland auf dem Kreuz am Wegrand. Das Gras ist kühl und nass unter ihren Füßen an diesem Morgen im Herbstmonat. Bald kommen die Bauern auf die Felder. Sie will nicht, dass man sie entdeckt. Die Kühe hat sie bereits gemolken, sie weiden beim Hof.
Die Sonne schiebt sich über den Horizont, nimmt alles in Besitz mit ihren hellen Strahlen. Ergriffen betrachtet sie diese Herrlichkeit. Dann erträgt sie das gleißende Licht nicht mehr, dreht sich um. Der Baum mit seinem dichten Blätterdach ist überschwemmt vom Licht. Die Linde steht schon so lange hier, dass niemand von ihrem Ursprung weiß, auch die Alten nicht. Sie nähert sich dem Baum, lehnt sich mit dem Rücken an seinen Stamm, gleitet an ihm zu Boden.
Seit dem Unglück kommt sie jeden Morgen hierher. Die Pest. Zehn Haushalte gibt es in Linn, Bauern, Kleinbauern, Taglöhner. Ihre Familie traf es und jene eines Taglöhners. Wieso gerade diese beiden? Im Dorf sagt man, dass Gott schon wisse, warum – er strafe die Sünder. Magdalena hat Gespräche mitgehört. Sie habe zu viel gewollt, habe als Tochter eines kleinen Bauern den Sohn von einem großen Hof geheiratet. Mehrmals habe sie sich eitel mit einem purpurnen Rock herausgeputzt, sei zum Markt in Brugg gegangen. Auch Taglöhner Ruedi sei in Brugg gewesen, habe dort Werkzeuge geflickt in vornehmen Haushalten. Die beiden hätten die Pest nach Linn gebracht, zum Glück aber nur ihre eigenen Leute angesteckt.
Sie gräbt die Zehen in die Erde. Ist es vermessen, wie sie gelebt hat? Sie weiß, wie man über sie spricht im Dorf. Bei den Schwiegereltern, die jetzt schon einige Jahre auf dem Friedhof liegen, war sie nicht willkommen, da sie nichts eingebracht hat. Weil sie viel arbeitet, haben sie aber die Meinung geändert.
In ihrem Garten erntet sie mehr, als die Familie verzehren kann. Wie in früheren Jahren, wenn die Ernte reichlich war, hat sie sich an einem Markttag im Erntemonat auf den Weg nach Brugg gemacht, um mit dem Verkauf von Kraut, Rüben, Erbsen, Bohnen und Frühäpfeln ein Zubrot zu verdienen. Sie schließt die Augen vor der blendenden Helligkeit, hört den Handwagen rumpeln, den ihr Sohn Melcher, der sie begleitete, mit sich zog.
Sie hatte eine frische, weiße Haube angezogen und dazu ihren purpurnen Rock. Die Stadtfrauen erkannten sie an diesem auffälligen Rock, erinnerten sich, gerade bei dieser Marktfrau das beste Gemüse erstanden zu haben. Am Arm trug sie einen Korb mit Beeren. Es war ein sonniger Tag, mit großen Schritten zogen sie aus, um frühzeitig in die Stadt zu gelangen. Wie immer hielt sie vor jedem Wegkreuz kurz inne und bekreuzigte sich, während Melcher ungeduldig weiterschritt. Kälte war über die bloßen Füße in ihren Körper hochgekrochen, dann war es wärmer geworden. Über Stalden, Ursprung und Hafen waren sie bis zur engen Stelle der Aare gelangt, wo die hölzerne Brücke über den Fluss zum schwarzen Turm und in die Stadt Brugg führt. Die Wächter beim Torturm hatten einen Blick auf ihre Ware geworfen und sie in die Stadt eingelassen.
Auf dem Marktplatz lud Melcher die Kisten ab, lehnte sich an die Hausmauer, kaute auf einem Grashalm. Am Verkauf beteiligt er sich nicht, das ist Weibersache, er ist ein junger Mann. Sie rückte die Kisten zurecht, um die verschiedenen Farben der Gemüse und Früchte zur Geltung zu bringen: blaue Beeren, hellrote Rüben, weißgrüne Krautköpfe, rötliche Äpfel, grüne Erbsenschoten und Bohnen. Und schon hatte die erste Hausfrau aus Brugg vor ihr gestanden, ihre großen Heidelbeeren gelobt und gekauft. Eine Magd vornehmer Herrschaften hatte prüfend auf die Naht einer Erbsenschote gedrückt und die runden Erbsen im Innern der Schote wohlwollend gemustert, sie hatten sich auf einen guten Preis geeinigt. Die Sonne hatte Magdalena erfasst, während sie Käuferin um Käuferin bediente. Schließlich füllte sie die letzten Frühäpfel in den Korb einer Magd und wischte sich unter dem Rand der Haube den Schweiß von der Stirn. Melcher war nicht da – wo blieb er nur? Sie hob die leeren Kisten auf den Handwagen.
Auf einmal drang eine Stimme in ihr Ohr. Sie folgte dieser dunklen Stimme, wie viele andere auch. Der Bänkelsänger, um den sie sich scharten, erzählte von einer unheimlichen Krankheit. Von schwarzen Beulen sang er, die Arm und Reich wüchsen, die von der Pest befallen seien. An einem Tag seien die Leute gesund, am andern sterbenskrank. Das Wehklagen sei groß, die Totenglocke bimmle ohne Unterlass. So geschehen in Bern, der Stadt, die er zuletzt besucht habe. Seine Augen rollten unter dem dunklen Hut, den er tief in die Stirn gezogen hatte. Die Leute erschauerten, Magdalena auch, sie warf ihm einen Kreuzer zu und entfernte sich, um nichts mehr hören zu müssen von dieser schrecklichen Krankheit.
Um die Ecke erklangen ganz andere Töne. Ein Musikant hüpfte mit dem Bogen über die Saiten seiner Fiedel und wiegte sich vor und zurück, ein anderer drehte die Leier, im Zusammenspiel ergaben sich Töne, wie sie Magdalena noch nie gehört hatte. Sie bewegte sich zu der Musik und wäre den Musikanten und ihren Klängen gefolgt, wohin diese sie auch geführt hätten. Sie hatte alles um sich herum vergessen.
Plötzlich war da ein Schnaufen an ihrem Ohr, Arme legten sich von hinten um sie. Sie wandte sich um, nahm einen nach Branntwein stinkenden Mann wahr und schob seine Arme weg. Der Mann lachte gurgelnd und umfasste sie gleich von Neuem. «Schöne Marktfrau im Purpurrock, du entkommst mir nicht!» In diesem Moment sprang wie aus dem Nichts Melcher herbei. Er stieß den Mann so kräftig, dass dieser taumelte und in die Knie sank. «Na, du Bauerntölpel, dir will ich es zeigen», rief der Mann und versuchte torkelnd, auf die Beine zu kommen. Melcher verschwand aus dem Kreis der Leute und griff nach der Deichsel des Handkarrens. Sie folgte ihm, schnellen Schrittes verließen sie die Stadt und atmeten erst auf, als die Brücke weit hinter ihnen lag.
Melchers Gesicht war verkniffen. «Man kann dich keinen Moment aus den Augen lassen», fuhr er sie wutentbrannt an.
«Du warst nicht da, ich habe nur der Musik zugehört», verteidigte sie sich.
«Meine Mutter zieht sich auffällig an und lässt sich von einem fremden Mann an den Rock greifen. Schändlich ist das!»
So hatte sie ihren Sohn noch nie erlebt. Meist war er schweigsam, selten unwirsch und aufbrausend. Tag für Tag zog er mit seinem Vater aufs Feld, keine Arbeit war ihm zu schwer. Ihr selbst ging er oft zur Hand, spaltete Holz und half beim Anfeuern. Und nun das? Ein Lied – mit einem Lied könnte sie ihn erreichen. Beim Binden der Garben klang manchmal ein Lied in ihr auf. Maria und die Frauen der Taglöhner stimmten mit ein, abends vor dem Haus öfter auch die Männer. Kaum waren ein paar Töne aus ihrem Mund gedrungen, wies er sie barsch zurecht: «Kein Lied jetzt!» Mit großen Schritten war er davongezogen, der Handwagen rumpelte hinter ihm her, er verschwand um die Wegbiegung.
Als sie den Hof erreicht hatte, war er mit Werner auf dem Feld, sie sah die Gestalten der beiden Männer, die sich gegenüberstanden und Worte wechselten. Melcher war schon gleich groß wie sein Vater. Ihre Tochter Maria war ihr ein paar Schritte über die Wiese entgegengelaufen, ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie erzählte ihr vom Mittagsmahl mit dem Vater, das sie zubereitet hatte. Maria war erst zehn, aber eine verlässliche kleine Person.
Magdalena hatte den purpurnen Rock ausgezogen und war in den üblichen braunen geschlüpft. Zusammen mit Maria hatte sie das Mus für das Abendbrot zubereitet. Schweigend beugten sie sich über das Essen, das Kratzen der Löffel in der Schale war das einzige Geräusch am Tisch. Andere Male hatte sie vom Markttag erzählt und später die Batzen und Kreuzer vor Werners Augen gezählt, er hatte sie gelobt.
Melchers zusammengezogene Augenbrauen warnten sie jedoch vor dem Erzählen. Sie hatte das Geld in den Beutel gleiten lassen und in der Truhe versorgt. Wie immer zog vom Feuer Rauch durchs Haus, ihre Augen tränten. Dennoch hätte sie sich an diesem Abend glücklich schätzen müssen. Zwei Tage später war alles anders gewesen.
Magdalena hört Männerstimmen, rappelt sich hoch, greift nach ihrem Korb. Sie huscht den Abhang hinunter und schreitet den Männern entgegen, als ob sie aus dem Wald unter dem Lindenacker käme. Man kann nicht einfach so Zeit vergeuden bei der Linde, auch nicht, wenn man trauert.
Johannes nähert sich mit einem Ochsengespann und Pflug. «So früh schon in den Beeren, Schwester?» Anerkennung liegt in seiner Stimme.
«Pilze», berichtigt sie, «ich war bei den Pilzen.» Sie hat ein Tuch über den Korb gelegt, niemand sieht hinein. Später wird sie in den Wald gehen und so viele Pilze und Beeren zurückbringen, dass es keine Fragen gibt. Sie wird auch Johannes und der Schwägerin davon bringen.
Johannes ist gut gelaunt, der Grund ist klar: Melcher hat ihm einen von Werners Ochsen ausgeliehen, zusammen mit seinem eigenen Ochsen verfügt er so über ein volles Gespann. Bei den Arbeiten, die alle Bauern von Linn zeitgleich auf ihren Feldern verrichten, kann der erfahrene Onkel dem Neffen zur Seite stehen. Falls Melcher die Hilfe annimmt. Er folgt hinter dem Onkel mit seinem eigenen Ochsengespann, für seine Mutter hat er keinen Blick. Die Mahlzeiten, bei denen sie sich stumm gegenübersitzen, zehren an Magdalena.
Sie geht durchs Dorf, die Hühner gackern, die Bäuerinnen und Frauen der Taglöhner arbeiten in ihren Gärten, nicken ihr zu oder drehen sich weg. Seit den Pestfällen geht man ihr aus dem Weg, keine kommt zum Zaun, um ein Wort zu wechseln, wie sie es vor dem Unglück getan hätte. Ihr graut vor dem leeren Hof, der auf sie wartet. Ganz leer ist er zwar nicht, die Schweine grunzen im Pferch, die Hühner gackern, die Schafe blöken, die Kühe muhen. Diese Geräusche klingen wie Hohn in ihren Ohren.
Da ist die Marienkapelle, sie liegt dem Hof gegenüber. Dort kann sie Schutz suchen, Zeit gewinnen. Sie stößt die Tür auf, lässt sie hinter sich zufallen, nimmt vom Weihwasser, bekreuzigt sich, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vorne in der Kapelle, gegenüber der Statue der Heiligen Muttergottes, fällt sie auf die Knie und beginnt zu beten. Sie bittet die Muttergottes um Verzeihung für den purpurnen Rock, für ihre Schwäche, ihren Hochmut. Vielleicht hat sie tatsächlich den Zorn Gottes auf sich gezogen, und das Unglück, das ihre Familie getroffen hat, war nichts als die gerechte Strafe dafür. Warum hat Gott nicht sie allein gestraft, warum hat es ihre Familie getroffen? Weil die Strafe so noch schlimmer ist. Sie beugt sich vor, berührt mit der Stirn den kühlen Boden, vergib mir, Maria, Muttergottes. Gottes Zorn ist schwierig zu verstehen. Die Muttergottes ist ihr näher, auch wenn nur schon ihr Name Maria sie jetzt mit Trauer überschwemmt. Sie zieht den Rosenkranz aus der Tasche ihres braunen Rocks, betet bei jeder Perle, die durch ihre Hand gleitet, ein Ave Maria.
Der Rosenkranz fällt in ihren Schoß. Wenn sie nur jetzt die Gräber ihrer Lieben besuchen könnte. Das ist nicht möglich, sie liegen weit weg, bei der Kirche Elfingen. Dorthin sind die Linner kirchgenössig, für die Sonntagsmesse nehmen sie den weiten Weg unter die Füße. Das geht jetzt nicht. Gegen Abend aber, im letzten Tageslicht, wird der Kaplan die heilige Messe lesen hier in der Kapelle, viermal in der Woche tut er das. In der Messe können ihr die Linner nicht aus dem Weg gehen, sie zieht die Haube tief ins Gesicht, ist im Gottesdienst eine wie alle anderen. Aber keine der Bäuerinnen kniet sich neben sie, sogar ihre Schwägerin Catharina, mit der sie bis vor einigen Wochen viel gesprochen und gelacht hat, meidet ihre Nähe.
Magdalena beschließt, beim Kaplan nach der Messe geistlichen Trost zu suchen. Er ist ein alter Mann und nicht wortgewandt wie der Priester in der Kirche St. Leodegar in Elfingen, gerade darum aber vertraut sie auf seine Güte und Nachsichtigkeit. Sie steht auf, beugt noch einmal das Knie vor der Muttergottes und bekreuzigt sich beim Ausgang.
Der Hund kommt ihr entgegen, stößt seine Nase gegen ihren Rock, dann läuft er auf die Weide beim Haus, knurrt die Schafe an, auch er ist ruhelos in diesen Tagen. Sie tritt ein, schließt die Tür hinter sich. Ihr schwindelt ob der Leere im Haus, sie setzt sich auf die Bettstatt. Werners Seite ist nicht benutzt. Auch Marias Lager ist unberührt, daneben befindet sich das zerwühlte Strohbett von Melcher.
Drei Tage nach dem Marktbesuch in Brugg wurde sie in der Nacht von Fieber und Albträumen befallen. Werner schnarchte neben ihr, er merkte nichts von ihren Qualen. Sie warf sich hin und her. Als das erste Licht durch die Lederhäute vor den Fenstern drang, bemerkte sie blaue Flecken in ihren Armbeugen, unter den Achseln ertastete sie hügelige Beulen. Sie setzte die Füße auf den Boden, wollte wie jeden Morgen das Feuer anfachen. Aber die Beine trugen sie nicht, sie sank zurück auf die Bettstatt. Maria schälte sich aus der Decke, kam zu ihr, wollte sich wie jeden Morgen kurz an sie schmiegen – und schrie auf bei ihrem Anblick.
Werner setzte sich erschrocken auf, Melcher war mit ein paar Sätzen neben ihr und wich zurück: «Die Pest – Mutter hat aus Brugg die Pest mitgebracht! Da war ein Bänkelsänger, er hat von den Beulen der Kranken und dem großen Sterben in Bern erzählt. Er selbst war wohl verseucht, und sie hat sich beim Tanzen angesteckt!»
«Ich habe nicht getanzt», wehrte sie sich, dann verstummte sie, hatte keine Kraft mehr zu sprechen. Pochendes Fieber stieg in ihrem Kopf auf.
Sie hörte noch, dass Werner und Melcher beschlossen, wie immer aufs Feld zu gehen. Werner war merkwürdig still. Melcher bestand darauf, niemandem von der Krankheit zu erzählen. Er war es auch, der Maria die Anweisung gab, tagsüber nach der Mutter zu schauen, die Mahlzeiten zu bereiten und abends dem Vater ein Lager in der kleinen Kammer zu richten.
«Mutter ist so heiß, sie antwortet nicht mehr. Was kann ich nur tun?», fragte Maria ängstlich.
«Einen Kräutersud machen, kühlende Tücher auflegen, du bist ihr doch öfter zur Hand gegangen.» Melcher nahm eine Wurst aus dem Rauchfang, wickelte sie zusammen mit Brot und Äpfeln in ein Tuch, packte Wein im Schlauch in den Korb.
Werner war nicht mehr an ihr Lager getreten, er hatte sich mit Melcher entfernt. Sie hatte die Augen geschlossen. Nur manchmal hatte sie Marias Hände gespürt, die wie Vögelchen über ihren Körper hüpften, ein kühlendes Tuch anbrachten oder ihr aus einem Becher Wasser einflößten.
Am Abend nahm sie die Stimmen der Männer wahr. Sie mischten sich in ihrem Fieberwahn mit der dunklen Stimme des Bänkelsängers. Grässliche Gestalten tauchten vor ihr auf, Höllengeister, die nach ihr griffen und sie in den Abgrund stürzen wollten.
Tage und Nächte zogen vorbei. Manchmal hörte sie Stimmen, Gestöhne und Gemurmel, manchmal war es still. Das Fieber knisterte wie Feuer in ihr, es drohte sie zu verschlingen. Sie versuchte wegzulaufen, aber die Feuersbrunst blieb ihr auf den Fersen. Einmal hörte sie Männerstimmen, die nicht zum Haus gehörten. Das Feuer wurde weniger und erlosch.
Sie erwachte, setzte sich auf. Werner war nicht neben ihr, sie rief nach Maria.
Es war Melcher, der an ihr Bett trat. «Du bist wach, scheinst genesen – gerade du!» Er raufte sich das Haar. «Vater ist tot, Maria ist tot. Sie hat dich gepflegt, am nächsten Tag lagen Vater und sie auch krank darnieder. Sie starb am Abend, der Vater am folgenden Morgen. Gestern in der Dämmerung hat man ihre Leichname, in Decken gehüllt, auf Bahren zum Friedhof getragen und beerdigt. Der Totengräber, Johannes und die anderen Männer hatten Tücher ums Gesicht gewickelt aus Angst, sich anzustecken. Alles Flehen nützte nichts, sie wiesen mich zurück, ich konnte meinem eigenen Vater nicht das letzte Geleit geben.» Er mustert seine Arme, die ohne Beulen sind. «Ich bin gesund, es ist wie ein Fluch. Vater bat mich, den Hof weiterzuführen, das waren seine letzten Worte. Nur darum bin ich noch hier.»
Sie setzte die Füße auf den Boden, kam zitternd auf die Beine, sie standen sich gegenüber.
«Du hast überlebt», sagte er verachtungsvoll und stützte die Hände in die Seiten. «Ich auch. Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass ich dich in deiner hoffärtigen Kleidung nach Brugg begleitet habe. Von jetzt an führen wir zwei gemeinsam den Hof, Mutter. Verzeihen kann ich dir nicht. Du trägst die Schuld am Tod meines Vaters und meiner Schwester.» Er drehte sich um und ging davon.
Sie war in die Knie gesunken. Hatte Gott um Rat und Hilfe gefragt und ihn gebeten, ihr einen Weg zu zeigen, wie sie mit dem Verlust von Mann und Tochter und der Verachtung ihres Sohnes weiterleben könne.
Er hat ihr noch keinen Weg gezeigt. Vielleicht ist das Teil der Strafe, wie auch die Tatsache, dass ihre Lieben von ihr gegangen sind, sie aber noch da ist. Sie muss Geduld zeigen, weiter um Verzeihung bitten.
Es ist Essenszeit. Sie verspürt keinen Hunger, mag auch keinen Haferbrei für sich allein aufsetzen. Melcher hat etwas eingepackt, er isst auf dem Feld. Trotzdem sollte sie etwas einnehmen, um Kraft für die Tagesarbeit zu haben. Im Kessel ist ein Rest Haferbrei vom Vortag, sie wärmt ihn nicht auf, will nicht, dass sich Rauch ausbreitet im Haus. Sie kratzt Löffel für Löffel des kalten Breis heraus, schluckt widerwillig, bricht sich dazu ein Stück Schwarzbrot.
Freudlos schlingt sie die Mahlzeit hinunter.
Letzten Sonntag war sie erstmals wieder den weiten Weg zur Kirche Elfingen gegangen. Melcher hatte einen schnellen Schritt eingeschlagen und war allein davongezogen.
Sie wählte den Weg durch das stille, schmale Tal, zum ersten Mal ging sie ihn allein. Die Wiesen, das Plätschern des Bachs, der felsige Abhang, der Wasserfall – das Wandern durch das schattige Tal war wohltuend. Die Messe in der Kirche St. Leodegar mit allem, was dazugehörte – die Glocken, das Knien, das Beten, die Gesänge – war Balsam für ihre Seele. Der Zusammenbruch kam erst, als sie neben den Gräbern von Werner und Maria stand. Sie warf sich auf die frisch aufgeworfenen Hügel und grub ihre Finger in die Erde, am liebsten wäre sie dort liegen geblieben. Ursula, die Frau des Tauners Ruedi, der nebenan begraben wurde, flüsterte ihr beruhigende Worte ins Ohr, fasste sie am Ellenbogen. Sie richtete sich auf und schloss sich für den Rückweg den anderen Leuten von Linn an. Sie nahmen ihr mit Erde verschmutztes Gesicht und die dreckigen Kleider zur Kenntnis. «Die Magdalena tut gut daran, Buße zu tun», sagte jemand, «sie hat die Seuche in ihre Familie gebracht.» Ursula und ihre Töchter Anni und Vreneli gingen neben ihr, Ursulas Sohn Hans und Melcher zogen vorneweg, die übrigen Leute von Linn nahmen die Mitte ein, in sicherem Abstand zur Vor- und Nachhut. Die Furcht vor Ansteckung war noch immer da. Man behandelte sie wie Aussätzige.
Der Weg zog sich lang hin. Sie musste sich mehrmals ins Gras setzen, legte den Kopf auf die angezogenen Knie. Einmal streckte sie sich sogar aus, blickte in den Himmel, der sich blau über die Erde spannte, während ein paar weiße Wolken unbeteiligt dahinzogen. Werner und Maria waren jetzt dort. Wie gern hätte sie von ihnen Abschied genommen. Das war ihr versagt geblieben. Aber sie würde sie antreffen, falls sie selbst einmal in dieses Reich käme. Alles würde sie dafür tun, Abbitte leisten für Sünden, die sie begangen hat. Nicht aber für jene, die sie nicht begangen hat.
Ursula hatte mit ihren Töchtern geduldig neben ihr gesessen, sie half ihr auf die Beine, als sie so weit war. Diesmal nahm sie das stille Tal kaum wahr, setzte nur einen Fuß vor den anderen, war heilfroh, als sie Linn erblickte und ihr strohbedecktes Heim, eines der größten Häuser in Linn. Sie hatte sich bei Ursula für die Begleitung bedankt, die Tür aufgestoßen und sich erschöpft auf die Bettstatt fallen lassen.
Melcher war nicht im Haus gewesen, er erschien nur zu den Mahlzeiten.
Die Stille im Haus hat am Sonntag auf ihr gelastet und tut es auch jetzt wieder, immer und jeden Tag. Bald wird sie in den Garten gehen, Gemüse ernten, in der Hofstatt Spätäpfel von den Bäumen pflücken und auflesen. Sie wird die Eier lesen, misten, die vier Kühe in den Stall treiben und melken. Und dann wird es Zeit sein, anzufeuern und das Mus zuzubereiten fürs Abendbrot. Sie wird hören, wie Melcher den Pflug hinter dem Haus abstellt und die Ochsen in den Stall führt. Er wird in die Küche treten, sich auf die Bank setzen und wortlos das Mus in sich hineinstopfen. Er spricht kein Wort mit ihr während des Essens, sie hat sich daran gewöhnt, mehr Magd zu sein als Mutter. Wenn sie ihm eine Frage stellt zum Pflügen, Aussäen der Wintersaat, zu den Tieren, schaut er sie nicht an, wischt ihre Anteilnahme zur Seite wie eine lästige Fliege. Mit wenigen Worten fertigt er sie ab und geht davon. Er schläft jetzt in der kleinen Kammer, wo Werner sein Krankenlager hatte, sie ist in der Küche und der angrenzenden Stube allein. Manchmal hört sie, wie er sich auf seinem Lager hin und her wirft, ab und zu ist da ein kleiner Schrei oder ein Stöhnen, wahrscheinlich wird auch er von Albträumen gequält, die sie selbst Nacht für Nacht stundenlang wachhalten.
Diese Stille. Wenn man sie nur irgendwie durchbrechen könnte. Alles ist besser als diese unendliche Grabesruhe am Abend und in der Nacht. Kein Flüstern oder Lachen von Maria, niemand, der an ihrer Seite die Arbeit verrichtet. Werner sitzt nicht mehr mit ihnen am Tisch, es gibt keinen Austausch mit Worten mehr, keinen Blick, der sie umfasst, keinen schweren Körper, der sich an sie drückt, keine kratzenden Barthaare, kein Schnarchen in der Nacht. Manchmal hat sein Schnarchen sie gestört, sie konnte nicht einschlafen oder ist aufgewacht. Das war ihr Alltag, gehörte zu ihrer Welt. Da waren ihr Mann, ihre Kinder, gemeinsam arbeiteten sie und durchlebten die Tage. Jetzt ist nur noch Leere. Mit ihrer Arbeit können sie und Melcher den Hof zwar fortführen. Aber es wird Abstriche geben, der Mann fehlt, dem alles gehörte und der alles in Händen gehalten hat, und es fehlen die helfenden Hände der kleinen Tochter und ihr anschmiegsames Wesen.
Ihr schwindelt auf einmal, die hölzernen Wände des Hauses biegen sich gegen innen, weichen zurück und biegen sich von Neuem über ihr zusammen, das Haus droht sie unter sich zu begraben. Sie schlägt die Hände vor die Augen, redet sich gut zu, bis ihr Atem ruhiger wird. Als sie die Hände vom Gesicht nimmt, sind die Wände wieder gerade, sie ist nicht mehr in Gefahr.
Es ist verrückt. Zwanzig Tage erst sind seit ihrem Marktbesuch in Brugg vergangen, nur zwanzig Tage. Und doch hat sich die Welt völlig verändert, steht seither Kopf. Es ist nicht möglich, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Die Welt ist eine andere, sie muss sich daran gewöhnen. Warum fällt es ihr so schwer?
Sie schaut auf ihre Arme. Die schwarzblauen Beulen sind abgeheilt. In Linn wurden nur wenige krank. Fast alle aber, die an der Pest erkrankten, sind gestorben. Werner und Maria sind tot. Ursulas Mann Ruedi ebenfalls. Nur sie selbst hat überlebt. Man fragt sich im Dorf, warum das so ist. Sie weiß es auch nicht.
Da, ein Klopfen, der Hund bellt. Sie setzt sich gerade hin. Wer will zu ihr? Sie wird gemieden wie eine Aussätzige. Es klopft wieder. Sie zieht ein Tuch um Kopf und Schultern und öffnet die Haustür. Zwei Männer stehen vor ihr, einer ziemlich vornehm gekleidet mit Leibrock aus feinem Stoff, einem Täschchen am Gürtel und Bundschuhen aus Leder, der andere einfacher mit Leinenhemd und -hose, wohl ein Knecht. «Sei still», befiehlt sie dem Hund, der noch immer bellt und die beiden umkreist.
«Wir kommen im Auftrag unserer Dienstherrin vom Kloster Königsfelden, Königin Agnes», ergreift der Vornehmere das Wort.
«Königin Agnes?» Ihre Augen weiten sich. Sie verehrt die Königin. Diese hat ihren Mann verloren, wie sie selbst nun auch. Agnes hat mit ihrer Mutter das Kloster in Königsfelden und eine Kirche mit wunderbaren Glasfenstern bauen lassen, ohne ins Kloster eingetreten zu sein, erzählt man. Sie verkehre mit mächtigen Herren, die auf ihr Wort hörten, obwohl sie nur eine Frau sei, aber eben eine Königin, eine mit einem besonderen Wesen. Agnes ist ihre Herrin. Der Zehnt an Korn und Heu, den sie jedes Jahr an den Kellerhof in Elfingen abliefern, geht ans Kloster Königsfelden und damit an Königin Agnes. Und nun schickt die Königin zwei Männer zu ihr! Sie bittet die beiden herein, diese lehnen ab.
«Die Seuche war in deinem Haus, vielleicht ist die Luft verpestet», stellt der Vornehme fest. «Du, Magdalena Wülser, hast überlebt, dein Mann Werner wurde dahingerafft, hat man uns gesagt, wir entbieten dir unser Beileid. Wir kommen wegen des Todfalls. Du weißt, wovon wir sprechen? Eine Abgabe ist fällig.» Er blickt sie streng an.
Todfall. Werner ist tot. Die wichtigste Arbeitskraft der Familie fehlt. Sie werden weniger erwirtschaften und den Gürtel enger schnallen müssen. Sie weiß noch nicht, wie das gehen soll. Was wollen sie von ihr? Sie können ihr doch nicht noch mehr nehmen, als ihr schon genommen ist? «Werner ist tot, mehr weiß ich nicht», stammelt sie.
Der vornehmere Herr zieht die Augenbrauen hoch. «Wenn der Hausvater stirbt, können Leibeigene des Klosters weniger Zehnten abliefern. Als Entgelt für diesen Todfall ist das beste Stück Vieh oder das beste Gewand des Verstorbenen abzugeben. Oder du zahlst uns einen ansehnlichen Betrag an Gulden bar auf die Hand.»
Sie starrt die Männer an. «Ich habe kaum Bargeld, Gulden schon gar nicht. Den Zehnten haben wir immer abgeliefert, das Huhn zu Fasnacht und im Herbst ebenfalls. Die drei Ochsen brauchen wir auf dem Feld, um auch weiterhin einen angemessenen Zehnten liefern zu können.» Weiß Königin Agnes, dass diese Männer in ihrem Auftrag hier sind? Ist sie auch mit Abgaben bestraft worden, als ihr Mann, der König von Ungarn, gestorben ist und sie in Trauer und Not war?
«Wir lassen dir die Ochsen, bring uns das Sonntagsgewand deines verstorbenen Mannes. Rasch, mach vorwärts, wir müssen noch bei der Taunersfrau Ursula vorsprechen.»
Benommen geht sie ins Haus, schließt die Truhe auf. Zuoberst liegt ihr purpurner Rock. Darunter findet sie Werners Sonntagskittel. Magdalena riecht am Kittel – da ist sein Geruch. Sie legt ihn zurück. Zuunterst in der Truhe liegt der wollene Mantel, den er von seinem Vater geerbt und kaum getragen hat. Sie zieht ihn hervor und verbirgt den Purpurrock unter den anderen Kleidern. Den Mantel faltet sie, legt ein Leinenhemd, eine kurze Leinenhose und Beinlinge dazu, geht hinaus und streckt die Kleider den beiden Männern hin.
Der Vornehmere mustert die Kleider und wirft sie auf den Leiterwagen des Knechts. «Und der Gürtel?», fragt er. «Dein Mann hat den Mantel sicher gegürtet getragen.»