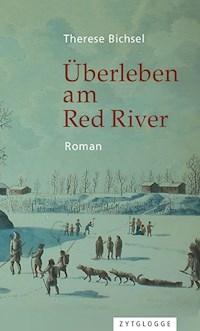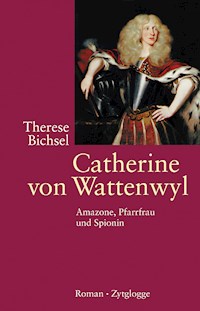20,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zarin Katharina die Grosse verheiratete die erst vierzehnjährige Juliane von Sachsen-Coburg mit ihrem Enkel Konstantin. Aus der deutschen Prinzessin Juliane wurde die russische Grossfürstin Anna. Die Ehe war höchst unglücklich. Anna floh zurück nach Coburg und weiter in die Schweiz, nach Bern. Dort begründete sie ihr schönes Gut Elfenau an der Aare. In Bern schätzte man die Grossfürstin, Schwägerin des mächtigen Zaren Alexander. Anna führte aber nicht nur ihr offizielles Leben. Sie wurde heimliche Geliebte, bekam zwei uneheliche Kinder, die sie verbergen musste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
THERESE BICHSEL
GrossfürstinAnna
FLUCHT VOM ZARENHOF IN DIE ELFENAU
ROMAN · ZYTGLOGGE
Für Hannes
Bei den kursiv gedruckten Stellen handelt es sich um Originalzitate.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag, 2012
Lektorat: Hugo Ramseyer, Bettina Kaelin
Korrektorat: Monika Künzi, Jakob Salzmann
Cover: La Grande Duchesse Anna Feodorovna,von Elisabeth Vigée-Lebrun, 1795/96
Umschlagrückseite: Juliane von Sachsen-Coburg-Saalfeld,von Johann Daniel Mottet, 1818 (Schloss Ehrenburg, Coburg)
Bildbearbeitung Cover: FdB – Für das Bild, Fred Braun
Satz: Zytglogge Verlag
e-Book: mbassador GmbH, Luzern
ISBN 978-3-7296-0851-1eISBN 978-3-7296-2009-4
Zytglogge Verlag, Schoren 7, CH-3653 Oberhofen am Thunersee
[email protected], www.zytglogge.ch
1795 · 1796
Coburg – St. Petersburg, Aug. bis Okt. 1975
Julie klatscht in die Hände, als die Kutsche endlich losfährt. Die Gesichter der jüngeren Geschwister und Dienstboten, die sich zum Abschied vor Schloss Ehrenburg versammelt haben, spiegeln Freude und Schmerz zugleich. Leo, der Kleinste, noch nicht fünf, bricht in Tränen aus. Antoinette wirft ihm eine Kusshand zu, Sophie schaut nachdenklich vor sich hin, Julie dreht sich um und winkt, und sie winkt noch immer, als Leo, der sein Gesicht an die Schulter der Kinderfrau drückt, und das Schloss schon längst verschwunden sind. Sie schluchzt plötzlich.
«Julchen», mahnt Mutter Auguste, «halte deine Gefühle im Zaum.» Sie mustert die drei Töchter. Eigentlich fühlt sie sich bei diesem Auftrag nicht wohl. So früh schon soll eine von ihnen Familie und Heimatstadt verlassen. Aber wer ist sie, sich der Zarin zu widersetzen? Auf Wunsch von Kaiserin Katharina fährt sie nach St. Petersburg, damit sich der Zarenenkel Konstantin eine Frau aussuchen kann. Wird er die dunkelhaarige Sophie, besonnen, selbstbewusst, auswählen? Oder die blonde, grossgewachsene Antoinette, strebsam, ein bisschen naiv? Oder vielleicht doch die Jüngste, die erst vierzehnjährige Julie, braunhaarig, keck, ein hübscher Wirbelwind?
Katharinas Brief war im Juli eingetroffen. Zusammen mit ihrem Mann, Herzog Franz Anton, hatte sie sich ungläubig über die Zeilen gebeugt. Ausgerechnet ihr kleines Herzogtum wählte die Zarin aus – eine ihrer Töchter sollte russische Grossfürstin werden! Natürlich hatten sie Katharina zustimmend geantwortet. Gut möglich, dass eine grosse Heirat andere Verbindungen nach sich ziehen wird. Und zu hoffen ist, dass sie sich mit dem Rubel aus Russland endlich aus der Verschuldung befreien können.
Nun, an diesem 12. August 1795, machen sie sich auf den Weg. Franz Anton kann die Geschäfte nicht lange ruhen lassen, er wird sie nur einen Tag begleiten. Auguste graut vor der langen Reise, aber sie lächelt ihren Töchtern beruhigend zu.
Sophie hat ihren Zeichenblock auf den Knien und skizziert die Landschaft, obwohl die Strasse holprig ist und sie den Kohlestift immer wieder neu ansetzen muss. Julie lehnt in der Ecke, träumt vor sich hin. Dieser Tochter – wohl die hübscheste und begabteste der drei – fehlt noch die Reife, ihre Stimmungen wechseln wie das Wetter im April. Antoinette ist eingedöst wie ihr Vater. Die Pferde traben dahin in der Augusthitze, monoton klopfen die Hufe auf den Boden.
Julie schiebt das Kutschenfenster auf, begierig nach frischer Luft. Der Duft von frischen Früchten und abgeernteten Feldern steigt ihr in die Nase. Sie knabbert an einer der Zwetschgen, die ihnen die Köchin mitgegeben hat, spürt ihre Süsse auf der Zunge und verscheucht mit einer Handbewegung eine lästige Wespe. Gibt es auch in Russland Zwetschgen? Und was ist mit den Birnen und frühen Äpfeln, die bald reif sein werden? So vieles weiss sie nicht. Sie leckt sich den Saft von den Lippen. Und wenn auch – sie ist bereit für die grosse Reise, sie will in die Welt hinaus. Im fernen St. Petersburg, von dem sie keine Vorstellung hat, wird ein grosser Prinz – ein Bruder des zukünftigen Zaren, einer, der vielleicht selbst einmal Zar wird – eine von ihnen – eine kleine Prinzessin aus dem Herzogtum Coburg – zu seiner Frau machen.
Das kennt sie doch. In den Kinderaufführungen mit ihren Geschwistern war immer sie es, die ihr Bruder Ernst als Braut heimführte. Sie schauspielert gern, singt gut und tritt gern auf – darum gab man ihr die Hauptrolle. Aber dann, wenn sie endlich mit Ernst verheiratet war, riss sie den Schleier vom Kopf und tanzte ausgelassen, kroch unter den Sessel, versteckte sich hinter der Tür, war ein Wicht, ein Kobold, und die älteren Schwestern schüttelten den Kopf über die kindische Julie, die sie eben noch als Braut bewundert hatten.
Stunde um Stunde vergeht, noch immer zieht sich diese erste Tagesetappe hin, und bald ist Julie die Einzige, die noch wach ist. Die Köpfe der Eltern und Schwestern schaukeln mit den Bewegungen der Kutsche, und Julie lacht: Ein wunderbares Spiel, alle sind von einer bösen Fee verzaubert und in Schlaf gefallen, und sie warten darauf, dass Julie – oder der Prinz – sie aus der Erstarrung holt.
Aber nun werden auch ihre Glieder schwer, die Augen fallen ihr zu. Man muss auf den Prinz warten, er wird sie küssen, sie wird zuerst erwachen, wird in seine blauen Augen schauen und ihm um den Hals fallen, und dann werden alle andern erwachen, ein Fest werden sie feiern, und der Prinz und die Prinzessin sind inmitten der andern, sie werden tanzen bis zum Umfallen, und kurz vorher wird er ihr die Krone aufsetzen und sie ihm, Hand in Hand werden sie sich verbeugen, von allen beklatscht und gefeiert, und in ihren Gemächern verschwinden …
Die Reise zieht sich hin. In Leipzig verabschiedet sich der Vater – er muss zurück nach Coburg. Julie sieht sein Gesicht mit den gütigen Augen, den schweren Zügen, dem weissen Haar vor dem Kutschenfenster und prägt es sich ein. Aber dann ist es weg, die untersetzte Gestalt verschwunden, der ganze Vater weg. Für immer? Nein – der Prinz wird eine ihrer Schwestern wählen. Und wenn sie die Auserwählte ist? Dann wird sie den Vater trotzdem wiedersehen, sie wird mit ihrem Prinzen zu ihm reisen.
Anstelle des Vaters sitzt jetzt der kaiserlich-russische General Budberg neben der Mutter, ein älterer, väterlicher Herr, der nach Tabak riecht, weil er sich ständig mit Zigarrenrauch einnebelt. Er ist von Zarin Katharina gesandt und begleitet diese Reise, organisiert Essen, Empfänge und Nachtlager.
Die Abende, wenn das Holpern endlich aufhört, gefallen Julie am besten. Der Koch, der in der zweiten Kutsche mitreist, bereitet Leberknödelsuppe, fränkischen Sauerbraten und Coburger Klösse zu. Apfelrotkohl, Bratkartoffeln und Sauerkraut werden gereicht, es ist alles wie zu Hause. Sie führen einfache Betten mit, um nicht dem Ungeziefer der Gasthöfe ausgeliefert zu sein. Der Kammerdiener stellt sie jeden Abend auf, und Julie, des Stillsitzens in der Kutsche überdrüssig, hopst auf den Bettsäcken und Matratzen herum, bis die Mutter den Mahnfinger aufhält.
Die Empfänge, die ihnen einige der Städte entlang ihrer Route bereiten, langweilen sie – die Marschmusik, gespielt von adretten Offizieren in schmucker Uniform, gefällt ihr besser.
Frankfurt an der Oder, Landsberg, Bromberg, Marienwerder ziehen vorbei. In Königsberg empfängt sie ein tiefblauer Himmel – und sie besuchen als Höhepunkt das Theater. Dann verlassen sie Deutschland.
Die Kutsche knarrt weiter durch Dörfer und Städte, über Felder, durch Kiefernwälder und Sand, der so weiss ist wie Schnee. Die Landschaft wird fremd, die Gerüche sind stark, manchmal kräuselt Julie die Nase. Es riecht nach Sand und Tang, wenn sie an Seen entlang ziehen, nach würzigen Kiefernadeln und Harz im Wald und nach feuchter Erde, wenn Regen gefallen ist.
Sie passieren Tilsit, fahren im grossartigen Riga ein: Petrikirche, Dom, Jakobus-Kirche und der breite Fluss Düna bieten sich ihren staunenden Augen dar. Sie suchen den Schneider auf: Die Garderobe wird mit roten Pelzen, Zobelmützen und dicken russischen Kleidern ergänzt. Die Gewänder sind nötig, weil die Augusthitze kühlen Septembertagen gewichen ist. Zudem wollen Mutter und Töchter am Zarenhof nach Landessitte gekleidet sein. General Budberg, der – eingehüllt in dicken Zigarrenrauch – am Tisch auf sie gewartet hat, mustert die Damen, die in den neuen Gewändern auftreten, mit Wohlwollen.
Sie erreichen Dorpat, holpern Anfang Oktober durch die russische Steppe, legen die letzten Etappen der Reise in Richtung St. Petersburg zurück. Julie hopst nicht mehr auf den Betten herum am Abend, sondern versenkt sich in französische Romanzen, die General Budberg beschafft hat, damit sie ihre Sprachkenntnisse verbessern können: Am Zarenhof ist Französisch die gebräuchliche Sprache.
Es wird still in der Kutsche. Auf der Reise durch Deutschland haben sie gekichert und geplappert, sich auf eine komische Figur am Wegrand, ein schiefes Haus oder einen schönen Sonnenuntergang aufmerksam gemacht. Julie hat Antoinette geknufft, wenn sie wieder einmal eingedöst und gegen ihre Schulter gesunken ist, Antoinette ist zusammengezuckt und hat aufgejault, Sophie hat über die kindischen Schwestern gelacht und die Mutter den Kopf geschüttelt.
Nun löst das fremde Land, diese Einöde, die sich vor ihren Augen hinzieht, eine andere, ernste Stimmung aus. Die Mutter und General Budberg, die sich oft eifrig unterhalten haben, sitzen in angespannter Erwartung da. Sophie, für die der Kohlestift in allen Lebenslagen das Richtige ist, zeichnet noch immer – nun skizziert sie russische Kirchtürme mit ihren Zwiebeldächern. Antoinette, die sich die Zeit mit Sticken vertreibt, muss nicht mehr den Schweiss von den Händen wischen, sondern reibt sich öfter die klammen Finger. Julie versenkt sich nun auch in der Kutsche in die französischen Liebesgeschichten, lebt mit ihnen am Hof von Louis XIV. und ist überrascht, wenn sie die Augen hebt und sich ihr Blick in der russischen Weite verliert.
Regen setzt ein, die Tropfen prallen aufs Kutschendach und perlen über das Fenster. Julie wischt sich auf der beschlagenen Scheibe ein Guckloch frei, sieht nichts als verschwommenes Grau. Die Mischung von Tabak und Parfum und der dumpfe Geruch von matschiger Erde, der von aussen eindringt, lasten schwer in der Kutsche.
Aber dann werden die Tage heller und leichter. Am 17. Oktober, nach gut zwei Monaten Reise, erreichen sie ihr Ziel.
St. Petersburg, Okt./Nov. 1795
Der Tag ist schön und blau. Weisse Paläste, der breite Fluss Newa, viele Kanäle, der golden glänzende Turm der Admiralität scheinen vor ihnen auf. Mutter und Töchter erstarren ehrfürchtig. Die Kutsche biegt auf einen unendlich weiten Platz ein und hält mit einem Ruck vor dem mächtigen Palast. Es ist der Winterpalast – sie sind am Ziel.
Taumel erfasst die Prinzessinnen. Sophie fällt beim Aussteigen über die ungewohnte Schleppe ihres russischen Kleides, Antoinette kriecht aus der Kutsche, um einen Sturz zu vermeiden. Julie rafft die Schleppe und springt leichtfüssig auf den Boden. Sie blickt an der grünlich weissen Fassade hoch. Eine ältere Dame steht am Fenster und beobachtet die Szene lächelnd.
Eine Schar von Boten, Lakaien und Höflingen nimmt Mutter und Töchter am Tor in Empfang und begleitet sie ins Audienzzimmer des Palasts. Dort werden sie der älteren Dame – blaue Augen, graues Haar, klein gewachsen, kräftige Statur – vorgestellt: Es ist die Zarin! Katharina heisst sie in einem Gemisch aus französischer und deutscher Sprache – auch sie ist ursprünglich eine deutsche Prinzessin – willkommen und mustert jede der Schwestern eingehend. Der Ausdruck von Katharinas Augen ist gütig, denkt Julie – aber ihnen entgeht nichts.
Am nächsten Morgen sucht die Kaiserin den Potemkinschen Palast auf, wo sie untergebracht sind, und heftet ihnen ohne viel Worte Orden der heiligen Katharina mit roter Schleife, Stern, Kreuz und vielen Brillanten an die Brust.
Kaum haben sie sich von diesem überraschenden Kurzbesuch erholt, spricht Katharina nach der Messe schon wieder vor. Diesmal hat sie Begleitung: Zwei junge Männer in Infanterieuniform, schnittig, etwas schüchtern, treten vor die Prinzessinnen. Antoinette entfährt ein kleiner Schrei, als Katharina die beiden vorstellt: Alexander und Konstantin. Das sind sie also, die Zarenenkel – der eine davon ihr möglicher Bräutigam!
Julie staunt. Die beiden sind achtzehn- und sechzehnjährig, hat man ihnen gesagt. Sie sehen aus wie grosse Jungen. Ihre Augen bleiben an Alexander hängen: Er ist gross und elegant, wirkt ruhig und einnehmend. Dann erst blickt sie zu seinem Bruder: Konstantin ist kleiner, kräftig, eckig in den Bewegungen und hat einen stechenden Blick. Er missfällt ihr nicht. Aber ist das der Prinz, den sie sich vorgestellt hat?
Alexander verabschiedet sich, er will nach Hause zu seiner jungen Frau Elisabeth. Linkisch steht Konstantin den Prinzessinnen gegenüber, wendet sich schliesslich ihrer Mutter zu, während sich die Kaiserin um die Mädchen kümmert.
Jeden Morgen erwachen sie nun im Potemkinschen Palast, inmitten von St. Petersburg, dieser eleganten, weissen Stadt. Und doch wünscht Julie sich manchmal, wenn sie die Augen aufschlägt, dass alles nur ein Traum ist und sie in den bescheidenen Räumen des herzoglichen Palais in Coburg aufwacht und den Lärm ihrer Brüder und der kleinen Victoire hört, die durch den Korridor tollen.
Nach einigen Tagen werden sie Paul vorgestellt, dem mit Katharina verfeindeten Sohn und Vater von Alexander und Konstantin. Paul wohnt nicht im Winterpalast, sondern in Pawlowsk. Julie erschrickt, als ihnen der zukünftige Zar entgegentritt: Paul ist klein und hässlich, er verwirrt die Besucherinnen mit exzentrischen Gesten und Reden. Seine Frau Maria Feodorowna, gross, blond und mit engelhaftem Gesicht, begrüsst Mutter und Töchter kühl. Weil Katharina ihrem Sohn nicht traut, holte sie Alexander und Konstantin an ihren Hof und erzog sie selbst. Maria Feodorowna hat noch weitere Kinder geboren, aber man munkelt, das Paar habe die durch den Entzug der ältesten Söhne erlittene Kränkung nicht verziehen.
Katharina gibt Empfänge und Bälle zu Ehren der Coburger Herzogin und der Prinzessinnen. Sie besuchen das hofeigene Theater, an dem nur auserwählte Gäste zugelassen sind. Die Zarin sitzt mit ihrem Günstling Subow in der Loge – man nennt ihn den Liebhaber der Zarin. Julie weiss nicht genau, was das bedeutet. Aber sie sieht, dass Katharinas Augen funkeln, wenn sie und Subow die Köpfe zusammenstecken. Katharinas Mann, Zar Peter III., ist schon vor vielen Jahren verstorben, hat man Julie am Hof erzählt.
Konstantin macht eine weitere Aufwartung im Potemkinschen Palast, diesmal allein. Auf Wunsch Katharinas führt er die Prinzessinnen in die Säle der Eremitage und zeigt ihnen Gemälde aus der riesigen Sammlung der Zarin. Hastig spult er Fakten zu den Bildern ab, weicht ihren Blicken aus. Die starren Augen, die steife Haltung – wer ist Konstantin? Interessiert er sich für eine von ihnen? Er weicht ihrem Blick aus und vermeidet eine Wahl.
Unter den Höflingen und Lakaien am Hof beginnt man zu tuscheln. Die Prinzessinnen seien ihm zu deutsch, sagt Konstantin, sein Geschmack sei mehr russisch. Kaiserin Katharina reagiert gereizt und entzieht Konstantin das Kommando über sein Regiment – erst am Tag seiner Hochzeit soll er es zurückerhalten. Den Prinzessinnen schenkt sie Schmuck und heisst die Schneiderin, ihnen neue Kleider anzumessen. Julie wählt blaue Seide aus.
Die Zarin schickt Konstantin mit einem Geschenk – einem kleinen Porträt der Herrscherin – zu den Prinzessinnen. Julie hat ihr himmelblaues Kleid angezogen und weisse Rosen im dunklen Haar. Konstantins Blick wird weich. In unbeholfenem Deutsch versucht er, ihre Aufmerksamkeit zu wecken, aber sie weicht ihm aus. Sophie winkt ihn heran und zeigt ihm ihre Skizzen, Antoinette schwatzt auf ihn ein, die drei lachen und scherzen. Zum ersten Mal ist die Stimmung gelöst – nur Julie bleibt unbeteiligt.
Am nächsten Abend spricht Konstantin bei der Mutter vor und hält um Julies Hand an. Die Mutter weint, weil sich die Spannung endlich löst. Julie bricht ebenfalls in Tränen aus, als man sie herbeiholt. Vor Glück, vor Schreck? Es ist ihr alles zu viel. Konstantin – mit roten Wangen und sich überschlagender Stimme – verspricht ihr seine Liebe. Sie nimmt die Hände vom Gesicht. Liebe. Sie wird lernen, diesen Mann zu lieben.
Die Mutter schreibt einen Brief an den Vater. Als sie weggerufen wird, beugt sich Julie neugierig über die Zeilen und liest: Alles ist entschieden und wie Du’s erwartet hast, Julchen hat das Los getroffen. Sie richtet sich auf. Man hat erwartet, dass sie die Wahl für sich entscheidet. Sie wird sich der in sie gesteckten Hoffnungen würdig erweisen.
Sophie und Antoinette erhalten von der Kaiserin je ein Körbchen mit Schmuck. In den letzten Tagen vor der Rückkehr schliessen sie sich enger zusammen, sie tuscheln und verstummen, wenn Julie sich nähert. Als sich die Kutsche mit Mutter und Schwestern Anfang November in Bewegung setzt, schaut Julie ihnen ungläubig nach.
St. Petersburg, Winter 1795/96
In diesem ersten russischen Winter kommt sie kaum zu Atem. Man festet und feiert, redet und lacht. Handelt es sich nicht um ein wunderbares Spiel? Statt ihrer Schwestern sind nun Konstantins Schwestern an ihrer Seite. Und Elisabeth, Alexanders Frau, die ehemalige Prinzessin Louise von Baden.
Die beiden deutschen Prinzessinnen haben sich sofort gefunden. Jeden Morgen nach neun Uhr frühstücken sie gemeinsam, wenn es langsam hell wird. Dann kommt das Ankleiden und Frisieren, danach folgen Zeichen-, Musik-, Tanz- und Russischstunden. In den freien Stunden lesen und sticken sie, sie tuscheln und tauschen sich aus. Dann das Abendessen, leider ohne Elisabeth, weil sie mit Alexander diniert. Aber sonst ist Elisabeth immer an Julies Seite. Die blonde und blauäugige Elisabeth – ein Gegenbild zur dunkelhaarigen, braunäugigen Julie – hat alles schon hinter sich und bestanden: Zweieinhalb Jahre ist sie älter, zweieinhalb Jahre früher hat sie sich zum orthodoxen Glauben bekehrt und vermählt. Manchmal zwinkert Elisabeth ihrer jüngeren Freundin ermutigend zu.
Julie wohnt nun im Winterpalast mit 1050 Zimmern und Sälen, in denen sie sich noch immer ab und zu verirrt. Draussen ist Eis und Schnee, drinnen spürt sie Katharinas Güte und Fürsorge und die Freundschaft ihrer Schwägerinnen, die ihr vieles erleichtert. Die Männer spielen keine grosse Rolle im Palast. Subow begleitet Katharina, wenn sie es wünscht. Alexander sucht die Nähe der Kaiserin und lässt sich von ihr leiten – Konstantin geht ihr aus dem Weg.
Am 28. Dezember 1795 macht Julie den von ihr verlangten, für die Ehe mit Konstantin unumgänglichen Schritt: Sie tritt vom protestantischen zum russisch-orthodoxen Glauben über. Ganz allein steht sie vor dem Bischof und dem versammelten Hof, ihre Stimme zittert, als sie das Bekenntnis zu Jesus Christus, den sieben Sakramenten, den Heiligen und Ikonen ablegt und Gehorsam gegenüber den kirchlichen Würdenträgern schwört. Der neue Glaube ist ihr noch nicht vertraut wie der alte, die Kapelle der Eremitage strahlt nicht die gleiche Geborgenheit aus wie die Coburger Morizkirche oder die Hofkirche. Aber im orthodoxen Gottesdienst fühlt sie sich aufgehoben, der Weihrauch benebelt ihre Sinne.
Als Juliane von Sachsen-Coburg hat sie die Kapelle der Eremitage betreten – und verlässt sie nach der Zeremonie als Grossfürstin Anna Feodorowna von Russland. Anna? Der neue Vorname fühlt sich fremd an. Julchen hat sie zuhause in Coburg gelassen; Juliane oder Julie, die nun Anna heisst, soll bald Ehefrau werden. Ihr Kopf wirbelt von den Veränderungen der letzten Wochen, und dieses Wirbeln hört nicht mehr auf, wie so oft jetzt schmerzt ihr Kopf heftig.
«Anna, willkommen bei uns!» Katharina und Elisabeth umarmen sie, Alexander gratuliert. Konstantin schüttelt ihr ungeschickt die Hand. Seit sie einander versprochen sind, hält er sich von ihr fern. Sind seine Gefühle bereits verflogen? Weit lieber als ihr widmet er sich seiner Sammlung von Militärhüten, Federbüschen, Schärpen und Säbeln oder brütet stundenlang über einem strategischen Detail.
Und dann der grosse Tag – die Vermählung am 15. Februar 1796 in der Kapelle der Eremitage. Fünf Kanonenschüsse am Morgen, Einkleiden vor den Augen der Kaiserin und der Hofdamen: Schlotternd steht sie da im Unterkleid, man zupft, zerrt an ihr, ein schweres Kleid mit langer Schleppe, in Hermelinpelz gefasst, wird ihr übergestreift, ein himbeerfarbener Samtmantel um die Schultern gelegt, auch er mit Hermelin gesäumt. Ihr Haar wird hochgesteckt und so straff gezogen, dass ihr das Wasser in die Augen schiesst. Sie erblickt dieses weisse Wesen mit Rot im Spiegel und erkennt sich nicht wieder.
Der Tross setzt sich in Bewegung. Die Familie und die Höflinge, Kammerdiener und Ehrendamen begleiten sie in die Kapelle, wo die diplomatischen Vertreter und Minister bereits warten. Anna kniet neben Konstantin nieder, die Kronen werden über ihre Häupter gehalten. Sie schaut auf den Mann neben ihr, rotwangig, flache Nase, bereits zurückweichender Haaransatz. Wenn er sie nur mit einem Blick ermutigen würde … Aber er schaut vor sich nieder, seine Lider flattern.
Die Zeremonie der Vermählung nimmt ihren Lauf, Chöre hallen durch die Kapelle, der Bischof spricht: «Es sei gekrönt der Diener des Herrn, Konstantin Pawlowitsch, für die Dienerin des Herrn, Anna Feodorowna, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sei gekrönt die Dienerin des Herrn, Anna Feodorowna, für den Diener des Herrn, Konstantin Pawlowitsch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.» Schwer senken sich die Kronen auf ihre Häupter.
Das Fest nach der Vermählung dauert tagelang und wird mit einem grossen Feuerwerk beendet. In der Hochzeitsnacht betritt Anna das grosse Schlafzimmer allein – Konstantin will nach seinem Regiment sehen, dessen Kommando er endlich zurückerhalten hat. Stundenlang liegt sie da in banger Erwartung, schliesslich zornig, dann resigniert – der Spott des Hofes ist ihr sicher. Erst am Morgen tritt Konstantin ins Schlafzimmer, bittet treuherzig um Verzeihung.
Seine Nachlässigkeiten setzen sich in den nächsten Monaten fort. Wenn sie sich beklagt, wirft er ihr einen starren Blick zu und schreit sie an – oder er verspricht kleinlaut Besserung. Nie weiss sie, welcher Konstantin ihr gegenübertritt. Aber sie kann auf den Rückhalt Katharinas zählen, die ein waches Auge auf ihren Enkel hat.
Dann jedoch stirbt die Zarin am 6. November 1796 unerwartet. Alles wird anders.
1811
Bern, Juni 1811
Die Pferde traben über die Untertorbrücke, wiehern und werfen den Kopf hoch, als der Kutscher sie den Abhang hochtreibt. Anna beugt sich zum Kutschenfenster und schaut zurück auf die Stadt. Wie immer beruhigt sie der Blick auf die eng geschachtelten Steinhäuser, die in die Flussschleife gebettet sind. Über der Stadt wacht das Münster mit seinem Turm, der wuchtig und doch bescheiden wirkt, weil ihm die Spitze fehlt. Geborgen lehnt sie sich ins Polster zurück.
Die glänzenden Rücken der Tiere bewegen sich vor ihr auf und ab. Nur zwei Pferde sind vorgespannt. Grossfürstin Anna fährt üblicherweise vierspännig. Aber in Bern weilt sie als Gräfin Romanow. Nur nicht auffallen. Das ist das Motto der vergangenen Jahre, seit sie Petersburg verlassen hat.
Nie hätte sie ihre Ehe und diese schöne, kühle Stadt mit den weissen Palästen aufgegeben, wenn nicht Konstantin ihr Gatte gewesen wäre. Der Name lässt sie erschauern. Sie wischt ihn weg, wischt das Bild dieses Mannes weg. Wie wenn sie ihr Leben dort zum Verschwinden bringen könnte. Ihre Heirat. Aus der vierzehnjährigen Juliane, genannt Julchen, wurde die russische Grossfürstin Anna. Ein Traum, der noch am Abend der Hochzeit zerplatzt war. Noch einmal wischt sie alles weg, diesmal erfolgreich.
Die Pferde haben den Abhang erklommen, sie fahren an ein paar Campagnen und ausladenden Laubbäumen vorbei und biegen auf den staubigen Weg ein, der durch die Felder nach Brunnadern führt. Die Berge tauchen vor ihr auf, weiss wie eine Erscheinung – Eiger, Mönch, Jungfrau, die Blümlisalp. Die Sicht auf die Schneeberge, die weiten Felder, aber auch die engen Gassen der Stadt, die nicht zu gross ist, nicht zu klein. Es gibt hier Konzerte und Theater, vornehme Familien, Gesandte aus fremden Ländern und den Anschluss an die grosse Welt – aber auch die Möglichkeit zu Ruhe und Rückzug. Das hat sie gesucht – ein Sommer abseits von Coburg, von Russland vor allem. Einen Sommer lang Ruhe finden nach so vielen Jahren des Auf und Ab, Hin und Her. Mehr als einen Sommer hier kann sie sich nicht leisten. Es ist ihr nicht möglich, der Öffentlichkeit fernzubleiben. Sie ist Anna von Russland, Grossfürstin, muss Pflichten wahrnehmen, auftreten, repräsentieren. Dafür erhält sie Zahlungen von Zar Alexander, ohne die sie keine Existenz hat. Zar Alexander, ihr Schwager – das ist eine andere Geschichte. Und Elisabeth, seine Frau – lange, vielleicht jetzt noch, ihre beste Freundin.
Zuerst nun dieser Sommer. Sie mustert die Fenster, als die Kutsche vor dem gelben Haus mit den Säulen und dem Türmchen hält. Ist er schon da? Er mag es nicht, wenn er auf sie warten muss. In diesem Haus am Rand des Wäldchens, das die Berner Dählhölzli nennen, gibt es keine Grossfürstin. Und keinen Haushofmeister. Natürlich ist sie nicht Julchen für ihn – so nennen sie nur ihre Mutter und die Geschwister. Auch nicht Juliane – ihr Taufname. Wenn niemand zuhört, nennt er sie manchmal Anna oder Julie, und sonst ist sie die «Kaiserliche Hoheit ». Das ist ihr Titel, so reden die Leute sie an. Sie nennt ihn «Monsieur» – oder Jules-Emile, wenn sie zu zweit im Haus sind, aber das kommt kaum je vor, auch wenn nur wenige Dienstboten mit ihnen leben. Jules und Julie? So einfach wäre das. Aber so ist es nicht. Der Kutscher öffnet ihr die Wagentür, ihre Ehrendame Caroline Wasner tritt heran, ein Schweizer Mädchen.
«Ist Monsieur schon da?», fragt Anna, und die Antwort erübrigt sich, denn er tritt unter die Tür, mustert sie missbilligend. Sie geht auf ihn zu, ihre Schritte werden langsamer, sie freut sich nicht mehr, ihn wiederzusehen, es ist alles so schwierig. Ein Vorwurf kommt über seine Lippen, und sie sieht nur diese Lippen, die sich hässlich verziehen, und erwidert nichts, geht an ihm vorbei und die Treppe hoch in den ersten Stock, verabschiedet Caroline mit einem Wink.
Sie betritt den kleinen Salon, er folgt ihr. Ein Strom französischer Worte quillt aus seinem Mund: «Ah non, ich halte es nicht mehr aus in diesem Haus, in dieser Stadt. Sie treten hier nicht als das auf, was Sie sind. Und wenn die Gräfin Romanow trotzdem empfangen wird, bin ich oft nicht erwünscht.»
«Monsieur, Sie haben letzthin ein paar Herren verärgert, als Sie die Unabhängigkeit der Waadt zu heftig verteidigten.»
Seigneux wirft sich in Postur. «Die Berner Patrizier möchten die Waadt wieder unter ihrer Fuchtel haben. Sie warten nur darauf, die Zeit zurückzudrehen und ihre Niederlage gegen die Franzosen vergessen zu machen.»
Seine blitzenden Augen und durchgedrückten Schultern schüchtern sie einen Moment ein. Ansehnlich ist er, denkt sie, aber kein wirklich schöner Mann wie Linev, der Husar … Aber das ist lange her.
Sie versucht, Seigneux entgegenzuhalten. «Die mit mir befreundeten Herren von Mülinen und von Wattenwyl anerkennen die Unabhängigkeit der Waadt. Man muss sehen, dass Bern eine schwierige Zeit durchmacht – so vieles hat sich seit 1798 geändert. Von den Wirren, die Napoleon über Europa brachte, wurde auch meine alte Heimat erfasst. Aber jetzt hat sich der Wind gedreht. Das Herzogtum Coburg wird fortbestehen, und auch Bern hat wieder einen Grossteil seines alten Gewichts. Dazu steht Zar Alexander – da bin ich mir sicher.»
Die Schwägerin des Zaren hat gesprochen. Seigneux schätzt ihre enge Verbindung zum Zaren, kann aber seine Erregung nicht bezähmen: «Zum Teufel mit den gnädigen Herren von Bern – ich werde nicht ihren Speichel lecken. Wenn ich nur in meine Heimat reisen könnte …» Sein Gesicht verzieht sich schmerzlich – auf einmal wirkt er wie ein kleiner Junge, dem man sein Spielzeug weggenommen hat. Seigneux, der in einem sinnlosen Duell um einen Jagdhund seinen Konkurrenten tötete, ist auf Lebzeit aus seiner Heimat, der Waadt, verbannt.
Mitleid erfasst Anna, sie streckt die Hand aus, fährt über seine Wange.
Er hält ihre Hand fest: «Komm in mein Zimmer!», sagt er herrisch, greift mit der andern Hand um ihre Taille.
Erschrocken wehrt sie ab. «Nein – man könnte uns überraschen.» Wie kann er nur so rücksichtslos sein, sie und ihre Stellung missachten.
«Dann halt nicht.» Er schleudert ihre Hand weg, so dass sie taumelt, dreht sich um und marschiert wütend aus dem Salon.
Sie will hinter ihm herlaufen, hält sich aber zurück. Seigneux. Nach dem Duell, nach seiner Scheidung, hat er sie umworben. Er war unglücklich – und sie so allein. Irgendwann liess sie es zu. Fünf Jahre dauert die Affäre nun schon und hat sie viel gekostet – ihr das Schönste und Schlimmste zugleich beschert.
Noch immer ist sie mit Konstantin verheiratet. Ihre Schwiegermutter, Maria Feodorowna, stemmt sich seit zehn Jahren gegen eine Scheidung. Aber auch nach der Scheidung hätte sie Seigneux, ihren Haushofmeister, nicht heiraten können. Es gibt klare gesellschaftliche Schranken – und sie ist auf die Zahlungen aus Russland angewiesen. Möchte sie ganz mit ihm zusammen sein? Sie ist unsicher wie in so vielem.
Seit der Zeit mit Linev glaubt sie zu wissen, was Liebe ist: Leidenschaft, sich verzehren nach dem andern in Sehnsucht, kurze Erfüllung – getrübt vom Wissen, dass eine Verbindung unmöglich ist. Vielleicht ist es eher Mitleid, das sie mit Seigneux verbindet? Sein Unglück bedrückt sie. Ihr eigenes auch.
Anna betritt ihr Schlafzimmer, sie öffnet das Fenster weit, streift ihre Ärmel zurück. Das Licht des Juniabends flutet herein, Duft von Heu liegt in der Luft. Sofort fühlt sie sich besser. Mit den Augen sucht sie die Bergkette, gleitet über die Felder und hält inne beim Gut mit dem kleinen Herrenhaus, das am Abhang über der Aare thront. Sie hat diesen idyllischen Flecken auf ihren Spaziergängen entdeckt. Das Gut wirkt verschlossen wie eine Muschel, kein Lebenszeichen ist zu entdecken.
Sie versinkt in Gedanken. Alles ist nutzlos, ihr Leben macht keinen Sinn, sie ist gefangen in einem Spinnennetz, versucht zu fliehen, reist pausenlos – und kann sich doch nicht befreien. Fremd ist sie hier – und fühlt sich trotzdem weit mehr zu Hause als andernorts.
Als sie aus ihren Gedanken auftaucht, ist die Sonne weg. Anna reibt sich die Arme. Es ist nicht nur die Wärme des Sonnenlichts, die fehlt. Sie spürt sich nicht, weiss nicht, was sie will, wer sie ist, warum sie sich hier aufhält. Eine kleine Prinzessin ist sie einmal gewesen, ihr Vater herrschte über das unbedeutende Herzogtum Sachsen-Coburg. Sie hatte viele Geschwister, spielte mit ihnen, vergnügte sich. Dann kam der Brief der grossen Zarin Katharina II., die eine Ehefrau suchte für ihren Enkel. Das war das Ende ihrer Kindheit.
In ihrer Erinnerung herrscht immer Winter in Russland. Die kurzen Sommer, wenn das Licht nicht von den weissen Palästen von St. Petersburg wich und man die ganze Nacht sang, trank und tanzte, scheinen nur wie Irrlichter vor ihr auf. In den Palästen fehlte das Licht. Die Quälereien, die sich in ihrem düsteren Innern abspielten, kann sie nicht vergessen.
Anna zieht ihre Fingernägel über die blasse Haut der Innenseite ihres linken Arms, starrt auf die Kratzspuren, aus denen kleine Blutstropfen quellen. Sie spürt den Schmerz – endlich spürt sie sich wieder. Hastig zieht sie ein Taschentuch aus dem Kleid, wischt das Blut ab und zieht die Ärmel nach vorne bis zum Handgelenk. Wieso macht sie das? Sie schaut auf. Für ihre Eltern und Geschwister hat sie das Höchste erreicht – Einheirat in die Zarenfamilie, ins Zentrum der Fürstenhäuser und der Macht. Aber sie hat dafür bezahlt, ist ruhelos, heimatlos, immer unterwegs.
Diesen Sommer verbringt sie auf diesem grünen Fleck Land etwas ausserhalb von Bern. Hier ist sie nicht so weit weg von dem, was ihr das Liebste ist im Leben.
Ihre Haltung strafft sich, die Augen leuchten. Sie wird Seigneux einen Ausflug aufs Land vorschlagen. Das ist im Interesse von beiden. Seigneux kommt weg von Bern, das ihm verhasst ist, weil er hier auf Schritt und Tritt den ehemaligen Herren der Waadt begegnet. Die Fahrt wird zwar anstrengend sein, die Strasse holprig und der Weg weit. Aber das Ziel wird sie für die Strapazen entschädigen.
Ihr Blick fällt auf den Wandspiegel. Neugierig tritt sie vor ihn hin und schaut hinein. Ein fein geschnittenes Gesicht, Löckchen um die Stirn, die Haare hochgesteckt. Die Augen ausdrucksvoll, die Nase schmal und gerade, um den Mund ein nachdenklicher Zug. Die helle Haut und die Linie von Schultern und Nacken kommen im zarten, mit Spitzen besetzten Kleid zur Geltung, die Gestalt ist anmutig. Mit ihrem Äussern kann sie zufrieden sein, sie ist fast dreissig, wirkt aber immer noch jung. Nur die Unbeschwertheit, die Madame Vigée-Le Brun auf Annas Lieblingsbild festgehalten hat, dem Porträt des Mädchens mit der weissen Feder auf dem Hut und den fliegenden Haaren, ist verschwunden. Das Porträt ist in Russland geblieben – wie so vieles von ihr.
Anna löst ihr Haar, dunkel und lockig fällt es über ihre Schultern. Sie ahmt die Pose von damals nach. Das leise Lächeln bringt sie hin, nicht aber den kecken Ausdruck. Es sind nicht nur der Hut und die kecke Feder, die fehlen.
Sie schüttelt die kleine Glocke, ihr heller Ton erklingt. Und schon ist sie da, Caroline, wenige Jahre jünger als ihre Herrin, ebenso schmale Gestalt, aber rötliches Haar und ein fast durchscheinender Teint, einige Sommersprossen wie hingeworfen über Nase, Wangen und Stirn.
«Du sollst mit mir tanzen», sagt Anna.
Caroline lächelt schüchtern. Wie sollen sie tanzen ohne Musik? Die Herrin trägt das Haar offen, wirkt ausgelassen. Sie ist froh, wenn sie sie so sieht. Manchmal ist sie niedergeschlagen, nichts kann sie erfreuen.
Anna hält ihr die Hände hin und Caroline ergreift sie. «Wir stellen uns die Musik vor, eine rauschende Musik, ein bisschen ungarisch in den Klängen, mitreissend – ein ganzes Orchester spielt für uns!»
Caroline weiss nicht, wie ungarische Musik klingt, aber es hat fahrende Musiker gegeben, die unter der Dorflinde aufspielten, bevor man sie davonjagte. Diese Klänge stellt sie sich nun vor.
Das Fenster steht immer noch offen, frische Abendluft dringt herein. Die beiden jungen Frauen setzen sich in Bewegung, erst langsam und dann immer schneller, sie wirbeln durchs Zimmer, die Musik rauscht in ihren Ohren und bald auch das Blut, sie drehen sich um und um, und als sie sich vor dem Spiegel befinden, schaut Anna hinein. Da ist es wieder, das ausgelassene Mädchen von früher, die Haare fliegen, die Wangen sind gerötet, ein Lächeln erhellt das Gesicht. Sie schwebt, fühlt sich frei. Aber dann schwindelt ihr auf einmal. Sie drehen sich langsamer und immer langsamer und halten mit keuchendem Atem an.
Caroline lässt die Arme fallen, wartet schüchtern auf weitere Anordnungen der Herrin. Anna richtet ihr Kleid, legt Caroline einen Moment die Hand auf die Schulter. «Danke», sagt sie, «du bist eine wunderbare Tänzerin. Die kleine Glocke erklingt, falls ich dich noch brauche.»
Die Tür schliesst sich hinter Caroline. Annas Atem ebbt aus. Sie kann es noch – das Leben in Unbeschwertheit geniessen. In kurzen Augenblicken zumindest.
Das Haar lässt sie offen. Nicht zur Besinnung kommen jetzt. Gleich wird sie Seigneux ihren Vorschlag unterbreiten. Sie steht vor seiner Tür, klopft. «Qui est-ce?», fragt er, seine Stimme klingt schläfrig. «Ich bin es, Jules-Emile.» Vorsichtig öffnet sie die Tür. Er liegt auf dem Bett, winkt sie heran. Sie zögert nicht, folgt seinem Zeichen.
Trub, Juni 1811
Zwei Tage später sind sie unterwegs. Der Kutscher lenkt das kleine Gefährt, dem nur ein Pferd vorgespannt ist. Niemand begleitet sie, dieser Besuch braucht keine Mitwisser. Teilnahmslos sitzt Seigneux an ihrer Seite. Freut er sich nicht? Das Verdeck ist gezogen, es ist drückend heiss in der Kutsche. Kein Wind geht, Wolken türmen sich im blauen Himmel. Als sie wieder zu Seigneux blickt, ist er in sich zusammengesunken und döst.
Anna setzt sich gerade hin. Sie ist allein zuständig – das ist nichts Neues. Manchmal sehnt sie sich nach einem verlässlichen Mann, der sie umsorgt. Doch wo ist dieser Mann? Konstantin hat einen wankelmütigen Charakter, er ist einmal so, einmal anders, und öfter hat er ihr Angst eingeflösst. Die Männer, die ihr in Russland den Hof gemacht haben, verehrten die schöne Grossfürstin. Linev? Er liebte Julchen und scheiterte daran, dass sie Grossfürstin war. Julchen ist sie nicht mehr – und wird sie für keinen Mann mehr sein.
Jeder Meter bringt sie dem Ziel näher. Die Kutsche kommt kaum voran, scheint ihr. Sie beugt sich aus dem Fenster, ruft dem Kutscher zu, schneller zu fahren. Seigneux brummt, schläft weiter. Die Pferde traben nun stetig. Der Weg zieht sich zwischen den Hügeln hin, die nach den Dörfern Langnau und Trubschachen zusammengerückt sind, die Kutsche quält sich über Stock und Stein. Hat sie diesen Weg nicht schon unter viel misslicheren Umständen zurückgelegt? Sie beobachtet die Landleute, die Gabel um Gabel das Heu wenden. Ein junges Bauernpaar sitzt etwas abseits unter einem Baum beim Imbiss, die Frau schneidet Brot, der Mann Käse, zwischen ihnen sitzt ein kleiner Knabe und spielt mit einem Stöcklein, wendet sich bald der Mutter, bald dem Vater zu, starrt zu den Vorbeifahrenden herüber, winkt. Sie winkt zurück, beugt sich vor, um das Bild in sich aufzunehmen, aber es löst sich im Staub der Kutsche auf.
Anna und Seigneux sind durchgeschüttelt, als die Kutsche endlich vor dem stattlichen Pfarrhaus in Trub hält. Kein Wort haben sie gesprochen, seit Seigneux aufgewacht ist. Mürrisch hat er vor sich hingestarrt, während Anna angestrengt die Hände zusammenpresst in Erwartung des Treffens, das ein Bote am Vortag im Pfarrhaus angekündigt hat.
Der Kutscher hilft ihnen heraus, Seigneux zieht an der Glocke. Frau Pfarrer Steinhäuslin macht persönlich auf, begrüsst das Paar, mustert den französisch sprechenden Herrn und die Dame, die betont einfach gekleidet ist und keinen Schmuck trägt – aber trotzdem vornehm wirkt. Wie bei jedem Besuch ist sie sicher, dass mit den beiden etwas nicht stimmt. Sie lässt sich nichts anmerken, ruft nach dem Mädchen, und dieses ruft seinerseits einen Namen. Man hört ein Trippeln auf der Treppe. Ein kleiner Knabe guckt vorsichtig durch die Stäbe des Treppengeländers. Die Dame strahlt, fliegt dem Kind über die Treppe entgegen, schliesst es in die Arme.
Warum verzichtet sie auf den Knaben, lässt ihn im Pfarrhaus fern von sich aufwachsen, wenn sie ihn so vermisst? Eine sonderbare Geschichte. Aber die Pfarrfrau ist milde gestimmt, weil sie den Kleinen mag und die Dame das Kind offensichtlich liebt. Ihr Mann hat mit Rudolf Schiferli, einem bekannten Frauenarzt in Bern, die Schule besucht. Doktor Schiferli hat ihr, als sie noch in der Stadt wohnten, bei der schwierigen ersten Geburt beigestanden – sie hätte sie ohne seine fachkundige Hilfe nicht überlebt. Franz-Albrecht hat eingewilligt, als Schiferli ihn bat, dieses Kind zu taufen. Und als er fragte, ob sie den Knaben für eine gewisse Zeit bei sich aufnehmen könnten, haben sie den kleinen Eduard ohne weiteres in ihre Kinderschar eingereiht.
Ihr war nicht klar damals, ob Franz-Albrecht mehr wusste von dieser Geschichte. Bei ihrer Nachfrage rückte er indigniert den Kneifer auf seiner Nase zurecht und gab keine Antwort. Die Neugierde übermannte sie. Als ihr Mann für einen Tag nach Bern fuhr, holte sie im Pfarrzimmer den Taufrodel hervor und schlug nach. Der Bub war am 20. Oktober 1808 als Eduard Edgar Schmidt-Löwe eingetragen, Vater Carl Schmidt-Löwe, reisender Künstler aus Hamburg, Mutter Sophie Müller; Taufzeugen waren der Vater und Maria Zaugg, Hebamme aus Grauenstein bei Trub. Der Vater ein Deutscher, auf der Durchreise? Er sprach doch Französisch; die wenigen deutschen Worte hatte er mit stark französischem Akzent gesprochen. Die Mutter eine Sophie Müller? Sophie als Vorname passte – ein feiner Name mit französischem Klang. Aber eine Frau Müller war diese deutsche Dame nicht, und vielleicht war sie auch keine Frau Schmidt-Löwe. War denn dieses Paar überhaupt verheiratet? Fragen über Fragen. Den Herrn mochte sie nicht besonders. Es war verständlich, dass ein Mann sich nicht mit einem kleinen Kind abgab. Aber er schien gelangweilt, sogar gereizt bei seinen Besuchen im Pfarrhaus.
Sie hat die Gäste in die gute Stube gewiesen. Der Herr schreitet nervös im Eingang auf und ab, und als Eduard ein paar Schritte zur Schwelle macht und die Ärmchen ausstreckt, kehrt er sich ab. Das Kind wendet sich wieder der Dame zu. «Mutter?», fragt es zögernd. Wahrscheinlich hat ihm das Mädchen den Besuch seiner Eltern angekündigt; sie selbst hat sich zurückgehalten. Die Dame scheint verwirrt. Sie zieht das Kind auf ihren Schoss, gleitet mit dem Finger über seinen Mund, beginnt es in ihren Armen zu wiegen und summt eine fremdländisch klingende Melodie, die die Pfarrersfrau nicht kennt. Der kleine Eduard schaut die Dame mit grossen Augen an, er scheint sich ihre Züge einzuprägen; aber plötzlich fallen ihm die Lider zu, er schläft ein.
Die Dame scheint selig, mit dem Kind in ihren Armen dazusitzen. Aber der Herr wird ungeduldig, ein Schwall französischer Worte kommt aus seinem Mund, die Dame schüttelt den Kopf, er stürmt aus dem Pfarrhaus, die Tür fällt ins Schloss. «Er wird wiederkommen», sagt sie und legt ihren Kopf an jenen des schlafenden Kindes. Die Pfarrfrau lässt sie allein in der guten Stube. Vielleicht heisst die Dame nicht Frau Schmidt-Löwe. Aber sie ist die Mutter von Eduard, das spürt man, und sie hat Anrecht, ein paar Stunden allein mit ihrem Sohn zu verbringen.
Als die Pfarrfrau zwei Stunden später mit einem Tablett mit Tee und Kuchen in die gute Stube tritt, juchzt Eduard im Spiel. Er läuft in die Arme seiner Mutter, sie hebt ihn hoch und wirbelt ihn herum, setzt ihn ab, er rennt ans andere Ende der Stube, dreht sich um, läuft wieder in ihre Arme, und alles beginnt von vorne. Die Wangen der Dame sind gerötet, sie sieht jetzt richtig schön aus, gelöst, glücklich. Atemlos setzt sie sich mit dem Kind an den Tisch, trinkt zwei Tassen Tee und lobt den Apfelkuchen. Der kleine Eduard nippt an seinem Glas Holundersirup, er schaut ins Gesicht seiner Mutter. «Bitte dableiben», fleht er, «nicht weggehen.» Ein Schatten zieht über das Gesicht der Dame. «Es geht nicht anders, Eduard», sagt sie, «ich muss heute noch abreisen, bald, wenn wir fertig gegessen haben.» Nun stopft das Kind Kuchen in sich hinein, langsam kaut es, schluckt bedächtig, vielleicht glaubt es, den Besuch der Mutter auf diese Art ausdehnen zu können. Aber dann öffnet sich die Tür, der Herr tritt ein, ungeduldig, er hat bereits anspannen lassen, das Pferd tänzelt vor dem Haus.
Die Dame erhebt sich, auf einmal bleich im Gesicht, Eduard klammert sich an ihre Röcke. Die Pfarrfrau ruft dem Mädchen, es nimmt den widerstrebenden Eduard auf, der wütend um sich schlägt, die drei Pfarrkinder verfolgen von der Treppe das Schauspiel, bevor ihre Mutter sie wegscheucht. Eduard weint, er streckt seine Arme aus nach der Dame, die ihm noch einmal übers Haar streicht und sich dann fast fluchtartig zurückzieht. Der Herr nimmt ihren Arm, schiebt sie draussen in die Kutsche. Eduard schluchzt laut auf, als sich die Kutsche in Bewegung setzt und an der Kirche vorbei aus seinem Blickfeld entschwindet.
Bei der Abfahrt laufen Tränen über ihr Gesicht, eine ganze Weile kann Anna nicht sprechen. Dann stellt sie Seigneux zur Rede: «Du hast ihn nicht begrüsst und nicht verabschiedet, hast dich abgewandt von deinem Kind.»