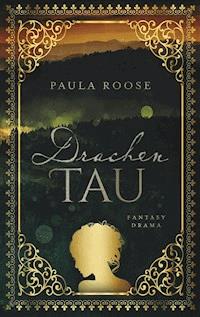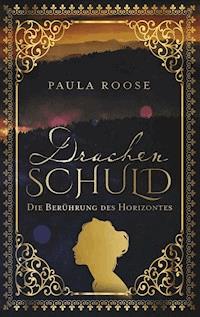Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Du kannst hier nicht bleiben!« Dieser Satz gehört zu Rudi wie ein ausgetretenes Paar Schuhe. Wunderbar vertraut und doch nicht tauglich für kalte Wintertage. Er sollte sich davon trennen, doch zu sehr hat er sich an das Leben auf der Straße gewöhnt, zu tief war der Fall, bevor er im Dreck landete. Er sehnt sich nach einem Neuanfang. Aber wie fängt man einen Neuanfang an? Eine Geschichte von Schuld und Vergebung. Und vom Glauben an Gott.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
1. Tag
»Du kannst hier nicht bleiben!«
Die Worte drangen von irgendwoher an sein Ohr, dumpf, als hätte er den Kopf unter Wasser. Er wollte es nicht hören. Es kam ja doch immer aufs Gleiche heraus. Nimm deine Sachen und geh! Also tat er, als bemerkte er nichts und hielt die Augen geschlossen. So konnte er wenigstens noch einen Moment bleiben.
»Komm schon, Rudi. Ich weiß, dass du nicht schläfst. Die Bibelstunde fängt gleich an. Die Leute wollen keine P… Obdachlose im Eingang.«
Er brummte etwas Unverständliches, nur um ein Geräusch von sich zu geben.
»Geh ins Pennerkästchen. Bei dieser Kälte kann man nicht draußen schlafen.«
Jetzt öffnete er die Augen. Sein Atem bildete einen feinen Nebel vor seinem Gesicht. Die Kirchennische am Seiteneingang war einer der wenigen Orte, die einigermaßen windgeschützt waren. Die anderen guten Plätze waren längst besetzt. »Pennerkästchen? Bis ich da bin, sind die voll.«
»Ich kann anrufen. Dann halten sie dir ein Bett frei.«
»Die reservieren nicht. Das weißt du.«
Der Mann, der mit ihm sprach, war Theo, Kastellan der Marktkirche. »Normal nicht. Aber mein Freund hat heute Dienst. Ich kann ihn bitten, so unter uns. Darfst du nur nicht verraten.«
Er hatte sich noch immer nicht bewegt. Von der Straße war das Klappen einer Autotür zu hören.
»Jetzt mach schon, Rudi. Ich will keinen Ärger.«
»Nee, schon klar. Penner unerwünscht.«
»So ist es jetzt auch nicht. Immerhin finanziert die Gemeinde einen guten Teil vom Pennerkästchen. Soll ich da nun anrufen oder nicht?«
»Ja, mach mal.« Er rappelte sich auf und sammelte seine Sachen zusammen: einen abgewetzten Rucksack und eine blaue Tragetasche mit Schlafsack und Isomatte.
Unterdes hatte Theo sein Handy gezückt. Das Telefonat dauerte keine Minute. Er nickte Rudi zu. »Eine viertel Stunde. Länger nicht. Schaffst du das? Ist ja nicht weit.«
»Ja, ja, geht schon.« Er wollte Danke sagen. Aber seine Lippen waren festgefroren, als er die ersten Stufen hinunterstieg. Rasch senkte er den Kopf und ließ Theo stehen. Der Kastellan war in Ordnung, drückte hin und wieder ein Auge zu, wenn er sich in die Nische gehockt hatte. Eigentlich wusste er selbst nicht, warum er dorthin ging. Vielleicht, weil die alten Mauern ein bisschen Wärme gespeichert hatten und man ihn von der Straße aus nicht gleich sehen konnte. Andere Obdachlose suchten nach Ladenschluss in den Eingängen der Geschäfte Zuflucht. Oder unter einer Brücke. Da war es sogar wärmer. Aber er mochte es nicht, wenn die Leute an ihm vorbeizogen. Und er mochte es nicht, wenn sie ihm Münzen hinwarfen. Obwohl jeder einzelne Euro ihn am Leben hielt. Ins Jobcenter für Wohnungslose ging er schon lange nicht mehr, um sich seine Stütze abzuholen. Dort warteten sie doch nur auf ihn, damit die Gläubiger ihn endgültig einbuchten konnten, weil er die gottverdammten Schulden nicht bezahlt hatte. Und Freiheit war das Einzige, das er noch besaß, außer seinem Schlafsack und seiner Therm-A-Rest, aufblasbar, fünf Zentimeter dick. Die hatte Theo ihm geschenkt.
Eine viertel Stunde? Das konnte er nicht schaffen, nicht, wenn er den normalen Weg nahm, geradeaus über die Brücke, im Bogen um die Innenstadt und an der Westtangente vorbei. Eine viertel Stunde reichte nur für den Weg durch die Elisenstraße. Nie wieder, das hatte er sich geschworen, nie wieder würde er einen Fuß auf deren Pflaster setzen.
Der Wind blies ihm hart ins Gesicht. Schnee legte sich auf den Asphalt. Inzwischen hatte er die Kreuzung erreicht, berührte mit den Füßen den Bordstein. Noch gebot das Ampelmännchen ihm, stehen zu bleiben. Er musste sich entscheiden. Irgendwohin würden seine Füße ihn heute Nacht tragen, ins Erfrieren oder ins Weiterleben. Es tat weh. Er wollte dieses Leben nicht. Aber er wollte auch noch nicht sterben. Nicht durch Kälte. Und nicht heute. Als das Ampelmännchen auf Grün sprang, lenkte er seine Füße Richtung Elisenstraße. Nicht einmal seinen Schwur konnte er halten. Dreckswelt, verdammte.
2. Tag
Das Kopfsteinpflaster führte ihn an Villen vorbei. Er brauchte sie nicht anzusehen. Jedes einzelne Fenster, jede Tür, jede Säule im Eingang kannte er bestens. Mit gesenktem Kopf kämpfte er sich durch das Schneetreiben und war froh, dass er nicht aufsehen musste. Ein gebeugt gehender Mann fiel bei diesem Wetter nicht auf. Ein Mann mit riesiger Plastiktüte in dieser Straße schon. Unwillkürlich spähte er in den Fenstern nach Blicken. Und dann sah er das Schild. Vorn neben dem Gartentor prangte es an den schmiedeeisernen Gitterstäben. Als wäre aus dem Nichts eine Mauer aufgetaucht und er dagegengeprallt, stoppte er.
Redlich und Partner
Fachanwälte für
Arbeits-, Verkehrs- und Familienrecht
Strafrecht
Natürlich war es ausgetauscht worden. Was hatte er erwartet? Hatte er gedacht, sein Name würde für immer dort stehen? Nach allem, was passiert war? Das Haus war schneeweiß, die schwarz glänzende Haustür mit Säulen eingefasst. Hinter den Scheiben im Erkerfenster war es dunkel. Um diese Zeit arbeitete niemand mehr. Redlich war nie dafür gewesen, Überstunden zu machen. Er selbst schon. Seine Hände begannen zu zittern. Hätte er an diesem beschissenen Tag nicht bis spätabends im Büro gesessen, alles wäre anders gekommen. Alles.
Irgendetwas zwang ihn, genauer hinzusehen. Hinter den Scheiben suchte er nach einer Bewegung. Aber er sah nur Gardinen mit Kreisen. Oder Spiralen? Das Muster kam ihm auf einmal bekannt vor. Klar, es waren seine Gardinen! Redlich hatte sie behalten. Alles hatte er behalten. Bis auf das Schild. Rudi hob den Rucksack von der Schulter, zog seine Rumflasche heraus und trank einen langen Zug. Das Zittern ließ nach. Eilig verstaute er die Flasche, schulterte den Rucksack und lief die Straße hinunter. Keine zehn Schritte weit, dann glitschte er aus und schlug hin.
Haus Fischerblick, wie das Pennerkästchen offiziell hieß, strahlte mit Lichterketten in den Fenstern. Das Holzständerwerk des Vordaches war mit Tannengrün verziert, in der gläsernen Eingangstür leuchtete ein Kreuz. Die Tür öffnete automatisch. Für Rudi zu plötzlich, er war in Gedanken noch bei seinen nassen Hosen und zuckte zusammen. Hinterm Tresen erblickte er Detlef, einen schrankartigen Mittfünfziger mit schmalem Lächeln.
»Ah, Rudi. Komm rein.« Er winkte ihn heran.
Zögernd blieb er auf der Schwelle stehen.
»Was ist? Willst du kein Bett?«
»Ist noch was frei?« Zwei Schritte vor, mehr schaffte er nicht.
»Ich hatte fünfzehn Minuten gesagt.«
»Sind es doch.«
»Nee, sind zwanzig. Du hast verdammtes Glück, dass kein anderer gefragt hat. Jetzt komm schon ran hier.«
Er musste sich einen Ruck geben, um die paar Meter durch die Vorhalle zu gehen.
Aus dem Flur ertönte Lachen.
Detlefs Gesichtsausdruck änderte sich, als er den Tresen erreichte. »Mensch Rudi, du weißt genau, dass Alkohol und Drogen hier nichts zu suchen haben. Blutalkohol zählt auch. Du bist betrunken.«
»Bin ich nicht.«
»Deine Fahne erschlägt mich.«
»Ein winziger Schluck. Das wird wohl noch erlaubt sein.«
»Ja. Aber nicht hier. Hol dir hinterm Haus eine Decke. Und dann komm morgen wieder. Rechtzeitig und nüchtern. Dann bekommst du auch ein Bett.«
Die Automatiktür schwang auf. Ein Mann trat ein und brachte einen eisigen Luftzug mit.
»Gibt’s noch ein Bett?«, fragte er, ohne Rudi anzusehen.
»Hast Glück«, antwortete Detlef und warf Rudi einen Blick zu. »Bis morgen, ja?«
Wenn es mich morgen noch gibt, dachte er, nickte und wandte sich zur Tür.
»Vergiss die Decke nicht«, rief Detlef ihm hinterher.
Als ob eine Decke es besser machte, dass sie ihn nicht hineinließen. Unterlassene Hilfeleistung, schoss es ihm durch den Kopf. Die Tür verschloss sich hinter ihm. Mit knirschenden Schritten lief er über den Schnee um das Haus herum zur Überdachung und zog sich eine Filzdecke vom Ständer. Dann hatte ihn die Straße wieder. Wenigstens die konnte ihn nicht abweisen. In der Altstadt gab es eine Gasse zwischen Fachwerkhäusern, abseits von Fußgängerzone und Menschentreiben. Sie schützte vor Wind und Regen und gab ihm ein wenig Hoffnung, dass es ihn morgen doch noch geben würde.
3. Tag
Die Gasse im historischen Stadtkern war so eng, dass sie nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß passierbar war. Zwischen zwei Fachwerkhäusern verbarg sich eine tiefe überdachte Nische. Man konnte sich darin einbilden, dass die Hauswände Wärme aus den Wohnzimmern hinter den Mauern abgaben. Das Beste aber war, dass die Bewohner sich nicht daran zu stören schienen, wenn ein Penner dort übernachtete. Jedenfalls redete er sich ein, dass er bleiben durfte und sie ihn nicht nur deshalb duldeten, weil sie ihn schlicht noch nicht entdeckt hatten. Er wurde nicht verjagt und das war seine Art, dazuzugehören, seit seine eigene Haustür hinter ihm zugefallen war.
Das Schneetreiben drang an diesem Abend bis zur Gasse vor. Zwischen den Hauswänden wirbelten die Flocken auf und nieder. Er kämpfte sich hindurch, zu seiner schützenden Nische waren es nur noch wenige Schritte. Aber als er hineinschlüpfen wollte, zuckte er zurück. Ein Menschenbündel hatte sich dort breitgemacht. Einen Moment hielt er verblüfft inne, dann preschte er vor und trat dem Eindringling ins Hinterteil. Nicht zu fest, nur deutlich. »Hey, verschwinde, das ist mein Platz.«
Der so Behandelte rührte sich träge und setzte sich, eine Entschuldigung murmelnd, auf. Doch als er sah, wer ihn getreten hatte, verfinsterte sich seine Miene. »Rudi, Mann, was fällt dir ein. Ich war hier zuerst.«
»Das ist mein Platz.«
»Er war leer. Weggegangen, Platz vergangen.«
»Woher weißt du überhaupt von dieser Nische?«
»Warum soll ich nicht davon wissen? Und jetzt troll dich. Hier liegt schon jemand.«
Er musterte den Eindringling. Thorsten war ihm körperlich überlegen. Wenn er seine Nische heute besetzen wollte, brauchte er eine andere Taktik als Tritte. »Hier ist Platz für zwei.«
»Bist du bescheuert? Zu zweit werden wir entdeckt. Dann ist Schluss mit lustig.«
»Nur, wenn du weiter so rumschreist. Also halt die Klappe und rück mal.«
»’Nen Teufel werd ich tun.«
»Und wenn ich meinen Rum mit dir teile?«
»Wie viel hast du denn?«
»Fast voll.«
Thorsten rückte zur Seite. »Her damit!«
Mit einem erleichterten Seufzen ließ Rudi seinen Rucksack auf den Boden gleiten. Er mochte Thorsten. Der raubeinige Tischler hatte einen hellen Verstand. Manchmal ergab sich sogar ein Gespräch über Politik mit ihm, das nicht in einem allgemeinen Statement über die Ungerechtigkeit der Welt endete. Er hatte sich schon manches Mal gefragt, warum Thorsten auf der Straße lebte. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem ein ehemaliger Rechtsanwalt es tat. Und diesen Grund zog er jetzt aus seinem Rucksack und reichte ihm die Flasche.
»Soso, fast voll nennst du das? Ich nenne das fast leer.« Thorsten riss sie ihm aus der Hand und setzte an.