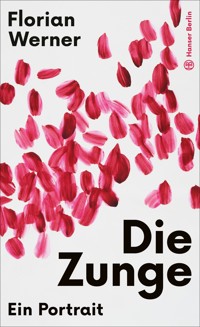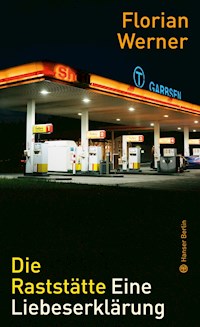7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Können Ohrenquallen uns den Aufbau des Universums erklären? Was wissen Trottellummen über Kierkegaards Sprung in den Glauben? Bringt uns das Känguru Jean-Jacques Rousseau näher? Und besteht die Tapferkeit der Löwenmännchen womöglich darin, dass sie so viel schlafen?
In einunddreißig so lehrreichen wie komischen philosophischen Betrachtungen geht Florian Werner der Frage nach, was wir von Tieren lernen können. Die erstaunliche Erkenntnis: Schaf, Kamel und Axolotl wissen weitaus mehr über Fragen der Moral, der Gesellschaft, der Politik und des guten Lebens, als wir uns träumen lassen. Wenn wir die Menschen verstehen wollen, müssen wir die Tiere fragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Können Ohrenquallen uns den Aufbau des Universums erklären? Was wissen Trottellummen über Kierkegaards Sprung in den Glauben? Bringt uns das Känguru Jean-Jacques Rousseau näher? Und besteht die Tapferkeit der Löwenmännchen womöglich darin, dass sie so viel schlafen?
In einunddreißig so lehrreichen wie komischen philosophischen Betrachtungen geht Florian Werner der Frage nach, was wir von Tieren lernen können. Die erstaunliche Erkenntnis: Schaf, Kamel und Axolotl wissen weitaus mehr über Fragen der Moral, der Gesellschaft, der Politik und des guten Lebens, als wir uns träumen lassen. Wenn wir die Menschen verstehen wollen, müssen wir die Tiere fragen.
Zum Autor
Florian Werner, 1971 in Berlin geboren, ist promovierter Literaturwissenschaftler sowie Texter und Musiker in der Gruppe Fön. Seine Bücher, darunter Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung (2009) und Schnecken. Ein Portrait (2015), wurden ins Englische, Spanische und Japanische übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, etwa als »Wissenschaftsbuch des Jahres« und mit dem »Literaturpreis Umwelt« des Landes Brandenburg. Florian Werner lebt mit seiner Familie in Berlin.
FLORIAN WERNER
Die
Weisheit
der Trottel-
lumme
Was wir von Tieren
lernen können
Illustriert von Andreas Töpfer
BLESSING
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Karl Blessing Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Umschlagabbildung: © iStock
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-22399-1V001
www.blessing-verlag.de
Hand aufs Herz, Pfote auf die Brust
Wir können Tieren nur wenig beibringen. Wir können Pferde lehren, bis drei zu zählen, Hunde dazu erziehen, ein Stöckchen zu apportieren, oder Seelöwen darauf dressieren, einen Gummiball zu balancieren und dabei in die Flossen zu klatschen. Allesamt Fähigkeiten, nach denen, seien wir ausnahmsweise ehrlich, weder im Tier- noch im Menschenreich ein Hähnchen kräht.
Umgekehrt sieht das vollkommen anders aus. Tiere haben uns nicht nur, wie bereits Demokrit erkannte, die meisten Künste und Handwerke beigebracht: die Spinnen das Weben, die Schwalben den Hausbau, die Schwäne und Nachtigallen das Musizieren. Sie können uns auch in die tiefsten Geheimnisse des Daseins einweihen. Tiere geben uns – manchmal durch lautliche Äußerungen, meist durch ihr vorbildhaftes Handeln – Antworten auf die größten Fragen der Philosophie. Sie sind, um es mit dem französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss zu sagen, »gut zu denken«.
Ohrenquallen können uns den Aufbau des Universums erklären, Zitterrochen die Obsessionen und Widersprüche der Moderne. Nacktmulle kennen das Geheimnis glücklicher Paarbeziehungen, Axolotl wissen um die Wichtigkeit unerfüllter Wünsche und Utopien, Ameisen haben eine klare Haltung zum bedingungslosen Grundeinkommen, und kanadische Dickhornschafe sind Spezialistinnen für die wirtschaftsphilosophische Theorie der Wachstumsrücknahme. Und die titelgebenden Trottellummen? Leben uns die Lehren eines großen dänischen Philosophen vor und wagen den tollkühnen Sprung in den Glauben.
In einunddreißig tierphilosophischen Betrachtungen geht dieses Bestiarium der Frage nach, was wir von Tieren lernen können. Anstatt dabei, wie es die längste Zeit in der westlichen Kulturgeschichte getan wurde, die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren stark zu machen, Letztere also als unser dunkles, irrationales, »bestialisches« Anderes zu begreifen, wollen wir uns dabei auf philosophisch wegweisende Gemeinsamkeiten konzentrieren. Schließlich sind wir, ganz nüchtern und bei taxonomischem Licht betrachtet, auch nichts weiter als Trockennasenprimaten mit Haarausfall.
Also hereinspaziert: Willkommen in einer Welt, wo der Hund die Dompteurspeitsche schwingt, der Buntspecht die Sitzmeditation anleitet und das Krokodil die Werke des Lao-Tse gefressen hat. Lauschen wir ihrem Bellen, Blubbern, Krähen, Quaken und Zinzelieren. Folgen wir ihren Lehren, orientieren wir uns an ihrem Beispiel. Werden wir Tiere wie sie.
DieAmsel
Im Garten meiner Kindheit, direkt vor unserem Balkon, stand eine stattliche Blautanne. Alljährlich im Frühjahr ließ sich auf ihrem Wipfel eine Amsel nieder und begann in aller Herrgottsfrühe zu singen; so laut, dass ich, wenn ich bei offenem Fenster schlief, davon erwachte. Das Lied war kraftvoll, melodiös, ich habe es bis heute im Ohr: ein beherzter Quartsprung nach unten, dann wieder zurück auf den Ausgangston, schließlich von diesem auf die große Terz und weiter auf die Dominante, ein perfekter Dur-Akkord. Beethoven, erklärten mir meine Eltern beim Frühstück: Die Amsel singt das Rondo aus dem Konzert für Violine und Orchester Opus 61 in D-Dur von Ludwig van Beethoven.
Inzwischen weiß ich: Das ist Quatsch. Die Amsel sang nicht die ersten Takte des dritten Satzes aus einem klassischen Konzert, sondern sagte: Das hier ist mein Revier. Oder vielleicht auch: Komm her, du holdes Amselweibchen. Oder: Schön ist es, auf der Welt zu sein. Oder: In wenigen Minuten muss die Sonne aufgehen, oder: Es sieht nach Regen aus, oder: Verdammt stachlig, diese Blautannennadeln, aber die Aussicht von hier oben ist unbezahlbar. Oder vielleicht sagte beziehungsweise sang sie auch das alles auf einmal.
Der große Vorzug des Vogelgesangs, schreibt der französische Philosoph Michel Serres, bestehe darin, dass er »pansemisch« sei, also alles-bedeutend. Was die Amsel mit ihrem Gesang genau »meint«, lässt sich demnach nicht eindeutig bestimmen: Der Sinn ihres Gezwitschers ist »kraftvoll ausgedehnt«, er erstreckt sich über viele Bedeutungswipfel und semantische Felder. Die menschliche Sprache hingegen, so Serres, sei bloß »monosemisch«, also auf eine Bedeutung beschränkt. Sie lässt keine vielsinnigen Akkorde erklingen, sondern ist »einsaitig« – zumindest ist sie, zumal in ihrer wissenschaftlichen Ausprägung, zumeist um semantische Klarheit und Eindeutigkeit bemüht. (Dass auch in der menschlichen Kommunikation Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse möglich sind, davon können wohl die meisten Menschen ein Lied singen.)
Dieses menschliche Streben nach Monosemie ist nun dem Philosophen zufolge mehr als bedauerlich: Denn zum einen erschlage das einengende, pointierende Sagen-Wollen »die Sprache derart, dass es selbst die besten Schriftsteller zu Opfern ihrer Kunst macht«. Und zum anderen berühre ein pansemischer Laut – sei es nun das Schlagen einer Amsel oder der Brunftlaut eines Homo sapiens – uns unmittelbarer und tiefer, als es klare, karge Kommunikationsakte jemals vermögen. »Unsere klagenden Modulationen des Begehrens oder der Trauer«, schreibt Serres, »erreichen die tiefen Neuronen unseres Reptiliengehirns, die wir mit Finken, Meisen und Kolibris teilen.« Anders gesagt: Durch die Lautlichkeit sind wir sowohl mit der übrigen Tierwelt als auch mit unserer eigenen Stammesgeschichte innig verbunden.
Aber wie können wir Menschen an dem beneidenswert deutungsoffenen Diskurs der Vögel, über begehrliches Stöhnen oder trauernde Seufzer hinaus, teilhaben? Am ehesten durch die Macht der Musik. Indem wir also unsere Sprachäußerungen vertonen, sie in Lieder setzen. Oder indem wir durch Assonanzen, Reime, Rhythmen und andere lautliche Lustbarkeiten die Pansemie des Federviehs frei nachzuformen versuchen; indem wir also (um nur einige der schönsten sprachlichen Umschreibungen für den Vogelgesang zu nennen) flöten und girren, zippen und zetschen, schackern und dacken, rülschen und knippeln, murxen und krolzen, zwitschern und tixen und quietschen und quinquilieren, wie’s uns die Vögel vortun.
Und wenn wir musikalisch besonders begnadet sind – dann komponieren wir womöglich nach Vogelvorbild ein ganzes Konzert. Denn auch das habe ich seit jenen blauen Morgenstunden meiner Kindheit gelernt: Die Amsel in unserem Garten sang nicht wie Ludwig van Beethoven – Beethoven imitierte, als er sein Violinkonzert verfasste, eine Amsel.
DerNacktmull
Eine große deutsche Tageszeitung bezeichnete ihn einmal als »Penis auf vier Beinen«, ein anderes Organ als »Säbelzahnwürstchen«: Der Nacktmull gilt vielen als das hässlichste Säugetier überhaupt. Tatsächlich ist der in den Halbwüsten Ostafrikas beheimatete Nager nicht gerade dazu angetan, bei menschlichen Betrachtern interesseloses Wohlgefallen zu wecken: Sein Körper ist wulstig und unbehaart, das Gesicht weitgehend konturlos, Augen oder Ohren sind kaum zu erkennen, dafür ragen aus dem Maul vier riesige sichelförmige Schneidezähne.
Den Nacktmull selbst dürfte solche Kritik allerdings wenig jucken. Zum einen ist er fast blind, blickt also gnädig über die vermeintlichen ästhetischen Defizite seiner Artgenossen hinweg; zum anderen ist er extrem schmerzunempfindlich. Entzündungen, Hitze, Hautverletzungen, Säure (und, so dürfen wir annehmen: ätzender Spott) können den Tierchen nur wenig anhaben. Sie werden von ihnen zwar durchaus wahrgenommen, aber nicht als besonders schmerzhaft empfunden. Verantwortlich dafür ist eine Veränderung im Aufbau der Nervenzellen: Die Schmerzrezeptoren sind bei ihnen evolutionär so modifiziert, dass eingehende Reize erst bei zehnfach erhöhter Konzentration der Signalstoffe weitergegeben werden. Wo andere Tiere sich vor Schmerzen winden, zuckt der Nacktmull nur kurz mit den Tasthaaren.
Der Grund für die bemerkenswerte Schmerzresistenz dürfte in der Lebensweise dieser Tiere zu suchen sein. Nacktmulle leben dicht gedrängt in stickigen unterirdischen Höhlensystemen, in Kolonien mit bis zu dreihundert Tieren. Ihre Zähne sind scharf, die Umgangsformen robust. Und: Die Angehörigen einer Kolonie stammen – wie Bienen- oder Ameisenvölker – alle von einer »Königin«, also derselben Mutter ab. Mehrere Hundert Verwandte, die ein Leben lang in engen, schlecht belüfteten Räumen zusammengepfercht sind? Wer da nicht schmerzunempfindlich ist, dürfte es nicht lange im Familienverband aushalten.
Leser von Arthur Schopenhauer dürften sich an dessen Fabel von den Stachelschweinen erinnert fühlen, die sich an einem kalten Wintertag so eng wie möglich zusammendrängen, »um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen«. Da sie sich dabei jedoch unwillkürlich durch ihre Rückenstacheln (das heißt: durch ihre »widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler«) verletzen, müssen sie wieder voneinander abrücken. Bis es ihnen zu kalt wird und das Bedürfnis nach Erwärmung sie wieder zusammenbringt: piks, aua und so weiter … So lange, bis die Schweine (das heißt: die Menschen) endlich eine »mittlere Entfernung« herausgefunden haben, in der sie es mehr schlecht als recht miteinander aushalten.
Taxonomisch gesehen mögen die Nacktmulle zwar zu den Stachelschweinverwandten gehören – allerdings sind sie ihren spitzborstigen Unterordnungsgenossen in sozialer Hinsicht weit überlegen. Zum einen haben sie keine Spieße, mit denen sie nähebedürftige Mitwesen verletzen könnten. Zum anderen sind sie so schmerzresistent, dass sie mit einer ganzen Stachelschweinrotte auf einmal kuscheln könnten, ohne sich von deren Sticheleien und Spitzfindigkeiten gestört zu fühlen. Anders gesagt: Sie sind das ideale Vorbild für all jene, die zu bequem sind, den heimischen Bau zu verlassen, zugleich aber meinen, die Nähe ihrer Familie nicht mehr ertragen zu können. Wer Cocooning mag, muss zum Nacktmull werden.
Er muss lernen, seine überreizten sozialen Schmerzrezeptoren zu desensibilisieren. Er muss seine Kleidung ablegen und allfällige Körperbehaarung entfernen. Er muss die Augen zusammenpressen, bis nur noch zwei kleine, faltige Schlitze erkennbar sind. Und dann – darf er an andere Nacktmulle denken und kuscheln.
DieTrottellumme
Alljährlich im Juni ereignet sich auf der Hochseeinsel Helgoland ein wahrhaft bestürzendes Schauspiel. An den markanten roten Sandsteinfelsen am westlichen Ende der Insel findet dann nämlich der sogenannte Lummensprung statt: Die etwa drei Wochen alten Küken der Trottellumme − ein großer Meeresvogel aus der Familie der Alkenvögel − treten an den Rand der Felsnische, in der sie geboren, gefüttert und bis dato von ihren Eltern unter die Fittiche genommen wurden. Bis zu vierzig Meter Fallhöhe trennen sie von der kalten Nordsee, ihrem zukünftigen Lebensraum, wo schon ein Elternteil auf sie wartet und sie mit Lockrufen ermuntert. Nach verständlichem Zaudern, Zögern und Zappeln breiten die Lummenküken schließlich ihre kurzen, zum Fliegen noch vollkommen ungeeigneten Stummelflügel aus. Dann stürzen sie sich kreischend von der Klippe und plumpsen wie ein gefiederter Stein in die Tiefe.