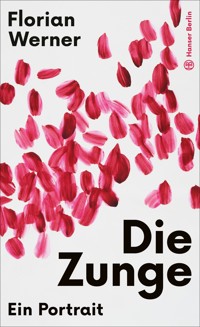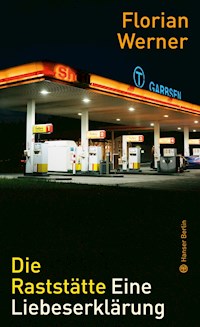16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bekannte Musikerinnen und Musiker über ihre Instrumente Ein Musikinstrument ist ein prägender Teil des Lebens. Das gilt für alle, die gern musizieren, vor allem aber für professionelle Musikerinnen und Musiker. Sie verbringen abertausende Stunden damit, kennen jeden Winkel seines Klangkörpers, haben gemeinsame Routinen — und natürlich Erinnerungen: an frühkindliche Unterrichtsstunden, an geteilte Erfolge, an traumatisches Scheitern. Viele lieben ihr Instrument, manche verzweifeln an ihm, für alle aber stellt es viel mehr dar als ein Werkzeug zur Tonerzeugung. Der Schriftsteller Florian Werner versammelt Beiträge zu den unterschiedlichsten Instrumenten: von der Geige über die Gitarre, die Trompete, den Bass und die Drehleier bis hin zum elektronischen Sampler. Bekannte Größen aus Pop, Rock, Klassik und Jazz stellen in Texten und Bildern ihre musikalischen Lebensgefährten vor. Sie erzählen vom Suchen und Finden des richtigen Instruments, von gemeinsamen Erlebnissen auf und abseits der Bühne, von den Freuden des Spielens und den Qualen des Übens — und davon, wie ein eigentlich unbelebter Gegenstand zu einem Wegbegleiter wird, den man nicht mehr missen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Meine bessere Hälfte
FLORIAN WERNER, 1971 geboren, schreibt erzählende Sachbücher und Prosa, lehrt an verschiedenen Hochschulen und arbeitet für den Hörfunk. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, zuletzt erschien Die Zunge. Ein Portrait. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Ein Musikinstrument ist ein prägender Teil des Lebens. Das gilt für alle, die gern musizieren, vor allem aber für professionelle Musikerinnen und Musiker. Sie verbringen Abertausende Stunden damit, kennen jeden seiner Winkel, haben gemeinsame Routinen – und natürlich Erinnerungen: an frühkindliche Unterrichtsstunden, an geteilte Erfolge, manchmal auch an traumatisches Scheitern. Dieser Band versammelt Beiträge zu den unterschiedlichsten Klangkörpern: von der Geige über die Gitarre, die Trompete und das Klavier bis hin zum elektronischen Sampler. Angesehene Interpret innen erzählen vom Suchen und Finden des richtigen Instruments, von Erlebnissen auf und abseits der Bühne, von den Freuden des Spielens und den Qualen des Übens – und davon, wie ein unbelebter Gegenstand zu einem Begleiter wird, den man nicht mehr missen will.
Florian Werner
Meine bessere Hälfte
Musiker*innen erzählen über ihre Instrumente
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © Anna Ingerfurth / VG Bild-Kunst, Bonn 2024Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Autorenfoto: © Joachim GernE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3277-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Der Auftakt
Die Erste
Die Geige
Die Bratsche
Das Cello
Der Aufbau
Der Bogen
Das Klavier
Die Stimme
Die Gitarre
Die Drehleier
Die Sitar
Das Schlagzeug
Die Trompete
Das Saxofon
Die Tuba
Die Flügel
Das Gehirn
Das Studio
Das Pferd
Die Schallplatten
Die Klaviatur
Der Klangkörper
Die Gelbe
Die Weggefährten
Die Mandoline
Die Gitarre meines Bruders
Orgel versus Saxofon
Die Keyboards
Sampler, Synthesizer, Drumcomputer & Co
Der Bass
Die Gitarre
Die Mundharmonika
Das Klavier meiner Cousine
Buddies
Der Sauerstoff
Biografien der Beiträger*innen
Dank
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Der Auftakt
Der Auftakt
Von Florian Werner
Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Seit über vier Jahrzehnten bin ich nun schon mit meiner Bratsche zusammen, das ist doppelt so lang wie die Beziehung zu meiner Frau, länger als die meisten meiner Freundschaften – mein ganzes erwachsenes Leben. Meine Bratsche hat mich schon durch die USA, die Ukraine, durch Russland, Lettland, Polen, Rumänien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Italien, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Österreich und die Schweiz begleitet, sie wurde von argwöhnischen amerikanischen Zöllnern auf Sprengstoff untersucht und von misstrauischen russischen Grenzern für Hehlerware gehalten, sie war sengender provenzalischer Sonne und beißendem schottischen Nebel ausgesetzt, musste Abertausende von Stunden in verrauchten Kneipenhinterzimmern oder muffigen Backstage-Bereichen auf mich warten und blieb einmal sogar an einem Provinzbahnhof liegen – aber verlassen hat sie mich nie. Meine Bratsche ist eine der wenigen Konstanten in meinem Leben.
Trotzdem ist unser Verhältnis, wie gesagt, nicht ganz einfach: Zu sagen, es handle sich um »eine Art Hassliebe«, ist ein Klischee, kommt der Sache aber doch ziemlich nahe. Wie oft habe ich schon meine eigenen musikalischen Unzulänglichkeiten auf das arme Instrument projiziert! Wie oft habe ich meine Bratsche gequält, frustriert auf ihr herumgeschabt, ihr grässlich klagende Laute entlockt, wenn doch ich selbst es war, der hätte schreien mögen. Einmal, nach einem besonders traumatischen Auftritt, wollte ich sie auf der Hobelbank eines befreundeten Tischlers von ihren irdischen Qualen erlösen, Asche zu Asche, Holz zu Holz – zum Glück ging der Tischler dazwischen. Als es allerdings ein andermal bei mir im Haus brannte und die Rauchschwaden schon dicht im Zimmer standen, schnappte ich schlaftrunken als Erstes meine Bratsche, als handelte es sich um ein Kind, das es zu retten gälte. Frühmorgens um halb vier stand ich im Pyjama auf der Straße, das Instrument in der Hand, und fragte mich: Was ist das nur für eine merkwürdige Beziehung?
Denn was für mich als musikalischen Laien gilt, das gilt ja noch weitaus mehr für professionelle Musikerinnen und Musiker. Sie verbringen ungezählte Stunden mit ihrem Instrument, kennen jeden Winkel seines Klangkörpers, haben gemeinsame Routinen und Rituale: Obwohl es sich letztlich »nur« um einen unbelebten Gegenstand handelt, stellt es doch sehr viel mehr als ein Werkzeug zur Tonerzeugung dar. Das Instrument ist gewissermaßen eine Prothese, ein ausgelagerter Teil des menschlichen Körpers; oftmals der Teil, mit dem sich Musiker*innen am besten artikulieren können. Wie wirkt sich dieses Zusammenleben auf die Beteiligten aus? Wie prägt der Mensch sein Instrument, wie das Instrument den Menschen? Welche Erinnerungen und Geschichten verbinden sie miteinander? Ja, handelt es sich bei dem jeweiligen Musikinstrument womöglich, wie man bisweilen von menschlichen Lebensgefährten sagt, um die »bessere Hälfte«?
Diese und ähnliche Fragen habe ich herausragenden Musikerinnen und Musikern gestellt und sie gebeten, von der Beziehung zu ihrem persönlichen Lebens- oder Lieblingsinstrument zu erzählen. Das musikalische Spektrum ist weit, es reicht von Pop über Klassik, Jazz, Blues und Rock bis hin zu entlegeneren ästhetischen Entwürfen wie Drone-Folk, Ambient Techno, Knochenflötenimprovisationen und osteuropäischem Ska-Punk. Die Antworten sind so unterschiedlich wie die beteiligten Künstler*innen und ihre Instrumente: Die Geigerin Anne-Sophie Mutter etwa pflegt eine absolut exklusive Beziehung zu ihrer Violine und lässt keinen anderen ihre Stradivari auch nur anfassen. Der Gitarrist Thorsten Nagelschmidt weint seit Jahren seiner gelben Gibson Les Paul Special hinterher, wagt aber nicht, dasselbe Modell noch einmal zu kaufen, weil er damit sein »eigentliches« Instrument betrügen würde. Der Tubist Andreas Martin Hofmeir preist das unvergleichliche Orangenblech seiner allerersten, altehrwürdigen Tuba Ursula (auch wenn mittlerweile eine jüngere Tubadame namens Fanny deren Platz eingenommen hat). Den Saxofonisten Benjamin Koppel plagt nach jahrzehntelangem Spielen eine Metallallergie, die ihn aber niemals von seinem geliebten Instrument fernhalten könnte. Der Cellist Steven Isserlis vermutet, dass in seinem Cello der Geist früherer Besitzerinnen wohne. Für die Jazz-Musikerin Aki Takase ist das Klavier »wie ein unersetzlicher Geliebter«. Der Sänger Jochen Distelmeyer hingegen begreift seine Gitarre auf keinen Fall als bessere Hälfte, sondern eher als inneren Kompass, als Fluggerät, ja, als pazifistische Waffe: »This machine kills fascists.«
Den Begriff Instrument habe ich bewusst weit gefasst. Natürlich, für Pianisten wie Michael Wollny oder Chansonniers wie Sebastian Krämer stellt der Flügel (beziehungsweise »die Klaviatur«) das bevorzugte Tonwerkzeug dar, und für Songwriter wie Frank Spilker ist es die Gitarre. Bei anderen ist es komplizierter: Sängerinnen wie Inga Humpe oder Bernadette La Hengst begreifen die menschliche Stimme als Musikinstrument. Für Yuriy Gurzhy, Mitbegründer und DJ der legendären »Russendisko«, ist es seine so umfangreiche wie eklektische Plattensammlung. Für den Musikproduzenten Console ist es das eigene (und katzenhaft eigenwillige) Tonstudio. Der Konzeptkomponist Matthew Herbert verarbeitete für eines seiner letzten Werke ein ausgewachsenes Pferd zum Klangkörper. Und die Sängerin Balbina begreift die graue Masse in ihrem Schädel als Musikinstrument, mit dem sie ihre Inspirationen nach außen transportiert: »Ich muss so mit dem Gehirn spielen, dass sich in ihm für kurze Momente eine Sinfonie meiner Träume bildet.« Neben den üblichen Verdächtigen kommen außerdem auch ungewöhnliche Instrumente wie die Drehleier von Danielle de Picciotto, die Mandoline von Masha Qrella oder die Sitar von PeterLicht zu Gehör.
Zugegeben: Die Auswahl der Musiker*innen ist subjektiv, sie spiegelt (wie sollte es anders sein?) persönliche Prägungen und Vorlieben des Herausgebers wider. Die zwischen apollinischer Schönheit und dionysischer Brachialität schwankenden Trompetensoli von Nils Petter Molvær gehören zu den prägenden Hörerfahrungen meines Lebens. Die manischen Beats des Siouxsie-and-the-Banshees-Schlagzeugers Budgie begleiten mich schon seit den Achtzigerjahren, ebenso die wundersam verschrobenen Songs des britischen Pop-Exzentrikers Robyn Hitchcock. Und dass die grandiose Bratschistin Tabea Zimmermann hier so liebevoll von ihrem Verhältnis zur Viola erzählt, von einer harmonischen Beziehung, die mir selbst mit meiner Bratsche nicht annähernd vergönnt war, ist mir natürlich eine besondere Ehre und Freude.
Über zwanzig Musiker*innen und Dutzende verschiedener Instrumente sind auf den folgenden Seiten versammelt. Sie gruppieren sich zu Ensembles, bilden hier ein Streichtrio, da eine Band, dort einen Chor. Sie finden sich zu Proben, Quartett-Abenden und Jam-Sessions zusammen, spielen spontane Konzerte, die so noch nie stattgefunden haben, die vermutlich niemals stattfinden werden, ja, die wahrscheinlich überhaupt nur im Resonanzraum eines Buches möglich sind. Hören Sie gut hin! Welche Stücke oder Songs dabei erklingen – das ist allein Ihrer Fantasie überlassen.
Die Erste
© Frank Spilker
Von Frank Spilker
Meine Erste war eine Framus aus den Sechzigerjahren, die ein Freund meines Bruders auf dem Dachboden liegen hatte und die erst noch restauriert werden musste, bevor man sie benutzen konnte. Genauer: Sie hätte restauriert werden müssen, damit man sie hätte benutzen können. Ich benutzte sie trotzdem und lernte meine ersten Akkorde auf ihr.
Obwohl es auch sehr gute Gitarren von dieser Firma gab, sind die meisten der heute nur noch gebraucht erhältlichen Exemplare billige Kaufhausmodelle, die notorisch schlecht verarbeitet sind. So schlecht, dass sie sich, wie meine, gar nicht wirklich stimmen lassen. Ich drehte an den Wirbeln herum und wusste nicht, woran es lag, dass bei mir kein einziger Akkord gerade herauskam. War ich etwa untalentiert? Es gab leider niemanden, der mir helfen konnte, und mir kam nicht einmal der Gedanke daran, dass es vielleicht gar nicht an mir, sondern an der Gitarre liegen könnte.
Trotzdem war die Framus meine erste große Liebe. Ich schleppte sie mit auf die Jugendfreizeit in der Lüneburger Heide, klebte ihr eine rote Rose auf den Korpus und gab erste Konzerte oben auf einem der Doppelstockbetten, während meine Mitmusiker auf den anderen Doppelstockbetten saßen und sangen. Zusammen »performten« wir die Lieder der Mundorgel. Das war in den Achtzigerjahren offensichtlich immer noch der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um das Klampfen am Lagerfeuer ging. Da ich wegen des einsetzenden Stimmbruchs zum Singen schlicht nicht in der Lage war, fand ich meine Rolle in der musikalischen Begleitung. Dabei konnte ich nicht einmal das besonders gut. Bei manchen Tonleitern fehlte mir schlicht noch das Akkordwissen. Aber es hat funktioniert: Martina hat für mich geklatscht. Und das hat mich glücklich gemacht.
Glücklicher jedenfalls als die Instrumente, die eigentlich für mich bestimmt waren: die Blockflöte und das Klavier. Beide Instrumente hatten den didaktischen Zweck, mir das Notenlesen beizubringen, wobei sich Didaktik für mich immer ein bisschen so angehört hat wie Diktatur. Obwohl, ich mochte meine erste Klavierlehrerin, und ich mochte auch das Instrument. Dass die Gitarre immer nur Mittel zum Zweck gewesen sein soll, stimmt allerdings auch nicht. Nachdem ich mich durchgekämpft und nicht aufgegeben hatte, die Framus halbwegs in Stimmung zu bringen, bekam ich endlich, noch vor dem Konfirmationsgeld, den nötigen Betrag für ein funktionierendes Modell zusammen: eine Westerngitarre von Yamaha. Auch ein billiges Ding eigentlich, aber ausreichend gut verarbeitet, um den Lernenden nicht völlig zu frustrieren.
Ich muss hier kurz einschieben, dass mein Fachwissen über die Qualität, Verarbeitung und den Sound von Akustikgitarren sehr lückenhaft ist. Bis auf den heutigen Tag fürchte ich die Begegnung mit »richtigen« Gitarristen, den sogenannten Profis – jedenfalls dann, wenn sie sofort von Marken, Hölzern und Mechaniken zu sprechen anfangen, von denen ich keine Ahnung habe. Es ist manchmal sehr schwierig, aus so einer Situation wieder herauszukommen, weil man immer wieder merkt, dass es den Profis doch recht wichtig ist, über ihr Instrument zu sprechen, und dass es sie anscheinend auch verletzt, wenn man an diesem Gespräch nicht so interessiert ist, wie sie es sich erhoffen.
Zurück zum Thema: Die Yamaha habe ich geliebt. Sie war nicht so zickig wie die Framus und hat mich allein schon durch ihren Klang berauscht. Oft habe ich mein Ohr direkt an den Korpus gelegt, um mich in der warmen, weichen Wolke eines e-Moll-Akkords zu beruhigen. Meistens direkt nach der Schule. Das hat erstaunlich lange funktioniert, bis sich der Effekt durch die Wiederholung abgenutzt hat. Dann musste der Akkord gewechselt werden, und schon bald wurde mit dem zweiten oder dritten Akkord ein Song draus. Dieser Klang und die Songs, die bald entstanden, waren wichtig für mich, und zwar unabhängig davon, ob Martina das mochte.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Sound des Klaviers mich ähnlich bewegt hätte wie der der Gitarre. Außer natürlich, wenn Opa »Ich bete an die Macht der Liebe« darauf spielte. Er hatte eine fürchterliche Kraft im linken Arm, weil er immer den Hof fegte. Das war eine seiner Hauptbeschäftigungen. Der Weg, um auf dem Klavier so weit zu kommen, erschien mir damals aber als zu lang. Und alles am Klavierunterricht war analytisch. Erst mal Noten lesen, erst mal Tonleitern üben, erst mal nur einen Finger pro Hand usw. Ich wollte weder Tonleitern üben noch den Hof fegen. Das sollte Opa ruhig weiter machen.
Die Gitarre habe ich dann autodidaktisch erlernt, aber nicht allein. Der Vater meines besten Freundes hat uns die Brosamen hingeworfen, die wir mühsam aufgepickt und verarbeitet haben. Anstatt uns zu unterrichten, hat er uns etwas vorgespielt und uns motiviert, ganz im Sinne von Antoine de Saint-Exupéry: »Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer.« Die beste Idee.
Nach der Mundorgel kam Peter Burschs Gitarrenbuch. Die Bibel der Autodidakten, die zusammen mit einer Schallfolie geliefert wurde – das war eine äußerst dünne und leichte Version einer Schallplatte, auch »Flexi Disc« genannt; man musste sie auf eine andere, dickere Schallplatte legen, damit man sie abspielen konnte. Nach getaner Gitarrenarbeit im Partykeller erholten wir uns zu den Klängen von Kraftwerk, Pink Floyd oder Meditationsmusik von Tangerine Dream oder Mike Oldfield. Es wurde alles durcheinandergeworfen, und immer wieder wurden die Beatles gespielt. Das Beatles Complete-Songbook (Gitarrenausgabe) war bald wichtiger als die von Peter Bursch empfohlenen Folk-Songs von Dylan, Cohen et al. Und so gerieten die ersten eigenen Kompositionen zu einer Mischung aus Folk, Beat und Meditationsmusik mit Gitarre am Ohr.
Bald schon würden wir die Erfahrung machen müssen, dass so etwas nun wirklich niemand hören wollte. Das war eine ebenso schmerzhafte wie wichtige Erfahrung, die man nur machen kann, wenn man sich wirklich heraustraut mit dem, was man macht und tut – ob es Instrumentalmusik ist, Coverversionen oder sogar eigene Songs. Letzteres ist die Königsdisziplin, weil man ja so viel von sich preisgeben muss, und man fängt am besten damit an, bevor die Pubertät einsetzt.
Kurzer Exkurs: In unserer Nachbarschaft, im Rosenweg, gab es zwei sehr talentierte junge Musiker, die hießen Simon und Garfunkel. Eigentlich hießen sie Simon Müller und Thorsten Sadowski, aber für uns nur Simon und Garfunkel. Sie schrieben die wunderbarsten Instrumentals für zwei Akustikgitarren oder mehr. Manchmal sangen sie auch, sogar selbst geschriebene Gesänge, die vom Stimmbruch komplett ungetrübt waren. Als wir sie aber fragten, ob sie mal mit uns auftreten würden, protestierten sie vehement. Es stand für sie außer Frage, ihr von Pubertätsdüften parfümiertes Zimmer jemals für ein Konzert, gar für ein öffentliches, zu verlassen. Und so ist dann auch nie etwas aus ihnen geworden. Jedenfalls nichts Vernünftiges wie Folk- oder Schlagersänger.
Die Erfahrung, dass der Erfolg doch nicht immer so durchschlagend ist, wie man ihn sich ausmalt, habe ich ebenfalls zum Glück nicht allein machen müssen. Es ist nämlich gar nicht leicht, aus all dem falschen Applaus und vergifteten Lob um einen herum herauszufiltern, was einem wirklich gesagt werden soll. Einer der schönsten Songs, den ich zusammen mit Kumpel Carsten geschrieben habe, war »Afrika«. Er ist glücklicherweise nicht erhalten, die Realität hätte keine Chance gegen die Erinnerung: zwei klampfende Dreizehnjährige, die ihre Utopie an einen Ort Namens Afrika heften, von dem sie keine Ahnung haben. Nichts als eine exotistische Schwärmerei, getriggert von Tierfilmen wie Die Wüste lebt von Walt Disney. Genug allerdings, um den Inhaber des örtlichen Reformhauses zu begeistern. Der ehemalige Afrikareisende wollte uns ganz groß herausbringen. Leider erinnerte er sich am nächsten Tag nicht mehr daran. Im letzten Moment kaufte er sich mit zehn D-Mark pro Musiker aus dem in Trunkenheit gegebenen Versprechen, er werde uns produzieren, heraus. Aber immerhin, ein erster Schritt war gemacht. Und jetzt hieß es, nicht aufgeben, sondern weiter komponieren und auftreten. Irgendwann würde es dann schon klappen mit dem Erfolg.
Die Gitarre ist in dieser Zeit für mich von einem Sucht- und Schmerzmittel zu einem sozialen Ort geworden. Ich kann gar nicht sagen, ob hinter der Entwicklung eine Entscheidung gesteckt hat. Die Hormone kickten rein. Es war eine Menge los. Wer erinnert sich schon so genau? Die Jugend- und Jungsfreundschaften wurden überlagert von Cliquen und Flirts, und an die Stelle von Folk und Mundorgel trat Punk in mein Leben. Postpunk, um genau zu sein. Erst in Form von Goth und Gruppen wie Joy Division, danach etwas lebensbejahender durch New Wave und NDW. Und was machten die Gitarren bei, sagen wir, Siouxsie and the Banshees? Ungefähr das, was sie bei The Cure auch machten: in erster Linie Sound. Das Instrument, das den Ton unter und hinter dem Chorus-Effekt hervorrief, war eigentlich relativ egal. Hauptsache, es sah gut aus. (Übrigens bewundere ich die Gitarrenarbeit von Robert Smith. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt: Sein Handwerk war und ist die Dramaturgie.)
Vielleicht kann ich doch sagen, wer dafür verantwortlich war, dass aus der Gitarre ein sozialer Ort für mich geworden ist: Sie hießen Helmut, Emil, Angela, Michael, Heike, Kathrin etc. Sie hatten Martina den Rang abgelaufen und gingen immer ins Forum Enger. Dort liefen an lauen Tagen Bauhaus und The Cure als VHS-Video. Der Fernseher stand auf der Tanzfläche. An den weniger lauen Tagen standen wir auf der Tanzfläche. Oder am Tresen. Zunächst schüchtern und mit einem süßen alkoholischen Getränk in der Hand, später selbstbewusst mit Bier und Kippe. Außerdem haben wir Konzerte angeschaut. Und zwar alle. Und die Bands, die dort zu sehen waren, hatten meist Gitarren dabei. Immer war das Instrument auch der Ausweis der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule. Die an den Sixties orientierten Bands spielten Rickenbacker, Punk-Bands oft Gibson oder eine billige Kopie davon. Frühe Post-Rock-Bands, vor allem wenn sie aus Amerika kamen, immer noch gerne Fender. Wenn es Richtung Punk ging, musste das aber eine Telecaster sein. Nur die Feelies spielten noch eine Stratocaster. Entschuldigung, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen nerdig.
Weil es dabei auch um Identität und nicht ausschließlich um den Sound ging, durfte die erste E-Gitarre eben auch nicht aussehen wie die von Carlos Santana, Mark Knopfler oder anderen Gitarrengöttern, die sich immer so fürchterlich ins Zeug gelegt haben, anstatt einfach zu spielen. Und schon gar nicht durfte sie aussehen wie die von Rudolf Schenker von den Scorpions. Ich hatte spezielle Anforderungen: Meine erste E-Gitarre sollte künstlich aussehen. Ein Vorbild aus der Zeit ist vielleicht die Band DEVO. Aber auch andere New-Wave-Bands, die ich gut fand, benutzten eher künstlich aussehende Gitarren, um sich von der Norwegian Wood-Zeit, also den Siebzigerjahren, abzugrenzen. Das Instrument sollte aber auch etwas besser verarbeitet sein als meine alte Framus, damit das schöne Konfirmationsgeld nicht verschwendet wäre.
Was nach langer Überlegung und dem Durchblättern vieler Fachzeitschriften herauskam, war ein Modell der Firma Hamer, das auch Rudolf Schenker hätte spielen können und das in einer Art und Weise lackiert war, die an ein T-Shirt von Klaus Meine erinnerte. Offenbar wurde ich schlecht beraten von den Gitarrenverkäufern mit Vokuhila-Frisuren im nächsten großen Musikhandel in Ibbenbüren. Ich fuhr mit meinem besten Kumpel Carsten zweimal dorthin. Per Anhalter. Beim zweiten Mal mussten wir abgeholt werden, weil niemand uns mitnahm auf dem Rückweg, denn es wurde dunkel, und dann hält keiner mehr an. Aber ich hatte endlich eine E-Gitarre dabei. Und sie funktionierte.
Im Unterschied zu der Westerngitarre, die sich zusammen mit meiner Fotoausrüstung entschieden hat, in Rotterdam zu bleiben, spiele ich sie heute noch ab und zu. (In Rotterdam hatten wir einen Forschungsauftrag zum Thema Gabber, einem neuen, heißen Trend in der elektronischen Musik. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich dazu die Gitarre mitgenommen habe.) Da es der Hamer etwas an Bühnenstabilität mangelt, habe ich ihr allerdings eine etwas rückgratstärkere Gibson Special, also die Gitarre, die von klassischen Punk-Rock-Bands gespielt wird, an die Seite gestellt. Und weil einen auf der Bühne nichts mehr interessiert als Stabilität, damit man nicht von der Technik abgelenkt wird, spiele ich mittlerweile hauptsächlich dieses Instrument.
In Hamburg – jedenfalls zu der Zeit, als ich nach Hamburg kam – wurde übrigens die Framus-Gitarre gefeiert. Gerade die billigen Kaufhausmodelle lieferten den Sound von Sonic Youth. Trotz aller Sympathie für den Gedanken, dass man etwas ja nicht unbedingt wohlklingend sagen muss, wenn man es auch misstönend sagen kann, konnte ich mich nie mehr wirklich mit der Framus anfreunden. Zu groß war der Schmerz, wenn ich an meine Erste denken musste.
Die Geige
© Florian Leonhard, Fine Violins
Von Anne-Sophie Mutter
Als kleines Kind dachte ich immer, eine Geige wäre ein Lebewesen. Weil sie so schöne Geräusche von sich gibt, wie eine schnurrende Katze – und wenn sie mal quiekte, hatte ich den Eindruck: Das tut der Geige jetzt weh. Deswegen habe ich mich immer bemüht, meiner Geige keine Schmerzen zuzufügen, und habe das Kapitel »Es klingt wie eine kranke Katze« in meiner musikalischen Biografie relativ mühelos übersprungen. Weil ich eben wahnsinnig motiviert war, dieses kleine Wesen pfleglich zu behandeln.
Eigentlich habe ich ja zunächst Klavier gespielt, ich hätte also auch die Möglichkeit gehabt, mich in dieses Instrument zu verlieben. Aber ein Streichinstrument ist eben doch intimer. Weil es ein Partner fürs Leben ist, eine langfristige Verbindung, die man als Pianist mit seinem Instrument so nicht eingehen kann. Das war ein Aspekt, der mich an der Geige immer fasziniert hat: dieses Ausschließliche der Beziehung. Und die Unmittelbarkeit der Klangerfahrung. Beim Tasteninstrument ist es ja so: Wenn der Klang erklingt, ver-klingt er schon wieder – aber im Strich eines Bogens kann ich ein ganzes Spektrum an Klangskulpturen entstehen lassen. Ich kann den Klang anschwellen und wieder verebben lassen, ich kann durch das Vibrato im Augenblick des Klangerscheinens eine ganze Welt zaubern. Das hat mich schon als Kind fasziniert – und es fasziniert mich, mehr als ein halbes Jahrhundert nach meiner ersten Geigenstunde, noch immer.