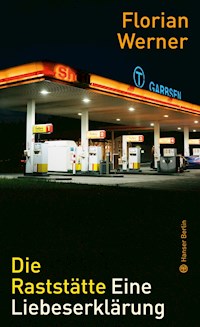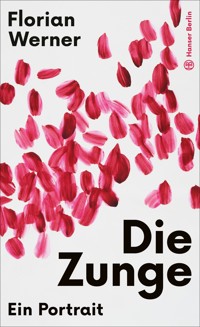
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Wir haben alle eine – merken es aber erst, wenn wir uns am liebsten draufbeißen würden.“ (Mithu Sanyal) Florian Werner ergründet in seinem Portrait „Die Zunge“ bekannte und unbekannte Facetten dieses Körperteils. Sprechen, Schmecken, Lecken, Küssen, Zeigen: Die menschliche Zunge ist der soziale Muskel schlechthin. Wer aber respektiert werden will, sollte sie im Zaum halten. Fast könnte man meinen, dass wir diesem Organ, das so zentral ist für unsere Weltbeziehung, misstrauen. Als wäre die Zunge ein Wesen mit eigenem Willen – unberechenbar wie die Schlange, die eine gespaltene Zunge hat. „Die Zunge“ beschreibt dieses Organ erstmals in seiner ganzen Komplexität: als Sprachinstrument und Geschmacksorgan, als erogene Zone und obszönes Zeichen, als Gegenstand von Literatur, Musik, Kunst, Film und Werbung. Florian Werner setzt diesem unterschätzten Körperteil endlich das Denkmal, das er verdient.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Wir haben alle eine — merken es aber erst, wenn wir uns am liebsten draufbeißen würden.« (Mithu Sanyal) Florian Werner ergründet in seinem Portrait »Die Zunge« bekannte und unbekannte Facetten dieses Körperteils.Sprechen, Schmecken, Lecken, Küssen, Zeigen: Die menschliche Zunge ist der soziale Muskel schlechthin. Wer aber respektiert werden will, sollte sie im Zaum halten. Fast könnte man meinen, dass wir diesem Organ, das so zentral ist für unsere Weltbeziehung, misstrauen. Als wäre die Zunge ein Wesen mit eigenem Willen — unberechenbar wie die Schlange, die eine gespaltene Zunge hat.»Die Zunge« beschreibt dieses Organ erstmals in seiner ganzen Komplexität: als Sprachinstrument und Geschmacksorgan, als erogene Zone und obszönes Zeichen, als Gegenstand von Literatur, Musik, Kunst, Film und Werbung. Florian Werner setzt diesem unterschätzten Körperteil endlich das Denkmal, das er verdient.
Florian Werner
Die Zunge
Ein Portrait | Hanser Berlin
für Jim
kosten
Study my tongue!
White Noise
Plötzlich ist sie in aller Munde.
Nachdem die menschliche Zunge jahrtausendelang, im eigentlichen Sinne des Wortes, ein Schattendasein fristete, verlässt sie neuerdings immer häufiger ihren verborgenen Ort im Oralraum und fordert die ihr zustehende Aufmerksamkeit. Sie biegt sich. Sie rollt sich zusammen. Sie reckt und streckt sich, sie leckt lasziv die ihr nahe stehenden Lippen, spricht selbstbewusst von ihren Fähigkeiten und zeigt sich in all ihrer verkannten Pracht. Ich, so scheint sie mit jeder speichelschimmernden Papille, mit jedem Zucken eines ihrer zahlreichen Muskel bekräftigen zu wollen, bin ein vielsagendes Wesen. Ein Zentralorgan. Vielleicht der wichtigste Körperteil des Menschen.
Gerade aus der zeitgenössischen Kultur ist die Zunge kaum wegzudenken. In der Verfilmung des Don-DeLillo-Romans Weißes Rauschen aus dem Jahr 2022 fordert ein Privatlehrer den Protagonisten dazu auf, seine Zunge zu betrachten, um dadurch die Geheimnisse der deutschen Artikulation zu erlernen: »Tomorrow is Tuesday. ›Mor-gen ist Diens-tag.‹« Auf dem Plakat zum Kinofilm Holy Spider, ebenfalls aus dem Jahr 2022, ist eine verschleierte iranische Frau zu sehen, die dem Betrachter provokant die Zunge herausstreckt (Abb. 1) — eine Geste, die auf noch vergleichsweise freundliche Weise die Stimmung etlicher Protestierender gegenüber dem theokratischen Regime des Landes zusammenfassen dürfte. Und im Video zu dem Song Tongues der indigenen kanadischen Sängerin Tanya Tagaq kämpft ein riesiges, aus der arktischen Tundra ragendes Sprechorgan gegen die Kreuze der christlichen Kolonisatoren und damit implizit gegen deren hegemoniale weiße Kultur. »You can’t have my tongue«, singt Tagaq im traditionellen Kehlkopfgesang der Inuk. Meine Zunge gehört mir.
1Plakat für den dänischen Oscarbeitrag Holy Spider (2022)
Natürlich ist die Zunge gerade für Sängerinnen und Sänger schon aus Gründen der Artikulation unerlässlich. Aber auch darüber hinaus ist das Organ in der Popmusik allgegenwärtig, sei es in Videos, auf der Bühne, auf Postern, Plattencovern oder in den Texten. »Acid landing on my tongue / I think you know we’ve just begun«, säuselt Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers im Song mit dem bezeichnenden Titel »Tippa My Tongue«, der zugehörige Clip zeigt eine psychedelische Kamerafahrt von der Zungenspitze über deren Rücken hinab in den Rachen des Sängers. Mit dieser expliziten Bildsprache befindet sich die Gruppe in guter, ja überlebensgroßer Gesellschaft: Schließlich ziert eine knallrote, suggestiv zwischen halbgeöffneten Lippen herausgestreckte Zunge das Logo der mutmaßlich berühmtesten Rock-’n’-Roll-Band der Welt.
Auch in der Belletristik erlebt das Organ, lange fast totgeschwiegen, eine erstaunliche Renaissance. In ihrem Erzählband Mutterzunge schildert die Autorin Emine Sevgi Özdamar, wie sie beim Anblick des Kölner Doms ihre titelgebende Zunge, das heißt die türkische Sprache, verlor — und daraufhin beschloss, ihre »Großvaterzunge«, nämlich das Arabische, zu erlernen. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq wiederum erzählt in seinem jüngsten Roman Vernichten von einem alternden, an einem Mundhöhlenkarzinom erkrankten Mann, der so leidenschaftlich an seiner Zunge hängt, dass er lieber stirbt, als sich den krebsbefallenen Körperteil entfernen zu lassen.
Doch nicht nur in Film, Musik und Literatur — auch in der bildenden Kunst kommt die Zunge, als Werkzeug wie auch als Motiv, vermehrt zum Einsatz. Der deutsche Maler Benjamin Houlihan beispielsweise (von dem auch das Cover dieses Buches stammt) setzt seine Zunge als körpereigenen Pinsel ein und gestaltet damit leckend ganze White-Cube-Wände. Die Künstlerin Kiki Smith erforscht mit ihrer Zungenspitze die Ritzen von Möbelstücken. Der jüngst verstorbene Performance-Künstler und Direktor des ZKM in Karlsruhe Peter Weibel mauerte seine Zunge einst in Beton ein. Und die mexikanische Künstlerin Teresa Margolles platzierte die abgeschnittene Zunge eines Jugendlichen auf ein Podest und erhöhte sie so zum stummen (und gleichzeitig himmelschreienden) Mahnmal gegen Gewalt.
In den Laien-Bildstrecken der sozialen Netzwerke hingegen erfüllt die frech in die Kamera gehaltene, gern auch gepiercte Party-Zunge längst die Funktion eines vollständigen Aussagesatzes: Sie signalisiert, dass man gerade wahnsinnig viel Spaß hat und die Daheimgebliebenen an den Endgeräten echt was verpassen (Abb. 2). In der zeitgenössischen Rollenspielwelt bekämpft ein Schlecker-Pokémon namens Schlurp seine Gegner mit der sogenannten Zungenschelle, im Straßenverkehr setzen Sehbehinderte Zungenschnalzlaute zur räumlichen Orientierung ein, und auch in der Schul- und Zahnmedizin ist die tragende Rolle, die die Zunge bei einer ganzheitlichen Krankheitsdiagnostik spielen kann, endlich erkannt worden. Die Liste ließe sich ewig fortsetzen, zumindest so lang wie die Zunge einer Giraffe, und die misst immerhin stattliche fünfzig Zentimeter. Die kupierte Fassung lautet: Der Mensch erscheint im Glossozän. Wir leben im Zeitalter der Zunge.
2Die Zunge spricht, auch wenn wir schweigen
Sagen Sie mal Ah!
Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre eine solch ostentative Zurschaustellung des menschlichen Oralorgans undenkbar gewesen. In der westlichen Kunst war die Darstellung weit aufgerissener Münder sowie deren Inhalts traditionell auf sehr wenige Figuren, zumeist niedrigen Stands und üblen Leumunds, beschränkt: Bis weit in die Neuzeit gehörten Zungen, wenn sie auf Gemälden, in Zeichnungen oder an Skulpturen zu sehen waren, fast ausschließlich Narren, Betrunkenen, Wahnsinnigen oder Verdammten auf dem Weg zur Hölle.
Selbst die notorisch transgressive Popkultur blieb beharrlich zungenscheu, zumindest wenn sie auf den Mainstream abzielte: Noch Ende der 1980er Jahre musste die amerikanische Glamrock-Band Poison das Cover ihres Albums Open Up and Say … Ahh! für den heimischen Markt kaschieren, weil das darauf dargestellte Organ vermeintlich zu lang, zu animalisch, zu schlüpfrig, mit einem Wort: zu zungenhaft war. Eine veritable Zungenkusskunst schließlich, wie sie das altindische Kamasutra bereits vor 1700 Jahren entwickelte, sucht man in der westlichen Tradition vergebens. Anders gesagt: Die Zunge galt für die längste Zeit ihres Daseins, einer ihrer vorzüglichsten Eigenschaften zum Trotz, als geschmacklos. Sie diente zur Spracherzeugung, war aber selbst unaussprechlich. Woher also diese überraschende Wende?
Zum einen, so darf man vermuten, hängt der jüngste Bilder- und Beschreibungsboom der Zunge mit einer generellen Erweiterung des Vorzeig- und Sagbaren seit den 1960er Jahren zusammen. Die Vertreterinnen und Vertreter der damals aufkommenden Gegenkulturen streckten ja nicht nur dem Establishment die Zunge heraus — es wurden auch etliche andere, zuvor verfemte Körperteile und Leibesfunktionen provokativ ans Licht gezerrt, thematisiert, enttabuisiert. Auch der öffentliche Diskurs vom Sex, an dem die Zunge nicht ganz unbeteiligt ist (sowohl am Diskurs als auch am Sex), nimmt in dieser Zeit seinen Ausgang: Nicht von ungefähr wird Mick Jagger, eines der männlichen Sex-Symbole des 20. Jahrhunderts, maßgeblich mit seiner kraftvoll-virilen Zunge assoziiert. Nicht umsonst spielte Jimi Hendrix, Gitarrengott der Sixties und Headliner des Woodstock-Festivals, seine Gitarre bisweilen (und ohne erkennbaren musikalischen Mehrwert) mit der herausgestreckten Zunge.
Das Vorzeigen der Zunge mutierte im vergangenen halben Jahrhundert also vom Symbol kindlich-juveniler Trotzhaltung zu einer auch unter Erwachsenen gebräuchlichen, bisweilen sexuell aufgeladenen, auf jeden Fall provokativen, antiautoritären Geste — die dennoch einer Weltkarriere nicht im Weg stehen muss. Schließlich handelt es sich beim Zungeherausstrecken um eine recht harmlose Grenzüberschreitung, die schnell wieder rückgängig gemacht werden kann. Anders als Penis, Vulva, Brüste oder den entblößten Hintern kann man die Zunge in Sekundenbruchteilen wieder verschwinden lassen und die Provokation, wenn nicht ungesehen oder gar ungeschehen machen, so doch mit den zusammengepressten Lippen kaschieren.
Das Zungezeigen wäre mithin eine Art Rebellion light, die hervorragend in unsere marktförmige Gegenwart passt. Dass deswegen aber längst nicht alle folgenlos dieses Organ zeigen können, lässt sich am Beispiel von Armin Laschet studieren: Im Sommer 2021 besuchte der Politiker, damals noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sowie Kanzlerkandidat der Union, das von einer Flutkatastrophe verwüstete Ahrtal. Während einer Rede des Bundespräsidenten stand Laschet abseits, wähnte sich unbeobachtet, machte einen Scherz und grinste — das war der Anfang vom Ende. Das Foto des spitzbübisch die Zunge zwischen den Zähnen hervorpressenden CDU-Mannes besiegelte seine Ambitionen auf das höchste Regierungsamt des Staates.
Fremd-Körper
Der Fall Laschet zeigt: Die Zunge ist ein tückisches, ein trickreiches Wesen. Obwohl sie anatomisch nur wenige Zentimeter vom Gehirn entfernt ist, von jenem Organ also, das doch eigentlich ihre Bewegungen und Regungen kontrollieren sollte, scheint sie bisweilen ihre eigenen Absichten zu verfolgen — und zwar bevorzugt solche, die dem Willen des Zungeninhabers zuwiderlaufen. Sie zeigt sich zur Unzeit, sie lispelt und lallt, sie verplappert sich, sie hat ihren eigenen Kopf. Wenn es eines Beweises für das Diktum von Sigmund Freud bedürfte, dass »das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus«: Die Zunge wäre der beste Beweis. Sie ist der Untermieter, dem die Hausordnung egal ist, den man aber auch nicht vor die Tür setzen kann.
Das Wissen um diese merkwürdige Independenz der Zunge ist alt: Redewendungen wie Hüte deine Zunge! oder Ich könnte mir die Zunge abbeißen! (wenn diese, allen Warnungen zum Trotz, doch etwas fahrlässig ausgeplaudert hat) zeigen, dass wir dem Organ, das doch so zentral ist für unsere Identität, unsere Selbstdarstellung und Weltbeziehung, nicht recht über den Weg trauen. Die Zunge, könnte man sagen, ist uns das Eigenste und Fernste zugleich. Sie ist ein ambivalenter Fremd-Körper, ein Teil unseres Selbst und gleichzeitig ein eigenständiges Wesen: unberechenbar und schlüpfrig wie die Schlange, die bekanntermaßen eine gespaltene Zunge hat.
Womöglich fällt dieses Misstrauen heute — in einer Zeit, in der wir uns immer weniger als selbstwirksam erfahren, angesichts einer zunehmend komplexen und epistemisch zersplitterten Wirklichkeit — auf besonders fruchtbaren Boden. Die Machtlosigkeit, die wir gegenüber unserer Zunge empfinden, versinnbildlicht im Kleinen den Mangel an Einfluss, den wir im nationalen und erst recht globalen Maßstab in Bezug auf politische, ökonomische und ökologische Prozesse erfahren. Die Philosophie kennt für dieses Gefühl der Überwältigung den Begriff des Erhabenen; in der Regel ist es mit großen Phänomenen wie den Bergen oder dem Meer assoziiert. Im Vergleich zu den Alpen mag die Zunge zwar klein sein — doch auch sie führt uns unsere Impotenz immer wieder, mit jedem Lispler und Freud’schen Versprecher, unbarmherzig vor Augen. Sie verkörpert das orale Erhabene. Die Zunge ist das Überwältigende, das Unfassbare im eigenen Mund.
Zugleich weist sie uns unerbittlich auf unsere phylogenetischen Wurzeln hin. Bereits der Australopithecus, ein früher Vorläufer des Menschen, hatte, als er sich vor dreieinhalb Millionen Jahren auf die Hinterbeine stellte, eine Zunge im Mund. Selbst jener urtümliche Fleischflosser, der vor circa 365 Millionen Jahren als erstes Wirbeltier seinen Körper ins Trockene brachte und damit den entscheidenden evolutionären Schritt vom Wasser zum Landleben vollzog, dürfte bereits über einen u-förmigen Knochen im Unterkiefer verfügt haben, aus dem sich im Lauf der folgenden Jahrmillionen das sogenannte Zungenbein und schließlich die Zunge entwickelte. Ihre Entstehung ist vermutlich eine direkte Reaktion auf die veränderten Ernährungsbedingungen an Land. Nicht nur der sprachbegabte Homo sapiens, auch etliche andere Wirbeltierarten besitzen daher eine Zunge.
Das bedeutet: Diesem Organ haftet, ganz wertneutral gesprochen, etwas zutiefst Animalisches an. Es verbindet uns anatomisch mit dem Tierreich, mit sabbernden Hofhunden, Fliegen fangenden Fröschen oder Katzen, die mit der Zunge das kotverschmierte Fell ihres Nachwuchses saubermachen. Durch ihre schiere Existenz verweist die Zunge auf die grundlegendsten Bedürfnisse des saugenden, kauenden, verdauenden Körpers; Eigenschaften, die wir mit etlichen anderen Lebewesen teilen. Wenn einem Menschen die Zunge heraushängt, wird dies entsprechend meist als Zeichen tierischen Durstes oder bestialischer Geilheit interpretiert. Man betrachte in diesem Zusammenhang Jim Carrey in der Filmkomödie Die Maske, dem beim Anblick einer attraktiven Blondine die Zunge ellenlang aus dem Mund schlackert.
Für die längste Zeit der abendländischen Geschichte galten solche Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier als Kränkung des stolz auf zwei Beinen einherschreitenden Subjekts. Erst mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass wir genealogisch mit anderen, nichtmenschlichen Zungenträgern verwandt sind. Und noch einmal weit über hundert Jahre später, mit der jungen akademischen Disziplin der Human-Animal Studies, fand der Gedanke flächendeckende Verbreitung, dass wir von anderen Tierarten gar nicht kategorial verschieden, sondern nur etwas höher begabte Säugetiere sind: Trockennasenprimaten mit Haarausfall. Die Zunge ist jenes Organ, das uns wie eine Nabelschnur sowohl mit der eigenen Evolutionsgeschichte als auch mit etlichen anderen Arten verbindet. Sie ist fleischgewordene Speziesismus-Kritik.
Am vielleicht offensichtlichsten ist dieser Wille zur Wesensverwandtschaft bei Menschen zu sehen, die sich einer zeitgenössischen Körpermodifikation, dem sogenannten tongue splitting unterzogen haben: Hierbei wird die Zunge entlang der Medianlinie mit einem Skalpell oder Laser aufgetrennt, bis zwei separate Zungenspitzen entstanden sind, die mit etwas Übung unabhängig voneinander bewegt werden können. Einer der bekanntesten Vertreter dieses Eingriffs ist Erik »The Lizardman« Sprague, ein US-amerikanischer Philosoph und Extremperformer, der nicht nur über eine gegabelte Zunge verfügt — sein Körper ist auch von Kopf bis Fuß mit einem an die Panzerhaut eines Reptils gemahnenden Schuppenmustertattoo bedeckt. Erklärtes Ziel von Spragues Metamorphose ist, die Grenzen des Menschlichen so weit zu dehnen, bis sie brüchig werden, das Konzept unserer Spezies ins Schlingern gerät. Wie viele Körperteile kann man verändern, färben, bearbeiten, austauschen, bis man den Bereich des Humanen verlässt und zu einer anderen Art wird? Wo hört der Mensch auf, und wo fängt das Kriechtier an? Sind wir nicht alle ein bisschen Schlange?
Sprich mit ihr
Bei allen Gemeinsamkeiten lässt sich festhalten: In zweierlei Hinsicht ist die menschliche Zunge einzigartig und von den Oralorganen anderer Tiere grundsätzlich verschieden. Zum einen ist sie zu komplizierten Verrenkungen, Verschlingungen, Beleckungen und Begegnungen mit ihresgleichen fähig: zu Zungenküssen, die zwar für Unbeteiligte durchaus animalisch anmuten mögen, aber doch ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen sind. Und zum anderen dient sie zur Artikulation differenzierter symbolischer Lautfolgen, das heißt: zu sprachlichen Äußerungen.
Nicht von ungefähr bedeutet das lateinische Wort lingua (wie schon das altgriechische γλῶσσα) sowohl ›Zunge‹ als auch ›Sprache‹: ein Doppelsinn, der bis heute in etlichen, vor allem romanischen Sprachen fortlebt, sei es im französischen langue, im spanischen lengua, im italienischen lingua, im rumänischen limbă oder dem Esperanto-Wort lingvaĵo. Auch das Deutsche bewahrt noch diese beiden Bedeutungen, allerdings in etwas angegraut wirkenden Redewendungen: Ein Dichter deutscher Zunge hat natürlich kein schwarz-rot-gold gefärbtes Muskelpaket im Mund, sondern schreibt und spricht, ungeachtet seiner Herkunft, auf Deutsch. In diesem Sinn ist die Zunge eben nicht jenes Organ, das uns qua Gleichartigkeit mit der übrigen Fauna verbindet — sie ist, ganz im Gegenteil, ein untrügliches Signum des Menschseins, ein Körperteil, der uns radikal von nicht-menschlichen Tieren unterscheidet. Sie übersetzt Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse in konventionalisierte Lautfolgen, überträgt diese nach außen und ermöglicht so die Kommunikation mit anderen Menschen — und zwar in einer klanglichen Differenziertheit sowie auf einem Abstraktionsniveau, das für andere Spezies (Pardon, liebe Bonobos!) schlicht unerreichbar ist. Allenfalls künstliche Intelligenzen können dem Menschen im Hinblick auf seine Sprachkompetenz das Wasser reichen.
Womöglich trägt auch dieser Aspekt — dass wir mit unseren technischen Geräten und Gadgets nicht mehr taktil, sondern zunehmend über gesprochene Sprache interagieren — zu einem gesteigerten Interesse an der Zunge bei. »Sprechen ist das neue Tippen« lautet ein aktueller Slogan des Internet-Giganten Google: Wir diktieren unsere Kurznachrichten immer häufiger ins Mobiltelefon, anstatt sie händisch einzugeben, wir lassen Texte von der Spracherkennungsfunktion unseres Computers erfassen, führen Kundengespräche mit künstlichen Intelligenzen, bestellen unsere Einkäufe im Internet über den Sprachassistenten, und die Bedienung von Stereoanlage, Kühlschrank, Deckenbeleuchtung, Jalousie und Heizung erfolgt im volldigitalisierten Smart Home ohnehin schon längst über verbal formulierte Befehle. Alexa, fahr den Wagen vor. Siri, mach dir einen schönen Abend.
Kurz und ergreifend: Die Finger, die noch vor wenigen Jahren für das Bedienen von Touchscreens, Tastaturen, Knöpfen, Reglern, Steuerrädchen und Schalthebeln unentbehrlich waren, verlieren an Bedeutung — ihre Aufgaben übernimmt peu à peu die Zunge. Man könnte mithin, in Anlehnung an den Begriff des linguistic turn, formulieren: Wir erleben gerade einen glossal turn. Eine kolossale glossale Wende.
Aber: Trotz all dieser Gründe, die für ein gesteigertes Interesse an der Zunge sprechen, umgeben dieses Organ immer noch etliche Tabus. Die Zunge mag in aller Munde sein — es ist aber beileibe noch nicht alles über sie gesagt, sie bleibt ein hinter den Zähnen verschanztes, feucht schillerndes Geheimnis. Dabei könnte uns die Zunge, oder vielmehr der Umgang mit ihr, weit mehr über die Gegenwart verraten als jedes andere Organ. Gerade aufgrund ihres wechselhaften Wesens, gerade weil sie zwischen der Innen- und der Außenwelt vermittelt, die Sphäre des Öffentlichen wie des Privaten berührt, animalische und humane Eigenschaften hat, kristallisieren sich an ihr einige der wichtigsten Diskurse und Fragen unserer Zeit.
Wer darf dieses Körperteil wem, wann und in welchem Kontext zeigen? Was sagt die Konjunktur des Adjektivs lecker über unsere spätkapitalistische Gegenwart? Ist der Zungenkuss womöglich eine besonders zeitgemäße, da genderunabhängige Form der Sexualität? Warum erfährt das archaische Ritual der Zungenverstümmelung im gegenwärtigen politischen Diskurs eine solche Konjunktur? Wer spricht durch uns, wenn wir in Zungen reden, und wie beeinflusst dies unser modernes Autonomieverständnis? Inwieweit verkörpert der Geschmackssinn unsere prekäre gesellschaftliche Verfasstheit in einer epistemisch gespaltenen Medienwelt?
Und, bevor wir uns solch vertrackten Fragestellungen zuwenden: Was ist das überhaupt für ein seltsames, schlüpfriges, scheues Organ?
staunen
Have you a tongue in your head? he said.
Samuel Beckett, Molloy
Ein versehentlicher Biss auf die Spitze, ein Pulen an einer losen Plombe, ein gedankenverlorenes Herumspielen am Schneidezahn, ein zufriedenes Schnalzen am Gaumen: Ja, da ist sie noch! Die Zunge. Fast hätte man vergessen, dass es sie gibt.
Bedenkt man, welch eminent wichtige Rolle die Zunge in unserem Leben spielt, ist nachgerade unbegreiflich, wie wenig Aufmerksamkeit wir ihr normalerweise schenken — ja, wie stark sie sich unserer bewussten sinnlichen Wahrnehmung entzieht. Im Alltag spüren wir sie zumeist nur dann, wenn sie verletzt ist, beziehungsweise dort, wo sie an ihre Grenzen stößt: an die Zähne, die Lippen, die Backentaschen oder den Gaumen. Obwohl sie nur wenige Zentimeter von unserer Nasenspitze entfernt ist, können wir sie nicht riechen. Sie dient uns zwar als Geschmacksorgan, wir können mit ihrer Hilfe das Aroma unseres Daumens, unserer Achselhöhle oder, wenn wir gelenkig genug sind, auch unseres großen Zehs erkunden — aber wie sie selbst schmeckt, entzieht sich unserer Wahrnehmung. Und wenn wir sie ganz weit herausstrecken und über die Nase nach unten schielen, können wir allenfalls einen schemenhaft-verzerrten Blick auf ihre Spitze erhaschen.
Zugegeben, wir können unsere Zunge im Spiegel betrachten — aber auch dann sehen wir allenfalls einen Ausschnitt, die Oberseite, den Zungenrücken, eine schlüpfrige Bahn, die in unabsehbare Körpertiefen zu führen scheint — wo sie endet (oder besser: beginnt), sehen wir nicht. Lässt man den Blick zu lange auf seiner Zunge verweilen, könnte man sich im eigenen Leib verlieren. Der Rachen wird zum Abgrund, die Zunge zum Zeichen der Fremdheit.
Ähnliches gilt, ja, womöglich mehr noch, für die Organe unserer Mitmenschen: Wie sieht eigentlich die Zunge der Eltern, des Ehepartners, der Geliebten, des besten Freundes oder der eigenen Kinder aus? Die Form und Farbe der Augen wird den meisten Menschen bekannt sein, ebenso der Schwung der Nase, die Wölbung der Lippen und des Kinns, die Anordnung der Zähne, die Haarfarbe, bei intimen Bekannten außerdem besondere Kennzeichen wie Operationsnarben, Muttermale, Falten, Orangenhaut, Alterswarzen. Aber eine exakte Beschreibung der Zunge dürfte vielen schwerfallen. Ausgerechnet dieses so zentrale Sozialorgan, jener Körperteil, mit dem man spricht, sich streitet, wieder versöhnt und gegebenenfalls beim Zungenkuss vereinigt, bleibt seltsam abstrakt, anonym: eine verborgene Scharnierstelle im Schatten des Mundes.
»Have you a tongue in your head?« Es handelt sich bei dem eingangs zitierten Satz von Samuel Beckett um eine rhetorische Frage: Die Wendung bedeutet so viel wie Bist du stumm?, Hat es dir die Sprache verschlagen? oder Hast du deine Zunge verschluckt? Man könnte die Metapher aber auch beim Wort nehmen: Hast du eine Zunge im Kopf? In diesem Sinne spricht aus dem Satz eine enorme Unsicherheit, eine tiefgreifende Skepsis gegenüber diesem so rätselhaften wie faszinierenden Organ: Was verbirgt sich wirklich hinter unseren Lippen — und mehr noch hinter jenen unserer Mitmenschen?
Ab durch die Mitte
Das Offensichtlichste zuerst: Wir haben nur eine Zunge. Im Gegensatz zu den meisten anderen Organen und Extremitäten unseres bilateral aufgebauten Körpers (Augen, Ohren, Brüste, Ovarien beziehungsweise Hoden, Arme und Beine, Nieren, Lungenflügel) ist sie ein Unikat. Diese Eigenschaft teilt die Zunge mit anderen symbolträchtigen Organen wie dem Nabel, dem Penis, der Vulva, dem Anus — unterscheidet sich von diesen aber darin, dass sie den Körper jederzeit verlassen und wieder in ihn zurückkehren kann. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Die Zunge ist innen und außen, im und am Körper zugleich.
Da sie sich als Einzelkämpferin in einem spiegelsymmetrischen System befindet, liegt die Zunge (auch darin Nase, Nabel, Anus etc. gleich) exakt auf der Medianlinie des Körpers, jener Achse also, die unseren Leib in eine linke und rechte Hälfte teilt. Die Zunge hebt diese Trennung zwar auf, trägt deren Spuren aber noch deutlich sichtbar auf ihrem Rücken, sie zerfällt nämlich ihrerseits in zwei spiegelsymmetrische Hälften, in deren Mitte sich eine senkrechte Vertiefung, die sogenannte mittlere Zungenfurche, befindet. Schon kleine Kinder fügen, wenn sie ein freches Gesicht zeichnen, der herausgestreckten Zunge dieses anatomische Kennzeichen hinzu: ein waagerechter Querstrich, darunter ein Halbkreis, zum Schluss eine Linie, die diesen von oben nach unten durchschneidet — das ist die wohl gängigste ikonische Darstellung einer herausgestreckten Zunge.
Zoomt man etwas näher heran, ergibt sich ein weitaus komplexeres Bild. So zerfällt die Zunge nicht nur in eine linke und eine rechte Hälfte, sondern lässt sich auch der Länge nach in zwei Bereiche gliedern; auch diese sind von einer anatomischen Furche, dem sogenannten Sulcus terminalis, getrennt. Etwa ein Drittel der Zunge liegt hinter dieser Furche und wird, weil das Organ hier entspringt, als Zungenwurzel (Radix linguae) bezeichnet. Die anderen zwei Drittel — jener Teil, der auch von Nichtmedizinern gemeinhin als Zunge verstanden und umgangssprachlich so genannt wird — befinden sich vorne in der Mundhöhle. Es handelt sich hierbei um den Zungenkörper (Corpus linguae), der volumenmäßig den Löwenanteil des Organs ausmacht, sowie um den frei beweglichen und flexiblen Teil, wo die Seiten der Zunge mehr oder weniger pointiert zusammenlaufen. Auch bei Menschen, die sich nicht spitzzüngig auszudrücken pflegen, bezeichnet man diesen Bereich als Apex linguae, zu deutsch: als Zungenspitze.
Muskelprotz
»Meine Zunge ist ein Muskel«, pflegte der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf zu sagen und meinte damit seine leidenschaftliche Verachtung für allen kulinarischen Firlefanz. Tatsächlich handelt es sich bei der Zunge nicht bloß um einen Muskel, sondern um ein ganzes Muskelpaket, ein Gewebe von Binnenmuskeln, die sowohl in sagittaler als auch in transversaler sowie in vertikaler Richtung verlaufen. Vereinfacht gesagt: Vier Muskeln durchziehen die Zunge von hinten nach vorne, ein Muskel verläuft in Links-rechts-Richtung und ein weiterer von oben nach unten.
Dank dieser muskulären Dreidimensionalität ist die Zunge das beweglichste Organ des menschlichen Körpers (wenn auch nicht, wie bisweilen behauptet wird, das stärkste). Der Begründer der Gastrosophie, der französische Feinschmecker Jean Anthelme Brillat-Savarin, identifizierte bereits vor 200 Jahren drei verschiedene Bewegungen, zu denen ausschließlich die menschliche Zunge in der Lage sei, und die er als Spication, Rotation und Verrition (vom lateinischen Wort verrere, ›kehren, fegen‹) bezeichnete:
Bei der ersten Bewegung drängt sich die Zunge wie ein Aehrenkolben (spica) durch die geschlossenen Lippen; bei der zweiten bewegt sich die Zunge radförmig (rota) in dem Raume zwischen den Wangen und dem Gaumen, bei der dritten krümmt sich die Zunge nach oben und unten und kehrt die Theile zusammen, welche in dem halbkreisförmigen Canale zwischen den Lippen und dem Zahnfleische bleiben.
Eine Sehnenplatte überträgt die von dieser Binnenmuskulatur bewirkten Bewegungen auf die Schleimhaut des Zungenrückens — hier befinden sich, auch bei den größten Kostverächtern, die sogenannten Papillen: warzenförmige Ausstülpungen der Haut, die teilweise mit bloßem Auge erkennbar und für die sinnliche Wahrnehmung zuständig sind. Sie geben der Zungenoberfläche ihr typisches, zwischen Krötenhaut und nass gewordenem Schmirgelpapier changierendes Aussehen.
Ein weiterer Zoom vom Makro- ins Mikroskopische, vom Sichtbaren ins Unsichtbare: Die Papillen enthalten winzige Geschmacksknospen, die ihrerseits die eigentlichen Geschmackssinneszellen enthalten. Diese können insgesamt fünf (neueren Schätzungen zufolge sogar sechs oder sieben) verschiedene Qualitäten unterscheiden. Neben den allgemein bekannten Hauptgeschmacksrichtungen süß, sauer, salzig und bitter ist dies die erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte Geschmacksrichtung umami: ein japanischer Begriff, der sich am besten als ›herzhaft‹ umschreiben lässt und in Würzmitteln wie Sojasauce oder Maggi idealtypisch verkörpert ist. Zudem gibt es möglicherweise Rezeptoren für die Eigenschaften fettig und wässrig. (Dass die Anzahl nach wie vor umstritten ist, spricht Bände über unsere Zungen-Agnostik.) Jede Geschmacksknospe ist auf einen bestimmten Reiz spezialisiert — da aber die meisten Papillen mit unterschiedlichen Arten von Knospen besetzt sind, kann ein und dieselbe Papille häufig unterschiedliche Aromen wahrnehmen. Dennoch gibt es gewisse Häufungen: Während die Papillen in der Zungenmitte prinzipiell offen für alles sind, werden saure und salzige Speisen etwas stärker von jenen am äußeren Rand wahrgenommen und bittere im hinteren Bereich, am Übergang zur Zungenwurzel.
Bittere Papillen
Insgesamt lassen sich vier verschiedene Arten von Papillen unterscheiden. An der Zungenspitze sowie den Rändern des Zungenrückens befinden sich die sogenannten Papillae fungiformes: Sie ähneln, wie der lateinische Name nahelegt, den Hüten winziger Pilze und sind neben der Geschmackswahrnehmung auch für die Temperaturempfindung und den Tastsinn verantwortlich — klar: Bevor man sich etwas auf der Zunge zergehen lässt oder gar herunterschluckt, tut man gut daran, durch behutsames Tasten mit der Spitze sicherzustellen, dass es nicht zu heiß, zu kalt, zu scharf, zu spitz oder in anderer Weise gefährlich ist.
Zwischen den Pilzpapillen sowie über den ganzen Zungenrücken verteilt befinden sich die Fadenpapillen (Papillae filiformes), die ausschließlich für den Tastsinn verantwortlich sind: Aufgrund ihrer geringen Größe — die maximale Höhe beträgt einen halben Millimeter — sind sie mit bloßem Auge eher als pelzige Oberfläche denn als Ansammlung einzelner Fäden sichtbar, doch auch sie tragen ihren Namen zu Recht: Ihre Enden laufen in winzigen, verhornten, fadenförmigen Spitzen aus, die jeden Zug oder Druck, der auf die Zunge einwirkt, an das Bindegewebe und von dort an das Nervensystem weitergeben. Selbst winzige Teilchen und Unebenheiten können daher von der Zunge in mehr als eineinhalbfacher Vergrößerung wahrgenommen werden.
Ganz hinten auf dem Zungenrücken befinden sich schließlich die sogenannten Blätterpapillen sowie die Wallpapillen (Papillae foliatae beziehungsweise vallatae). Erstere siedeln eher am Zungenrand, letztere parallel zu der beschriebenen Querfurche, die den Zungenkörper von der Wurzel trennt: Die Wallpapillen bilden also den Abschluss der Papillenbesiedlung in Richtung Rachen. Zudem sind sie jeweils von einem Graben umgeben, der ihnen tatsächlich die Anmutung eines zerklüfteten Burgwalls verleiht.
Auch die Wall- und die Blätterpapillen sind an der Temperatur- sowie an der Geschmackswahrnehmung beteiligt, dabei aber vor allem auf Bitterstoffe spezialisiert. In diesem Sinn markieren sie gewissermaßen die ›letzte Grenze‹, eine Art antitoxischen Schutzwall. Bevor eine bittere — und damit möglicherweise giftige — Speise die Schwelle zum Rachen passiert, können die Papillen einen neuronalen Notruf auslösen und so dafür sorgen, dass der Fremdkörper schleunigst wieder nach draußen befördert wird: Bis hierher und nicht weiter.