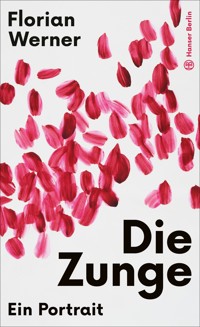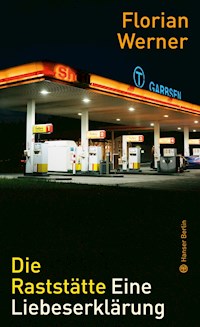
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Florian Werner zeigt, dass Raststätten mehr sind als Orte der Pause und des Auftankens. „Raststätten sind Orte der Magie – und dies ist ein magisches Buch.“ Saša Stanišić Die deutschen Raststätten haben mehr Besucher als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor und das Oktoberfest zusammen. Gerade in einer Autofahrernation wie der unseren sind sie die wichtigsten Bauwerke überhaupt. Florian Werner nimmt diese ungeliebten Orte unter die Lupe. Er spricht mit Lastwagenfahrern, Flaschensammlern und Autobahnpolizisten. Er trifft einen Raststättenbetreiber, der den Lärm der Autobahn liebt, er lernt von einem Botaniker, wie man sich von den Pflanzen am Parkplatzrand ernährt, und er entwickelt eine kleine Philosophie der Sanifair-Toilette. Das Ergebnis ist eine liebevolle, komische und sehr persönliche Hommage an einen Ort, der weitaus faszinierender und vielschichtiger ist als sein Ruf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Florian Werner zeigt, dass Raststätten mehr sind als Orte der Pause und des Auftankens. »Raststätten sind Orte der Magie — und dies ist ein magisches Buch.« Saša StanišićDie deutschen Raststätten haben mehr Besucher als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor und das Oktoberfest zusammen. Gerade in einer Autofahrernation wie der unseren sind sie die wichtigsten Bauwerke überhaupt. Florian Werner nimmt diese ungeliebten Orte unter die Lupe. Er spricht mit Lastwagenfahrern, Flaschensammlern und Autobahnpolizisten. Er trifft einen Raststättenbetreiber, der den Lärm der Autobahn liebt, er lernt von einem Botaniker, wie man sich von den Pflanzen am Parkplatzrand ernährt, und er entwickelt eine kleine Philosophie der Sanifair-Toilette. Das Ergebnis ist eine liebevolle, komische und sehr persönliche Hommage an einen Ort, der weitaus faszinierender und vielschichtiger ist als sein Ruf.
Florian Werner
Die Raststätte
Eine Liebeserklärung
Hanser Berlin
»Letzten Endes ist die Welt voller Rastplätze, wo vielleicht Träume von einem solchen Reichtum warten, daß sie alle Hinreisen und irgendwann auch eine ohne Rückreise wert sind.«
Die Autonauten auf der Kosmobahn
»Eine der Top-Anlagen in Deutschland.«
Autobahn Profi über Garbsen Nord
Nächste Ausfahrt Garbsen Nord
Drei weiße Balken auf blauem Grund, dann zwei, dann einer, diagonal von rechts oben nach links unten wie der Bastardfaden auf einem mittelalterlichen Wappenschild: Noch dreihundert Meter, noch zweihundert, hundert, wir kommen der Sache näher. Jetzt keine Ankündigungsbake mehr, dafür ein mächtiger Pfeil, der in die Botanik weist, Verkehrszeichen Nummer 333: Ausfahrt.
Ich drehe das Steuer, die Tachonadel sinkt, achtzig Stundenkilometer, sechzig, dreißig. Ich folge der Ausfädelungsspur auf die dahinter liegende Asphaltbrache, gelbrot leuchtet das Vordach der Tankstelle, aber ich lasse sie rechts liegen und folge dem Piktogramm, das den Weg Richtung Übernachtungsmöglichkeiten weist, schwarze Decke, schwarzes Kissen, ein stilisiertes Kastenbett.
Vorbei an den Zapfsäulen, vorbei an der Station für Luft und Wasser, über den Parkplatz, der die Tankstelle vom Restaurant und Motel trennt. Ein paar Dutzend Vierzigtonner dieseln Flanke an Flanke in der Hitze vor sich hin, daneben PKWs, Kleinbusse mit polnischem Kennzeichen, die Passagiere hängen bei offener Tür in den Sitzen, dösen, daddeln, rauchen.
Auf dem Vordach des Rasthauses reckt eine Nachbildung der Freiheitsstatue ihre Plastikfackel in den niedersächsischen Himmel, daneben thront ein Iguanodon aus Kunstharz; es scheint mich zu beobachten. Ein paar Meter weiter führt ein Abzweig zum Gästeparkplatz unterhalb des Motels.
Kühler weißgetünchter Beton, Kunststoffmülleimer mit dem Logo eines Speiseeisunternehmens, kaum andere Fahrzeuge. Ich bringe den Wagen zum Stehen, nehme die Sonnenbrille ab, massiere mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand die Tränendrüsen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen nervös. Vorfreudig, hibbelig wie vor einem ersten Date. Obwohl ich gar nicht mit einem Menschen verabredet bin, sondern nur mit einem Ort.
Zumal mit einem, der nicht gerade als attraktiv gilt.
Etwa vierhundertfünfzig Autobahnraststätten gibt es in Deutschland, mehr als eine halbe Milliarde Reisende machen jedes Jahr an ihnen Halt; damit haben sie deutlich mehr Besucher als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor und das Oktoberfest zusammen. Zugleich sind Raststätten Orte, an denen Abertausende von Menschen arbeiten und wo Heerscharen von LKW-Fahrern einen Großteil ihrer Frei- und Schlafenszeit verbringen. In einer Gesellschaft, die Individualverkehr als Grundrecht betrachtet, und in einer Zeit, da der Gütertransport zunehmend von der Schiene auf die Straße verlegt wird, nimmt die Bedeutung der Raststätten als Dienstleistungs- und Erholungsorte stetig zu. In einer bekennenden Autofahrernation wie Deutschland sind sie vielleicht die wichtigsten Bauwerke überhaupt.
Darüber hinaus lassen sich Raststätten aber auch als Knotenpunkte verstehen, an denen sich deutsche Zeitgeschichte verdichtet: Ihre Planung war zunächst eng mit dem Autobahnbau während der nationalsozialistischen Herrschaft verbunden. Nach Kriegsende verlief auch die deutsche Raststättengeschichte getrennt. In den Neunzigerjahren schließlich wurden die west- und ostdeutschen Betreibergesellschaften vereinigt und kurz vor der Jahrtausendwende, ganz im neoliberalen Geist der Zeit, privatisiert. Die Raststätte, das ist Deutschland im Kleinen. Ein Mikro-, ein Motorkosmos.
Dennoch sind Raststätten, Hand aufs Herz, nicht gerade beliebt: Sie gelten, bei wohlwollender Lesart, als Inbegriff bundesrepublikanischer Durchschnittlichkeit, als leidlich funktionale Nicht-Orte, wo man in der Regel nur Halt macht, wenn es die Leere des Tanks oder die Fülle der Blase unbedingt erfordern. Das Meckern über die Preise an der Autobahn gehört zur nationalen Folklore, das Klagen über die Qualität des dort angebotenen Essens ist gesellschaftlicher Minimalkonsens. Die Raststätte ist wie ein Mensch, den man nicht leiden, ohne den man aber auch nicht leben kann. Ein Partner, dessen Gegenwart so selbstverständlich geworden ist, dass man ihn kaum noch bemerkt.
Wahrscheinlich ist es gerade diese Unbeliebtheit. Diese Unaufdringlichkeit. Diese vollkommene Abwesenheit von allem, was man gemeinhin unter sehenswürdig oder schön versteht, die mich an Raststätten so fasziniert, ja beinahe magisch anzieht. Mein Lieblingstier ist die Gemeine Wegschnecke, mein Lieblingsheld ist Otto Normalverbraucher, mein bevorzugtes Kleidungsstück ein mittelgraues T-Shirt mit Rundkragen. Anders gesagt: Ich habe ein ausgesprochenes Faible für Wesen, Dinge und Orte, die durch vermeintliche Gewöhnlichkeit glänzen, unter deren Oberfläche sich bei näherer Betrachtung aber Welten (oder wahlweise Abgründe) auftun.
Der Besuch einer Autobahnraststätte, davon bin ich überzeugt, kann uns mehr über die Kultur, Mentalität und Geschichte dieses Landes und seiner Bewohner verraten als die Besichtigung der genannten Kathedrale am Rhein, des neoklassizistischen Triumphtors in Berlin oder des notorischen bajuwarischen Saufgelages. Im vergangenen Sommer erfüllte ich mir daher einen langgehegten Wunschtraum: Ich nahm mir frei von familiären und sonstigen Verpflichtungen. Ich mietete mangels eigenen Automobils einen Leihwagen. Dann fuhr ich los: von Berlin, wo ich zu Hause bin, nach Westen, vorbei an Potsdam, Magdeburg, Braunschweig, immer weiter auf der A2, meist in zähflüssigem Verkehr, manchmal im Stau, bis kurz hinter Hannover. Zur Autobahnraststätte Garbsen Nord.
Alle deutschen Rastanlagen, so viel war mir klar, würde ich nicht besuchen können — zumal ich nicht an einer flüchtigen Affäre interessiert war, ich wollte mich gleich für mehrere Tage und Nächte einquartieren, schauen, schnuppern, schreiben, mit Menschen sprechen, die einen solchen Ort am Laufen halten und sich dort auskennen. Ich brauchte also eine Stellvertreterin, ein Musterbeispiel: eine Raststätte, die exemplarisch für die Vielzahl von Nebenbetrieben an der Autobahn stehen kann.
Dass ich mich, ohne jemals zuvor dort gewesen zu sein, ausgerechnet für Garbsen Nord entschied, hat einen schlichten Grund: Die Raststätte markiert die automobile Mitte unseres Landes. Sie liegt unmittelbar an der A2, jener hochfrequentierten Ost-West-Achse, die Aufgrund der Vielzahl an Lastwagen, die aus Polen Richtung Ruhrgebiet oder weiter nach Rotterdam donnern, den Spitznamen Warschauer Allee trägt. Und unweit der A7, also der großen Nord-Süd-Verbindung, auf der während der Ferienzeit bayerische Touristen nach Skandinavien brettern und skandinavische Touristen nach Bayern. Hier treffen sich Menschen aller Herren Länder und Himmelsrichtungen, hier ist das Zentrum der Windrose. Wenn die Landkarte von Deutschland der Umriss eines Menschen wäre, läge Garbsen Nord in der Herzgegend.
Und nicht nur räumlich, auch zeitlich lässt sich Garbsen Nord im Mittelfeld verorten. Die Anlage wurde 1954 eröffnet, gehört also nicht mehr zu den protzigen Monumentalraststätten der Nazis. Sie stammt aber auch noch nicht aus der Dekadenzphase der Siebzigerjahre, als man auch in Westdeutschland vermehrt auf vorgefertigte Teile zurückgriff und eine Raststätte in Systembauweise nach der anderen an die Straße klotzte.
Dass es die Anlage überhaupt gibt, verdankt sich einem Zufall: Mitte der Dreißigerjahre, beim Bau der Reichsautobahn vom Ruhrgebiet nach Berlin, wurde neben der Trasse Kies und Sand ausgebaggert. Die entstandene Grube füllte sich mit Grundwasser, und es entstand der sogenannte Blaue See — der wiederum die Niedersächsische Straßenbauverwaltung dazu bewog, auf der gegenüberliegenden Autobahnseite eine Raststätte mit Baggerseeblick zu errichten. Eine Anlage, die, in den Worten der Deutschen Bauzeitung, »der letzten Rast vor der Abfahrt nach Hannover zu dienen vermag und den Einwohnern der Stadt ein leicht erreichbares, lohnendes und interessantes Ausflugsziel mit Badegelegenheit im Freien bietet«.
Die Raststätte Garbsen Nord ist damit ein idealtypisches Beispiel für die Architektur des Anthropozän, also des gegenwärtigen, vom Homo sapiens, seinen Ausdünstungen und Eingriffen geprägten Erdzeitalters. Der Mensch erschafft künstliche Landschaften und Gewässer (hier: eine Autobahntrasse und einen Baggersee) — dann errichtet er Bauwerke, um diese vermeintlich natürlichen Phänomene zu bestaunen. Die Naturbeobachtung wird zur Nabelschau, Gewachsenes und Gemachtes sind ununterscheidbar miteinander verbunden.
Zugleich atmet die Raststätte vernehmlich den Geist der Fünfzigerjahre: Dass irgendein Reisender eine halbe Stunde vor Erreichen des Zielorts, wie es die Bauzeitung mutmaßte, noch einmal eine Rast, Tank- und Verzehrpause einlegt, erscheint heute genauso abwegig wie die Vorstellung, dass er eine Autobahnraststätte als Ausflugsziel ansteuern sollte. Die Lage von Garbsen Nord ist Ausdruck einer ungebrochen autoaffirmativen, fortschrittseuphorischen Denkungsart, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts mit dem Futurismus ihren Anfang nahm, mit der Ölkrise Anfang der Siebzigerjahre erste Risse bekam und die heute nur noch im Bundesverkehrsministerium, beim ADAC sowie in den Vorstandsetagen deutscher Automobilhersteller fortleben dürfte. Anders gesagt: Garbsen Nord ist ein typisches Wirtschaftswunderkind. Ein Ort von hinreißender Durchschnittlichkeit, ein Traum in Nullachtfünfzehn, asphaltgewordene Normalität.
Genau der richtige Ort für mich.
Reise zum Mittelpunkt der Welt
Auf dem Luftbild von Garbsen Nord, das ich vor meiner Reise studiert habe, sah die Rastanlage aus wie ein Flussdiagramm. Wie ein Delta, das sich verzweigt und in kleinere Läufe auffächert, in Spuren für Last- und Personenkraftwagen, für Tank- oder Rastwillige. Auf Höhe der Zapfsäulen spaltet sich das Gewässer in ein knappes Dutzend Nebenarme, mündet dann aber nicht in ein wie auch immer geartetes Asphaltmeer, sondern vereint sich am Ende des Rastplatzes wieder und fließt zurück in die Autobahn, in diesen niemals stillstehenden und doch untergründig statischen Strom.
Heute, an einem sengenden Tag im Sommer, erscheint diese feuchtkühle Assoziation denkbar weit weg. Um mir einen Blick aus der Bodenperspektive zu verschaffen, schlendere ich den Rastplatz nach meiner Ankunft zu Fuß ab, einmal von Anfang bis Ende, von Osten nach Westen, von der Ausfahrt bis zur Einfädelungsspur.
Das Erste, was mir auffällt, ist die anachronistische Abfolge der Gebäude: Wie bei den meisten älteren Anlagen muss man als Ankömmling erst die Tankstelle passieren, bevor man das Rasthaus erreicht: Der alte, noch aus vormotorisierten Zeiten stammende Grundsatz »Erst das Pferd, dann der Kutscher« lebt hier also noch fort — obwohl es einem Auto, anders als einem Vierbeiner, herzlich egal sein dürfte, wann es betankt wird. Auch die Ikonographie auf dem Tankstellenvordach, die dem oder der Treibstoffsuchenden den Weg zur richtigen Zapfsäule weisen soll, wirkt aus der Zeit gefallen, hinkt der Fahrzeugentwicklung um Jahrzehnte hinterher: Das Piktogramm für Lastwagen zeigt nicht etwa einen modernen Vierzigtonner, sondern einen altmodischen LKW mit Plane und Pritsche. Und das PKW-Symbol zeigt einen stilisierten Kompaktwagen mit Schrägheck — obwohl eine der mittlerweile epidemisch verbreiteten Geländelimousinen aufgrund ihres immensen Spritverbrauchs doch das viel passendere Symbol wäre.
Unter dem Vordach, an Zapfsäule Nummer fünf, steht ein schwarzer Mercedes-Bus, Siebensitzer. Hinter den halbgeöffneten Fenstern fläzt ein halbes Dutzend Jugendlicher, matt wie die Fliegen, Kopfhörer im Ohr, wartet auf die Weiterfahrt. Die Fahrerin steigt aus, nimmt die Tankpistole aus ihrer Halterung, versenkt den Kolben im Korpus des Fahrzeugs, was sofort Unruhe unter ihren durchweg männlichen Passagieren hervorruft; vielsagende Blicke werden getauscht, Ellenbogen in Rippen geknufft. Während der Treibstoff durch den Schlauch pulsiert, schnappt sich die Fahrerin den neben der Zapfsäule in einem Eimer mit Brackwasser dümpelnden Schwammwischer und beginnt, die Frontscheibe zu putzen. Sie reckt sich nach vorn, um das jenseitige Ende der Frontscheibe zu erreichen, über dem Halbrund ihres Trägertops zeichnet sich die Rückenmuskulatur ab, das zuckende Wechselspiel zwischen Spannung und Erschlaffung. Aus dem Inneren des Busses ertönt eine Jungmännerstimme: »Ausziehen! Ausziehen!«, dann ein kollektives Lachen. Die Fahrerin putzt ungerührt weiter.
Wenige Meter entfernt, an Zapfsäule Nummer drei, parkt derweil eine gigantische Edelstahldose auf Rädern, ihre polierte Oberfläche reflektiert die Umgebung, aber perspektivisch verzerrt, zusammengestaucht wie in einem Spiegelkabinett. Auch sonst scheint mit dem Laster etwas nicht zu stimmen: Statt des obligatorischen Treibstoffschlauchs, der wie bei allen anderen hier stehenden Fahrzeugen in den Tank hineinführt, führen sage und schreibe vier Schläuche aus ihm heraus.
In der Tat, bestätigt der Fahrer meinen Verdacht: Der Laster wird nicht etwa betankt, sondern füllt die unterirdischen Reservoirs mit Treibstoff auf, der Fahrer deutet auf die Platten aus Metall, die parallel zu den Fahrspuren in den Boden eingelassen sind. Alle vier Sorten auf einmal. Der Mann strahlt eine enorme Ruhe und Kernigkeit aus, unter seinem Overall ist ein athletisch-asketischer Körper zu erahnen, die obere Hälfte seines Raubvogelgesichts ist von einer Schutzbrille aus Plexiglas verdeckt, wobei unklar ist, ob die Brille seine Augen vor etwaig herausspritzendem Kraftstoff schützen soll, oder umgekehrt die Umwelt vor seinem stechenden Blick.
Eine Dreiviertelstunde dauere der Betankvorgang, teilt mir der Fahrer auf Anfrage hin mit, mustert mich dabei abschätzig-kritisch, wie ein Habicht, der eine Zwergmaus beobachtet und gerade beschlossen hat, dass sie für sein Beuteschema zu klein ist. Fünfunddreißigtausend Liter Kraftstoff strömen derweil in die unterirdischen Kammern. Etwa fünf Mal pro Woche mache er diese Prozedur, sagt der Habicht. Je nach Bedarf.
Ob er denn gar nicht nervös sei, wenn er mit mehr als dreißig Tonnen hoch entzündlicher Fracht auf der Autobahn unterwegs ist?
Der Habicht blickt mich kühl durch seine Plexiglasbrille an, vielleicht auch ein bisschen spöttisch, zuckt mit den Schultern. »Wenn dir einer hinten drauf fährt, hast du immer Pech gehabt — egal, was du geladen hast.« Außerdem mache er den Job jetzt schon seit fünfundzwanzig Jahren, und es sei noch nie etwas passiert.
Er wendet sich wieder seinem Tanklaster zu, kontrolliert die Lage der Schläuche, überprüft hier ein Ventil, studiert da eine Anzeige, dreht sich dann noch mal zu mir um. »Na ja«, fügt er milde, fast versöhnlich hinzu, vielleicht war meine Frage doch nicht so abwegig: »Man soll niemals nie sagen.«
Neben der Eingangstür des Tankstellenshops laden ein paar runde Tische zum Herumstehen ein: Wer gerne mit Dieseldunst in der Nase seine Mahlzeiten einnimmt, ist hier genau richtig. Eine Heißwurst wird gerade in Senf gebadet, ein Kaltgetränk in einen Truckerkörper gefüllt, ein Kindermund nuckelt an Eis, der dazugehörige Schopf reicht kaum an die Stehtischkante.
Die Automatiktüren teilen sich vor mir wie das Rote Meer, ich schreite hindurch, im Shop ist es angenehm kühl. Das Sortiment ist wenig überraschend — wobei: Neben den üblichen Mobilitätsutensilien (Motorenöl, Straßenkarten, Bier) fällt mir ein übermannshoher Aufsteller mit Holzschildern ins Auge, die offenbar für das heimische Gartentor, die Haus- oder Wohnungstür gedacht sind. Die Schilder sind frühstücksbrettgroß und jeweils mit dem Konterfei eines Rassehundes bedruckt, daneben steht ein Spruch, der wahlweise Einbrecher abschrecken oder Nachbarn, Freunde und Besucher von der Richtigkeit des eigenen Lebensentwurfs als Hundehalter überzeugen soll:
In diesem Haus wacht ein Dobermann.
Hier wohnt der verwöhnteste King Charles Spaniel der Welt.
Ein Haus ohne einen Deutschen Schäferhund ist nur ein Haus.
Ein Leben ohne einen Havaneser ist möglich aber sinnlos.
Offenbar vermissen Deutsche, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, vor allem ihren Hund, jedenfalls sehe ich keine vergleichbaren Mitbringsel für zu Hause gebliebene Ehepartner und Kinder. Oder sind die Schilder gar nicht für den Verkauf bestimmt, sondern Teil des Inventars, und stehen für all jene Vierbeiner, die auf der Raststätte ausgesetzt wurden und jetzt hier wohnen?
Ich verlasse mit leeren Händen den Tankstellenshop, flaniere weiter über den sich anschließenden langgezogenen Parkplatz, schnurstracks auf das Iguanodon zu, das in der Ferne hungrig auf mich wartet. Ein gutturales Grundbrummen erfüllt die Luft; es rührt aber nicht vom Verkehr auf der Autobahn her, sondern von den Vierzigtonnern, die auf der linken Seite des Parkplatzes im Fischgrätmuster aufgereiht sind und, vermutlich zur Kühlung von Fracht und Fahrer, ununterbrochen den Motor laufen lassen. Rechter Hand parken die PKWs; in der Mitte verläuft eine spartanische Promenade, ein verdorrter Grünstreifen mit einem Fußweg aus ziegelsteinfarbigen Betonquadern.
Alle zwanzig Meter ist ein Picknickensemble aus Metall in den Boden geschraubt, ein Tisch, zwei Bänke, rot lackiert, doch die meisten sind unbesetzt: Nur ein schmächtiger Trucker sitzt mit nacktem Oberkörper verloren an einem der Möbel, studiert mit zugekniffenen Augen das Display seines Mobiltelefons, die anderen Fahrer haben sich ins Monadendasein ihrer klimatisierten Kabinen zurückgezogen.
Neben den Picknicktischen erheben sich Müllcontainer wie mächtige prähistorische Monolithen, Anstaltsgröße, elfhundert Liter Fassungsvermögen, auf ihrer Vorderseite prangt jeweils ein Warnaufkleber des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: ein durchgestrichenes Wildschwein, das eine Banane verspeist, daneben (So ist’s richtig!) eine Hand, die die Bananenschale in den Abfall befördert. Die Seitenwände sind mit den Aufklebern rivalisierender Fußballvereine dekoriert, wobei Hannover 96, die Nähe zur Landeshauptstadt macht sich bemerkbar, dominiert: »Stadt, Umland und Region sauber halten!«, mahnt ein Sticker, daneben (So ist’s falsch!) der durchgestrichene Löwe von Eintracht Braunschweig.
Vor dem Eingang zum Rasthaus parkt ein Schaukelpferd in Form eines Rennmotorrads, mit Beisitzerwagen und der Nummer 8: Hier, denke ich, wird der Nachwuchs schon früh für den brennstoffbetriebenen Individualverkehr angelernt. Der Vogelbeckensaurier, der auf dem Dach darüber thront, soll übrigens keineswegs, wie ich zuerst glaubte, vor dem allfälligen Aussterben der Menschheit warnen (Seht her, wir waren einst die Herrscher der Erde, aber jetzt sind wir tot, und wenn ihr so weitermacht mit eurem fossilen Brennstoffverbrauch, tretet ihr bald in unsere Fußstapfen!). Seine Existenz verdankt sich vielmehr der Tatsache, dass in einem nahegelegenen Steinbruch versteinerte Iguanodonspuren gefunden wurden, eine Unterrichtungstafel weist auf den zugehörigen Dinopark hin.
Die Tür zum Rasthaus steht offen, im Foyer hängt, passend zur Vorzeitechse auf dem Dach, tatsächlich noch ein antiker Münzfernsprecher der Telekom, das Clubtelefon 5 aus den Neunzigerjahren, zahnbelaggrau mit magentafarbenem Designbügel, Einwurf: fünfzehn Cent. Der sich anschließende Merchandise-Bereich ist überschaubar und derzeit menschenleer, kein Wunder: Wer zum Einkaufen Halt gemacht hat, ist wahrscheinlich schon im Tankstellenshop fündig geworden. Unmittelbar dahinter befindet sich rechter Hand der Eingang zum Sanitärbereich, an der Wand gegenüber blinken die obligatorischen Geldspielgeräte.
Der Raum weitet sich nun zu einem überdachten Marktplatz. Rechts wartet die geschwungene Theke eines Free-Flow-Restaurants mit Selbstbedienungstheke, unterteilt in die vier diätetischen Grundpfeiler der deutschen Küche: »Backen — Kochen — Braten — kalte Getränke«. Links stehen eine Handvoll Tische, die dem Augenschein nach eher auf kurzes Verweilen ausgelegt sind, hohe, schmale Möbel mit pinöppelförmigen Barhockern, die dahinter liegende Glasfront bietet einen Blick nach draußen, auf eine amphitheaterförmige Terrasse. Geradeaus, durch eine Luftschleuse, geht es ins Motel.
Dass meine Entscheidung, nach Garbsen Nord zu fahren, goldrichtig war, weiß ich spätestens in dem Moment, als ich mein Zimmer betrete. Über dem Doppelbett prangt nämlich, schwarz auf rosafarbigem Grund, eine gigantische Weltkarte — und in ihrem Zentrum sowie als einziger namentlich gekennzeichneter Ort steht groß und deutlich:
GARBSEN
Ein Fadenkreuz rahmt den Ortsnamen ein, weiße Linien verbinden ihn mit Asien, Afrika, Australien, den Amerikas, der Arktis und Antarktis: Garbsen Nord, durchfährt es mich wie eine religiöse Erleuchtung, liegt nicht nur am verkehrstechnischen Mittelpunkt von Deutschland, sondern geradezu am Nabel der Welt! Mein Omphalos! Mein Delphi!
Ich jubele noch eine Weile delirierend vor mich hin. Dann lasse ich mich aufs Bett fallen und versinke umgehend, ohne die Schuhe auszuziehen, erschöpft von Anreise, Hitze und emotionaler Überwältigung, in grundwassertiefen Schlaf.
Was bisher geschah
In den Siebziger- und Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, während meiner überaus wohlbehüteten Kindheit und Jugend am Rand einer überaus besenreinen südwestdeutschen Landeshauptstadt, warnten mich meine Eltern, wie es sich für sorgende Eltern gehört, vor allerhand schlechten Einflüssen. Vor falschen Freunden und Coca-Cola-Konsum. Vor Drogen und dem Bayernkurier. Vor Spielzeugpistolen und Feuerwerkskörpern, vor saurem Regen und Ronald Reagan, vor Fernsehserien mit Gewaltdarstellungen und Fernsehschauspielerinnen ohne Bekleidung, vor Orten, die man damals noch Disko nannte, und dem, was meine Eltern bis heute Beat-Musik nennen. Vor allem aber warnten sie mich vor dem Essensangebot auf deutschen Raststätten.
Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern jemals, etwa auf einer Urlaubsreise, mit meinem Bruder und mir eine Autobahnraststätte zum Zweck der Nahrungs- oder Getränkeaufnahme aufgesucht hätten. Eine der meisterzählten Anekdoten meines Vaters drehte sich um einen Heringssalat, der ihm einmal vorgesetzt wurde, als er — ohne Zweifel in höchster Not und aus eklatantem Mangel an Alternativen — ein Rasthaus zur körperlichen Stärkung aufsuchen musste, sowie um die schnippische Antwort des Kellners, die ihm auf seine Beschwerde hin zuteil wurde (»Herr Ober, in meinem Heringssalat ist kein Hering!« — »Da haben Sie Pech gehabt.«). Auch das Tanken erledigten meine Eltern als gute, sparsame Protestanten (sie Schwäbin, er Preuße) meiner Erinnerung nach stets abseits der Autobahn, wo das Benzin billiger war, die Bedienung zuvorkommender, die Welt allgemein freundlicher und schöner.
Anders gesagt: In den Siebziger- und Achtzigerjahren befand sich das westdeutsche Raststättenwesen, obschon noch kein halbes Jahrhundert alt, bereits in der Dekadenzphase.
Dabei hatte alles mit den hehrsten Ansprüchen begonnen. Nichts weniger als »Werke der Kultur« sollten die Rastanlagen sein, die im nationalsozialistischen Deutschland seit Mitte der 1930er Jahre entstanden; so forderte es zumindest der Bauingenieur Fritz Todt, dem als NS-Generalinspektor für das Straßenwesen die Leitung des Reichsautobahnbaus und damit auch der zugehörigen Versorgungsbetriebe oblag.
Zum einen sollten die Anlagen organisch an die Autobahn angegliedert sein — welche ihrerseits, in den Worten Todts, ein »Kunstwerk in der Landschaft« darstellte. Zum anderen sollten sie sich durch eine »klare und würdige Gesamthaltung« auszeichnen, außerdem durch »künstlerische Geschlossenheit der Anlage, neuzeitliche architektonische Durchbildung der Einzelteile unter gleichzeitiger Wiederbelebung gesunder alter Handwerkskunst und sorgfältige Einfügung der Bauten in die umgebende Landschaft«, wie es das publizistische Organ des Generalinspektors, eine Fachzeitschrift mit dem schnörkellosen Namen Die Strasse, formulierte.
Natürlich war die Genese des deutschen Raststättenwesens untrennbar mit dem Bau der Reichsautobahnen verbunden: Mit dem von historischen Wegen, Wirtshäusern und Ortschaften weitgehend entkoppelten Straßennetz entstand die Notwendigkeit, neue Gelegenheiten zur Regeneration der Reisenden und ihrer Fahrzeuge zu schaffen. »(E)s treten im Langstreckenverkehr eine Anzahl zusätzlicher Bedürfnisse betrieblicher Art auf«, heißt es hierzu in Die Strasse,