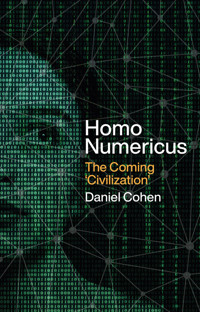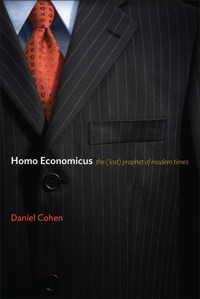5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sozialer Ausgleich statt Wachstumsdiktat
Alle Anzeichen sind bereits da: Angst, Abschottung und Fremdenfeindlichkeit. Wenn wir keine Antworten auf die Frage finden, wie wir ohne Wirtschaftswachstum leben wollen, wird der Westen in Gewalt und Hoffnungslosigkeit versinken. Wir können nicht länger Sündenböcke suchen und unseren Wohlstand auf die Ärmsten der Gesellschaft gründen.
Daniel Cohen, einer der führenden Ökonomen Europas und Experte für Staatsverschuldung, liefert eine brillante Analyse und wichtige Denkanstöße wie wir dem Wachstumsdilemma entkommen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
»Was wird aus unserer Erde, wenn sich die Verheißung eines unbegrenzten Wachstums als leere Versprechung erweist?« Daniel Cohen
Wenn wir keine Antworten auf die Frage haben, wie wir ohne Wachstum leben wollen, wird der Westen in Gewalt und Hoffnungslosigkeit versinken. Alle Anzeichen sind da: Angst, Abschottung und Fremdenfeindlichkeit, so Daniel Cohen, einer der führenden Ökonomen Europas und Experte für Staatsverschuldung. Sein glänzender Essay fordert dazu auf, die Konsequenzen des notwendigen Abschieds von der Wachstumsideologie zu diskutieren. Wir können nicht länger Sündenböcke suchen und unseren Wohlstand auf die Ärmsten der Welt gründen.
Der Autor
Daniel Cohen, 1963 in Tunis geboren, ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler. Er leitet die ökonomische Fakultät der École normale supérieure (ENS) und ist Mitbegründer der Paris School of Economics.
Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de
Daniel Cohen
Die Welt bleibt klein und unsere Bedürfnisse sind grenzenlos
Eine Wachstumskritik
Aus dem Französischen von Enrico Heinemann
KNAUS
Für Pauline, mein Kindermädchen,
die dieses Buch ebenfalls lesen muss.
»Weil der Mensch die materiellen Verhältnisse
seines Lebens verkennt, irrt er gewaltig.«
Georges Bataille, La Part maudite
Inhalt
Einleitung
I. Die Ursprünge des Wachstums
Der Mensch
Der Exodus
Der 13. November 2026
Die Geburt des Geldes
Der Raub der Geschichte
Von der kleinen Welt zum grenzenlosen Universum
II. Die Zukunft! Die Zukunft!
Die Singularität ist nah
Wohin entwickelt sich die menschliche Arbeit?
Das verschwundene Wachstum
Marx in Hollywood
Über den neuen Kollaps
III. Den Fortschritt überdenken
Der (nochmalige) große Wandel
Autonomie und Überleben
Mythen und Ressentiments
Die Doppelbindung
Wie wird man Däne?
Die soziale Endogamie
Jenseits des Wachstums
Schlussbemerkung
Dank
Anmerkungen
Einleitung
Das Wirtschaftswachstum ist die Religion der modernen Welt. Es ist ein Elixier, das Konflikte entschärft und unbegrenzten Fortschritt verheißt. Es bietet eine Lösung an für das gewöhnliche Drama des Lebens: dass der Mensch stets das will, was er nicht hat. Doch leider ist das Wachstum, zumindest in der westlichen Welt, in einen stockenden Verlauf geraten und flüchtig geworden. Boom folgt auf Krise und Krise auf Boom. Wie Hexer, die den Regen beschwören, strecken die Politiker die Hände zum Himmel, um es herbeizuzaubern, und ziehen sich den Groll der Völker zu, wenn es ausbleibt. Sucht die moderne Welt dann nach einem Sündenbock, weicht sie der zentralen Frage aus: Was wird aus unserer Erde, wenn sich die Verheißung eines unbegrenzten Wachstums als leere Versprechung erweist? Wird sie andere Befriedigungen finden oder verzweifeln und in Gewalt versinken?
Historiker sprachen von einer »europäischen Bewusstseinskrise«, um der tief sitzenden spirituellen Angst einen Namen zu geben, die im 17. Jahrhundert über Europa hereinbrach, als es mit Galilei und Kepler entdeckte, dass das Universum mit seinen Sternen nicht der Sitz der Götter ist. In einer ähnlichen Krise leben wir heute. Wenn sich das Wachstum verflüchtigt, verliert das Ideal des Fortschritts offenbar seinen Sinn. Ist das Leben noch lebenswert, wenn man es der Hoffnung auf das Göttliche beraubt, fragten sich unsere Ahnen. Heute lautet die Frage: Wird unser Leben trist und rau, wenn uns das Versprechen auf materiellen Fortschritt genommen wird?
Der große englische Ökonom John Maynard Keynes warnte Anfang der 1930er-Jahre vor dem Pessimismus seiner Zeit und gab eine Botschaft der Hoffnung aus, die bis heute erfrischend wirkt. Angesichts der sich damals abzeichnenden Krise forderte er dazu auf, keine falsche Diagnose zu stellen. Das »Wirtschaftsproblem«, so verkündete er, werde ebenso gelöst werden wie ein Jahrhundert zuvor das der Ernährung. Indem er die Geschwindigkeit, mit der die Industrie wuchs, hochrechnete, kam er zu der kühnen Behauptung, im Jahr 2030 müssten die Menschen nur noch drei Stunden täglich arbeiten und könnten sich somit dann den eigentlich wichtigen Aufgaben des Lebens widmen: der Kunst, der Kultur und der Metaphysik.
Doch Kultur und metaphysische Probleme sind bedauerlicherweise nicht zu den bedeutendsten Fragen unserer Zeit geworden. Mehr denn je bestimmt das Streben nach materiellem Wohlstand die modernen Gesellschaften, obwohl diese inzwischen sechsmal reicher sind als die Gesellschaften zu Zeiten von Keynes’ Prognose. Der große Ökonom sah den künftigen Wohlstand vollkommen richtig vorher, irrte sich aber gründlich in der Einschätzung dessen, wie wir mit ihm umgehen würden. Wie viele vor ihm verkannte er die ungeheure Anpassungsfähigkeit der Bedürfnisse des Menschen, der stets bereit ist, sämtliche Ressourcen auszuschöpfen, wenn es darum geht, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. »Sobald die Grundbedürfnisse befriedigt sind«, schrieb René Girard, »und zuweilen schon davor, überkommt den Menschen ein intensives Begehren, allerdings weiß er nicht, wonach. Denn er begehrt das Sein, ein Sein, von dem er das Gefühl hat, dass es ihm fehle und dass ein anderer es habe.« Wachstum ist kein Mittel zum Zweck. Es funktioniert eher wie eine Religion, von der erwartet wird, dass sie den Menschen dabei hilft, sich der Pein ihrer Existenz zu entwinden.
In einer Zeit, in der Milliarden Menschen diesem Gott huldigen und das Leben auf dem Planeten gefährden, ist ein grundlegendes Umdenken unabdingbar geworden. Kann man Keynes’ Prognose aufgreifen, aber andersherum davon ausgehen, dass sich das materielle Wachstum verabschiedet, und trotzdem in eine neue Ära des Glücks eintreten, sei es psychologischer, immaterieller oder anderer Art? Kurzum, kann man darauf setzen, dass Fortschritt an sich immer noch möglich ist?
Der Fortschrittsgedanke war Gegenstand eines gewaltigen Missverständnisses. Das Zeitalter der Aufklärung, das ihn im 18. Jahrhundert ins Spiel brachte, erhob ihn zu einem moralischen Wert, der mit Selbstbestimmung und Freiheit verknüpft war und sich kritisch gegen den Stillstand unter dem Ancien Régime richtete. Die industrielle Revolution, die sich im Lauf des 19. Jahrhunderts in Europa entfaltete, machte dieses Ideal zur Verheißung besserer materieller Lebensbedingungen. Doch mit dem Aufbau gesellschaftlicher Strukturen, der mit dem industriellen Fortschritt einherging, wandte sie sich wieder von diesem Ideal ab! Zwar verdrängten Ingenieure die Priester, die industrialisierte Gesellschaft aber behielt ihre vormalige vertikale Ausrichtung bei. In der Familie wie in der Fabrik blieb das hierarchische Modell beherrschend, und der Fordismus, der das Aushängeschild der industrialisierten Welt war, bewahrte dessen pyramidalen Aufbau selbst noch im 20. Jahrhundert. In Frankreich sollte es bis 1965 dauern, ehe Frauen ein Bankkonto eröffnen durften, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis zu bitten! Rund zwei Jahrhunderte nach der Französischen Revolution standen sie bei zahlreichen Rechtsangelegenheiten immer noch unter der Vormundschaft ihres Mannes. Für Frauen, wie für viele andere gesellschaftliche Gruppen, blieb die Vorstellung von Freiheit und Selbstbestimmung noch lange ein leeres Wort.
Erst in jüngster Zeit, erst im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte, verschwanden schließlich die letzten Überreste der bäuerlichen Gesellschaft. Die Arbeiter bearbeiten nicht mehr (landwirtschaftliche oder industrielle) Materie, sondern Informationsflüsse. Glaubt man dem US-Politologen Ronald Inglehart, so hat inzwischen die Kreativität die Autorität als strukturierenden Wert abgelöst. In seinen Augen haben die Ideen der Aufklärung doch noch ihre Revanche bekommen. Die Beschulung der Massen und der Wohlfahrtsstaat haben die Menschen aus Elend und Aberglauben geholt. Doch Inglehart verfällt bedauerlicherweise Keynes’ Irrtum, wenn er schlussfolgert, dass eine postmaterialistische Welt, die von den Zufälligkeiten der Notwendigkeit befreit wäre, in Reichweite sei. Im Gegenteil: Die postindustrielle Gesellschaft führt nicht zu Zuversicht und Toleranz, sondern zu wirtschaftlicher Unsicherheit und Angst vor der Zukunft und richtet so die Ideale, die sie doch hochhalten soll, am Ende zugrunde.
Wie einst der feudalen Welt war es der industriellen Gesellschaft, wenn auch verspätet, gelungen, eine bestimmte Produktionsweise und eine bestimmte Art, den Menschen Schutz zu bieten, zu vereinen. Heute installiert die neue digitale Wirtschaft unter dem vollständigen Bruch mit dem Vorangegangenen das Produktionsmodell der »Nullkosten«. Billige Software übernimmt Routineaufgaben von jeder erdenklichen Komplexität – vom Schachspiel über die Ausstellung von Fahrscheinen bis zu Börsentransaktionen. Google steuert über Computer Fahrzeuge. In Japan kümmern sich Roboter um alte Menschen. Angesichts des anschwellenden Digitalisierungsstroms, der bald jede Tätigkeit mit sich zu reißen scheint, steigt die nervliche Anspannung der Menschen, die am Arbeitsplatz ihrer Ersetzung durch Software entgehen wollen, in bislang unerreichte Höhen. Um eine Formulierung des Juristen und Psychoanalytikers Pierre Legendre aufzugreifen, lebt der moderne Mensch »über seinen psychischen Verhältnissen«, wie ein überschuldeter Haushalt, der sich in einer unhaltbar gewordenen Situation weigert, zur Kenntnis zu nehmen, dass sein Wohlstand verloren ist.
Die digitale Gesellschaft wird von einem seltsamen Paradox beherrscht: Während die technologischen Perspektiven, die sie eröffnet, noch nie so strahlend waren, fallen die Wachstumsaussichten enttäuschender denn je aus. In den USA haben 90 Prozent der Bevölkerung während der letzten dreißig Jahre keinerlei Steigerung ihrer Kaufkraft erlebt. In Europa sank das durchschnittliche Wachstum pro Einwohner im gleichen Zeitraum von 3 auf 1,5 und schließlich auf 0,5 Prozent. Wir erleben, was als Widerspruch in sich erscheint: eine industrielle Revolution ohne Wachstum! Wie ist diese erstaunliche Situation zu verstehen? Warum generiert die digitale Ära nicht die gleiche Beschleunigung wie ein Jahrhundert zuvor das elektrische Zeitalter?
Eine erste Erklärung ist auf der Seite der Arbeit zu suchen. Damit starkes Wachstum entsteht, genügt es nicht mehr, dass leistungsfähige Maschinen Menschen ersetzen. Vielmehr müssen Maschinen diejenigen, deren Arbeitsplätze sie vernichten, in neue Beschäftigung bringen. So war das Wachstum des 20. Jahrhunderts deshalb besonders robust, weil die Bauern, die aus ihrer ländlichen Arbeit vertrieben wurden, in der Stadt auf ein großes Potenzial an Industriearbeitsplätzen stießen. Heute reicht es nicht, dass an die Stelle wegfallender Arbeitsplätze in der Industrie solche für Gärtner entstehen, um ein dauerhaftes Wachstum zu gewährleisten. Dafür müsste schon der Gärtner Methoden ersinnen, mit denen sich die Quantität oder die Qualität (?) seiner Blumen steigern ließe.
Das führt zur zweiten Erklärung. Die Industriegesellschaft hat die gewaltige Aufgabe erfüllt, die Bevölkerung zu urbanisieren. Deutlich weniger ambitioniert ist die postindustrielle Gesellschaft. Sie bemüht sich zwar, soziale Interaktionen (durch Mitfahrgelegenheiten, Partnervermittlungen, ein großes Angebot an sozialen Kontakten und vieles mehr) zu verbessern, Belastungen (durch Lärm oder Umweltprobleme) zu reduzieren und die Angebotsvielfalt an Fernsehprogrammen auszubauen, schafft es aber laut dem Wirtschaftswissenschaftler Robert Gordon nicht, eine wirklich neue Konsumgesellschaft zu begründen. Abgesehen vom Smartphone erfährt der Verbraucher keine neuen Anstöße wie einst durch die Entwicklung der Glühbirne, des Automobils, des Luftverkehrs, des Kinos oder der Klimaanlage. Die digitale Gesellschaft presst Beschäftigte wie Zitronen aus (Produktionsseite), bringt dabei aber (auf der Konsumseite) eine Welt hervor, die von den Tablets und Smartphones als ihrem Markenzeichen längst übersättigt ist.
Diese Einwände werden von denjenigen, die die technischen Neuerungen begeistert bejubeln, mit scheinbar ermutigenden Prognosen beiseitegewischt, zum Beispiel mit der des »transhumanistischen« Projekts, wonach bald jeder über neue – biologische und digital gesteuerte – Organe verfügen könne, um seinen Körper und Intellekt aufzubessern und leistungsfähiger zu machen. Wenn die Weiterentwicklung der Mikroprozessoren ihr bisheriges Tempo beibehielte, müsse man nächstens die gesamte im Gehirn abgespeicherte Informationsmenge auf einem einzigen USB-Stick unterbringen und dann dessen Leistung steigern können. »Wir transzendieren die Biologie!«, verkündet stolz der Ideengeber Ray Kurzweil, für den selbst die Unsterblichkeit in den Bereich des Möglichen rückt.
Nichts spricht für die Behauptung, wonach die gentechnische Revolution mehr Wachstum als die informationelle generieren könne. Aber das transhumanistische Projekt ist wohl weniger eine Prognose als vielmehr ein neuerliches Zeugnis unseres unstillbaren Verlangens zu glauben, dass uns eine neue Revolution bevorsteht.
Die moderne Gesellschaft braucht für ihren Selbsterhalt unbedingt Wachstum. Aber wie weit ist sie zu gehen bereit, um es wiederzufinden? Der Science-Fiction-Film Blade Runner, der nach einem Roman von Philip K. Dick entstand, vermittelt die düstere Vision einer schon bald bevorstehenden Welt. Los Angeles erstickt an der Luftverschmutzung. Die gentechnische Industrie hat immer perfektere Klone geschaffen, die als Sklaven menschliche Aufgaben übernehmen. Verkörpert von Harrison Ford, ist die Hauptfigur Rick Deckard damit betraut, aufständische sogenannte Replikanten zu bekämpfen. Deckard verliebt sich in eine Androidin, die ihm in dem Augenblick, da er ihr eröffnet, dass sie kein Mensch ist, die Einsamkeit seines Lebens drastisch vor Augen führt. Roboter, Replikanten, Erderwärmung oder im Smog erstickende Städte: Das sind Bilder einer möglichen Welt, die nicht zum Träumen einladen, einer Welt, in der die Menschheit – psychisch wie ökologisch – »über ihre Verhältnisse« lebt.
In La Part maudite (»Die verfluchte Seite [der Ökonomie]«) hatte Georges Bataille diesen wiederkehrenden Fluch menschlicher Gesellschaften untersucht, »allenthalben an die Grenzen [ihrer] Möglichkeiten gehen zu wollen«, als ließen sich diese nicht anders ausloten. Kann man diesem Fluch überhaupt entrinnen? Wir sind dabei, ohne bewusste Entscheidung unsere Wiederbegegnung mit der Aufklärung zu verderben. Können wir den Werten Selbstbestimmung und Freiheit eine Chance geben, ohne in die Falle der Unsicherheit zu tappen? Können wir auf globaler Ebene zu einer Zeit, da Milliarden von Menschen den Weg in die Industriegesellschaft antreten, vermeiden, ins »Chaos« zu fallen, und unsere Epoche begreifbar machen?
Das sind die brennenden Fragen, auf die es angesichts der Begrenztheit der Welt Antworten zu finden gilt. Sie führen auf eine lange Reise in das Verständnis des menschlichen Begehrens und der Tonlagen, in denen es sich im Verlauf seiner langen Geschichte geäußert hat.
Der Mensch
Ist die Sehnsucht nach Wachstum ein Wesensmerkmal des Menschen? Die Frage erscheint kurios, denn der Wachstumsbegriff, wie wir ihn heute kennen, bildete sich erst in den letzten beiden Jahrhunderten heraus. Von den Anfängen der Menschheitsgeschichte bis zur industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hielt sich das Einkommen der Menschen hartnäckig auf dem heutigen Niveau der ärmsten Erdenbewohner, die mit etwa einem Euro pro Tag auskommen müssen. Wachstum im Sinne einer kontinuierlichen Steigerung des Durchschnittseinkommens ist die große Neuheit der modernen Welt. Räumt man allerdings ein, dass sich der Zeitenlauf anfangs in Jahrtausenden, dann in Jahrhunderten und schließlich in Jahrzehnten bemaß, reicht das Wachstum doch sehr viel weiter in die Geschichte zurück und erscheint in vielerlei Hinsicht als eine typisch menschliche Disposition.
Zweimal hat eine Art Urknall den Gang der zivilisatorischen Entwicklung, gemessen an der gesamten Menschheitsgeschichte, in kürzester Zeit verändert. Der erste Knall erfolgte mit dem Aufkommen der Landwirtschaft, die eine Bevölkerungsexplosion zur Folge hatte, die bis heute anhält. Die Weltbevölkerung stieg von 5 Millionen vor zehntausend Jahren auf 200 Millionen im christlichen Zeitalter und könnte bis zum Jahr 2050 10 Milliarden erreichen, eine Zahl, bei der sie sich dann stabilisieren sollte. Die Landwirtschaft schuf die Voraussetzung dafür, dass die Schrift, das Geld, die Metallverarbeitung, der Buchdruck, der Kompass und das Schwarzpulver erfunden wurden.
Der zweite Urknall erfolgte mit der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts, die dem menschlichen Wissen eine neuartige Kraft verschaffte, die für exponentielle Zuwächse sorgte. Um eines von tausend jüngeren Beispielen anzuführen: Nach der ursprünglichen Schätzung des Ökonomen William Nordhaus sanken die Kosten, die damit verbunden sind, eine standardisierte Menge an Berechnungen durchzuführen, innerhalb der letzten fünfzig Jahre um einen Faktor von über einer Milliarde.
Inzwischen erleben wir den Beginn eines dritten Urknalls, in dem sich diese beiden Kräfte – Bevölkerungsexplosion und Wissenszuwachs – wechselseitig verstärken. Paul Crutzen, Nobelpreisträger für Chemie, charakterisiert unsere Ära als ein »Anthropozän«, als den Übergang von einer von der Natur beherrschten Welt zu einer, in welcher der Mensch regiert. Die Bedeutung dieses Begriffs macht allein schon eine Zahl deutlich: Als sich die Landwirtschaft herausbildete, stellten die Menschen und ihr Vieh weniger als 0,1 Prozent aller Säugetiere auf dem Globus. Heute sind es über 90 Prozent.
Angesichts der besonderen Herausforderung, in einer Welt der begrenzten Ressourcen zu leben, die sich leicht erschöpfen, müssen sich die Menschen dazu verpflichten, gemeinsam über die Folgen ihres Handelns nachzudenken. Doch dieser Mühe haben sie sich bislang nicht unterzogen, da sie von einer historischen Entwicklung geprägt sind, deren reale Auswirkungen sie in ihrem ganzen Ausmaß erst im Nachhinein begriffen. Um die Hoheit über ihre Zukunft zurückzugewinnen, müssen die Menschen den Faden ihrer Geschichte wieder aufnehmen und versuchen zu erkennen, was Zufall und was Notwendigkeit war. Wie und warum entstand das Wirtschaftswachstum in der Bedeutung, die wir ihm heute beimessen? Welche besonderen Gründe lassen sich dafür anführen, dass es zuerst in der westlichen Welt aufkam und nicht in China oder anderswo? Ist dieser Umstand als Zeichen einer philosophischen, politischen und moralischen Überlegenheit des Abendlands zu bewerten oder handelt es sich dabei um einen Zufall, dessen Ende absehbar ist? Das sind entscheidende Fragen, um zu verstehen, woher es kommt, dass wir in moderner Zeit weniger vom Reichtum selbst als vielmehr von dessen grenzenloser Ausweitung abhängig sind. Sie zwingen uns dazu, den »Prozess der Zivilisation« nachzuvollziehen, wie man mit dem Soziologen Norbert Elias sagen könnte.
Der Homo sapiens
Als vor sechs bis acht Millionen Jahren die ersten Hominiden in Erscheinung traten, deutete nichts darauf hin, dass sie sich eines Tages zum Herrscher über den Planeten aufschwingen würden. Ameisen und Termiten hatten Hunderte von Millionen Jahre benötigt, um den Boden zu erobern, und den anderen Spezies ausreichend Zeit zur Anpassung an die neuen Verhältnisse gelassen. Der Mensch hat die Erde in einem deutlich kürzeren Zeitraum besetzt und scheint in besonderer Weise darauf zu beharren, sie zu zerstören!
Die ältesten menschenartigen Fossilien stammen aus der Zeit von vor sieben Millionen Jahren: die des Toumaï, eines Sahelanthropus tchadensis, dessen Schädelvolumen dem eines heutigen Schimpansen entspricht. Es folgt der Australopithecus afarensis, die Spezies »Lucy«, die 1974 von Yves Coppens entdeckt wurde (und deren Name eine Hommage an einen Beatles-Song ist). Nach ihr kam der Homo habilis, eine Unterart, die vor zweieinhalb Millionen Jahren auftauchte und siebenhunderttausend Jahre später wieder verschwand. In einem trockener werdenden Klima entstanden Savannenlandschaften und verdrängten die Wälder, in denen er lebte (seine langen Arme deuten auf Klettern in Bäumen hin). Es folgte der Homo erectus (zeitgleich mit Homo ergaster als Vetter), mit dem eine erstaunliche Weiterentwicklung des Gehirns einsetzte.1 Diese Weiterentwicklung stattete den Menschen mit dem bemerkenswerten Rüstzeug aus abstraktem Denken, einer Sprache mit Satzbau, dem Langzeitgedächtnis und der Fähigkeit, hypothetische Szenarien zu entwerfen, in einer Gruppe zu kooperieren sowie die Absichten von Feinden vorherzusagen, aus.2
Dem Experten für Evolutionsanthropologie Michael Tomasello zufolge beruht die Überlegenheit des Menschen auf dessen Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. »Wir wurden Experten darin, die Gedanken anderer zu lesen, und Weltmeister im Erfinden neuer Kulturen.«3 Jäger und Sammler schwatzten (gossip) wie heute die Börsenmakler der Wall Street bei jeder Gelegenheit miteinander. Oberflächlich betrachtet ist die Soziabilität des Menschen mit der der Insekten vergleichbar, die ebenfalls zu einer erstaunlichen Arbeitsteilung fähig sind, um die eigene Art zu erhalten. Aber die Kooperation der Bienen ist nicht wirklich »kooperativ«: Nur die Königin gibt mit einer Drohne ihr genetisches Erbe weiter. Sie zieht an einen anderen Ort und kappt die Bindungen zu ihrer Ursprungskolonie, um eine eigene zu gründen. Dagegen greift die menschliche Spezies auf subtilere und flexiblere Mittel zurück: In einer Mischung aus Altruismus, Dominanz, wechselseitigem Geben und Nehmen, Verrat und Lügen agieren die Menschen auf der großen Bühne des Soziallebens das eigene Schicksal aus.
Menschen führen in einer extrem kurzen Zeitspanne Neuerungen herbei. Bei den Tieren sterben die meisten Innovationen mit ihnen. Weibliche Schimpansen bringen ihrem Nachwuchs zwar bei, wie er Nüsse knacken und mit entlaubten Ästen Termiten angeln kann, doch die menschliche Sprache ermöglicht weit mehr, nämlich das kollektive Lernen. Da wir mit den Schimpansen als unseren Vettern 98,4 Prozent unserer DNS teilen, sind wir als Individuen nicht wesentlich genialer als sie, haben es als Spezies aber um Lichtjahre weitergebracht. Während das Gehirn eines einzelnen Schimpansen den Vergleich mit dem eines Menschen kaum zu scheuen braucht, liegen zwischen der Summe der menschlichen Intelligenzen und der der Affen Welten.
Ihre gesamte Geschichte hindurch hat die Menschheit Methoden entwickelt, um Wissen anzuhäufen und zu verbreiten, und damit dessen – technische und soziale – Schlagkraft vervielfacht. Die Schrift, das Geld, sehr viel später der Buchdruck, das Telefon und das Internet sind Hilfsmittel, die es möglich gemacht haben, eine kollektive Intelligenz zu entwickeln, mit der keine tierische Spezies mithalten kann.
Das Gehirn vereint in sich sowohl die Veranlagung zu einer hohen Intelligenz in der Art eines Computers als auch zu Gefühlen wie denen eines verliebten Teenagers. Egoistisch und altruistisch, rational und feinfühlig: Wie ist es unserer Spezies gelungen, diese widersprüchlichen Eigenschaften in Einklang miteinander zu bringen? Den Forschungen nach, die Edward Wilson in Die soziale Eroberung der Erde4 veröffentlichte, sind zwei biologische Merkmale des Menschen dafür ursächlich: seine (beachtliche) Körpergröße und seine (eingeschränkte) Mobilität. Im Vergleich mit den Dinosauriern sind Menschen zweifellos eher klein, im Vergleich zu Insekten hingegen (sehr) groß. Letztere sind zu klein, um die Materie oder das Feuer zu beherrschen. Aber sie bewegen sich schnell und über große Distanzen und entziehen sich so dem Kontakt mit anderen Gruppen. Dagegen sind Menschen mit ihrer eingeschränkten Mobilität zu einem (friedlichen oder konfliktreichen) Zusammenleben mit ihren Artgenossen gezwungen. Unfähig, so schnell wie ihre Beutetiere – Antilopen, Zebras oder Strauße – zu laufen, können sie sie über weite Strecken verfolgen und mit Geschossen erlegen: indem sie mit Steinen nach ihnen werfen oder, in späterer Zeit, mit Speeren oder Pfeilen. Und zur Jagd dient auch das Feuer, über dem sich das Fleisch der Beute anschließend garen lässt.
Die Erfindung der Kultur
Einer Gruppe oder einem Stamm anzugehören und diesen gegen rivalisierende Gruppen zu verteidigen, ist Bestandteil der menschlichen Natur. Um dieses erstaunliche Zusammenwirken von Altruismus und Individualismus zu erklären, das man bei zahlreichen Arten findet, liegt es nahe, Theorien vom »egoistischen Gen« zu bemühen. Während sich aber beispielsweise männliche Gottesanbeterinnen von weiblichen Artgenossinnen verspeisen lassen, um die Fortpflanzung und damit den Erhalt ihrer Art zu sichern, gehorcht die menschliche Stammesgemeinschaft deutlich komplexeren Antrieben als allein jenem der Weitergabe von Genen. Psychologische Tests (mit Studenten) zeigten, wie rasant Menschen völlig willkürlich Clans bilden. Verteilt man blaue beziehungsweise rote Karten an zwei Untergruppen von Personen, die sich nicht kennen und auch nicht miteinander verwandt sind, stellt sich durch die jeweilige Farbe rasch ein Gefühl der Solidarität ein. Grenzen zwischen Gruppen sind voll und ganz veränderlich: Familien, Bündnisse oder Verbände weisen in einer chaotischen Welt jedem einen Platz zu.
In Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft5 erklärt Claude Lévi-Strauss, dass der Mensch die einzige Spezies sei, die sich selbst domestiziert habe. Das Inzestverbot ist in seinen Augen der Gründungsmoment, in dem die Kultur über die Natur die Oberhand gewonnen habe: Ich tausche meine Tochter gegen deine, auf dass unsere Sippen in Frieden nebeneinander leben. Die Fähigkeit, Verbote und Klassifikationen ohne jeden biologischen Grund zu schaffen, ist ein wiederkehrendes Merkmal des Menschen. Eine Tochter kann (und muss mitunter sogar) ihren Cousin mütterlicherseits heiraten, nicht aber den Cousin väterlicherseits, obwohl dabei aus genetischer Sicht kein grundlegender Unterschied besteht. Das ist die Grundlage der Kultur: in Bezug auf das Erbgut vollkommen arbiträre Regeln aufzustellen, welche die Modalitäten des sozialen Lebens bestimmen.
Gleichwohl ist Kultur keineswegs das Monopol des Menschen. Bei Schimpansen gesellen sich Weibchen zu benachbarten Gemeinschaften, während die einem Herdentrieb folgenden Männchen in der Gruppe, in die sie hineingeboren wurden, ihre Stellung behaupten. Die Wölfe und Wildhunde Afrikas leben in einer ausgefeilten Organisation, in der Jäger das Alphaweibchen und dessen Welpen mit Nahrung versorgen. Schimpansen und Bonobos jagen in der Gemeinschaft. Letztere zeigen ein überschießendes Sexualverhalten, das nicht nur der Fortpflanzung, sondern auch dazu dient, Spannungen unter Gruppenmitgliedern zu entschärfen. Rhesusaffen stellen ein empathisches Verhalten unter Beweis, und die Gewalttätigkeiten von »Banden« junger Schimpansen gegen ihre Artgenossen ähneln verblüffend menschlichem Verhalten!
Überall im Tierreich erfordert das Überleben Kooperation in der Gruppe, um gegen Fressfeinde bestehen zu können. Umgekehrt begünstigt die Konkurrenz (der männlichen um die weiblichen Tiere) entgegengesetzte Veranlagungen, durch die sich jeder selbst der Nächste ist. Dabei stehen diese beiden Eigenschaften manchmal in keinem direkten Zusammenhang, denn die Natur richtet nicht immer alles perfekt ein: Eine Gazelle muss schneller sein als die anderen Gazellen, um ihren Verfolgern zu entkommen, nutzt damit aber auch letztlich der Art insgesamt. Pfaue, das notierte Darwin, können mit ihrem prachtvollen bunten Schwanz zwar Weibchen anlocken, sind aber dadurch zugleich bei der Flucht vor Fressfeinden behindert. Hirsche besiegen mit ihrem Geweih einen Rivalen, bezahlen dies aber mit einer eingeschränkten Mobilität, die zum Handicap werden kann. So ergeben sich für den einzelnen Hirschbullen durch sein Geweih Vorteile bei der Paarung, aber das kann zuweilen auf Kosten des Arterhalts gehen.6
Was ist der Mensch?
Kehren wir zu unserer Frage zurück: Was unterscheidet den Menschen von anderen Arten? Freud stellt sie so: »Warum zeigen unsere Verwandten, die Tiere, keinen solchen Kulturkampf?«7 Mit einem »solchen Kampf« meint er das Unbehagen, die Besorgnis oder die Pein der Existenz. Als Einziger unter den Arten, so schreibt Pierre Legendre, hinterfrage der Mensch »seine Präsenz, die Tatsache seiner eigenen Existenz«.8 Sophokles verkündet in Ödipus auf Kolonos, es sei besser, nicht geboren zu werden. Alle Kulturen treibt die menschliche Frage schlechthin um: Wer bin ich, wozu leben wir, in welchem Namen?
Am einfachsten lässt sich der Mensch als ein sprechendes Tier charakterisieren, das nach einem Gesprächspartner sucht, der ihm zuhört und antwortet und dessen Anerkennung er begehrt. Nach Pierre Legendre ist das »revolutionäre« Kennzeichen des Menschen sein Verlangen nach Legitimität. Verrat falle ihm niemals leicht, selbst wenn ihn die Umstände dazu zwängen. Ehre, Tugend und Pflicht stünden beim Menschen mit deren Gegensätzen Egoismus, Feigheit und Heuchelei in einem ständigen Spannungsverhältnis. Diesem Konflikt, der sich durch die Menschheitsgeschichte ziehe, verleihe Kultur, so auch die Kunst, einen Ausdruck und helfe ihn lösen.
»Wir sind die einzige Spezies, die nicht nur wie andere Tierarten in Gesellschaft lebt, sondern auch neue Formen der sozialen Existenz und damit der Kultur hervorbringt, um ihren Fortbestand zu sichern. Dass er Gesellschaft produziert und nicht reproduziert, ist das Wesensmerkmal des Menschen!«, schlussfolgert Maurice Godelier in einem Buch, das er Lévi-Strauss gewidmet hat.9 Das soziale Zusammenspiel der Tiere entwickelt sich kaum oder überhaupt nicht weiter. Junge Affen tragen keine Fußballturniere aus, sehen aber auch keine Gewaltvideos oder Pornografie im Internet. Wir Menschen hingegen haben im Verlauf der Kulturgeschichte immer wieder die Regeln spielerisch verändert. Wir können das Modell der Verwandtschaft, der Fortpflanzung abwandeln und das in uns steckende Gewaltpotenzial (zuweilen) beschönigend kaschieren. Das Problem liegt, wie Georges Bataille10 festgestellt hat, darin, dass wir die von uns geschaffenen Regeln für unangreifbar halten und dass wir die Gesellschaft, die sie befolgt, lieber in den Abgrund führen, als die Regeln zu verändern.
Der Exodus
Vor ungefähr hunderttausend Jahren suchte eine extreme Dürre das tropische Afrika heim11 und brachte die sich entwickelnde Menschheit an den Rand der Auslöschung. Ihr Bestand ging bis auf einige tausend oder zigtausend Individuen zurück. Nach Ende der großen Trockenheit breiteten sich wieder üppige Tropenwälder und Savannen aus. Durch die günstigeren klimatischen Bedingungen wuchs die Population erneut an und drang bis ins Niltal und den Sinai vor. Von dort aus gelangte der Homo sapiens weiter in die Levante und schließlich um 40 000 vor unserer Zeitrechnung bis nach Europa, wo er ein Gebiet besetzte, das zu diesem Zeitpunkt schon seit etwa zweihunderttausend Jahren von seiner Schwesterspezies, dem Neandertaler, bewohnt wurde.12
Kurz nach Eintreffen des Homo sapiens starb der Neandertaler aus, voraussichtlich deshalb, weil der Neuankömmling dem alten Ökosystem seinen Stempel aufgeprägt hatte.13 Nach ihrer DNS zu schließen, konnten die Neandertaler sprechen und die »große Jagd« praktizieren; sie kümmerten sich um ihre Verletzten und bestatteten ihre Toten. Hypothesen zu den Unterschieden zum Homosapiens zufolge verfügte der Neandertaler wegen einer ungünstigeren Position des Kehlkopfs möglicherweise über eine verminderte Sprachfähigkeit, obwohl er ebenfalls das (für das Sprechen notwendige) Gen FOXP2 besaß.14
Die Erfindung der Landwirtschaft