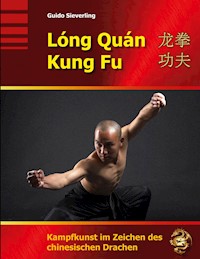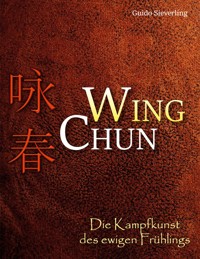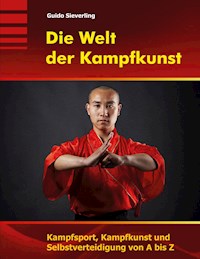
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer in der heutigen Zeit eine Kampfkunst erlernen möchte oder diese bereits betreibt, sieht sich mit einer Unzahl von lokalen oder weltweit agierenden Kampfstilen und Begriffen konfrontiert. Welche Bezeichnung steht wofür? Was verbirgt sich beispielsweise hinter Baojianggong, Chénggong Kung Fu, Viet Vo Dao oder Wing Chun? Das vorliegende Werk beschreibt 492 Kampfstile/-systeme und deren teilweise verwendete Waffen, sowie Prinzipien, Philosophien, Methoden und Entstehungsgeschichten ausführlich in Wort und Bild. Somit erhält der Leser ein umfassendes Lexikon, einen Leitfaden und einen ausführlichen Ratgeber aus dem Bereich des Kampfsports, der Kampfkunst und der Selbstverteidigung. Der Autor Guido Sieverling vermittelt in diesem Buch seine fast 40-jährige Erfahrung als Kampfkünstler, Meister und Großmeister, Hall of Fame-Mitglied, Wettkämpfer, Kampfrichter und Schulbesitzer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Stil/Begriff
Abanico
Abe-Ryū
Ägyptischer Stockkampf
Aikidō
Aiki-Jojutsu
Aikijutsu
Aiki-Osaka
Aikuchi
Ajukate
Allkampf
All Out Street Combat
All Style-Do Karate
Allstyle-Jitsu
Allstyle Jutsu
Allstyle Karate
Alpha Combat System
American Karate System
Anderthalbhänder
Anti-Terror-Kampf
Arnis
Baduanjin
Bafaquan
Bagua Qigong
Baguaquan
Bagua Taijigong
Baguazhang
Baihe Qigong
Bai He Quan
Baihui
Bai Lung Chuan Fa
Bai Meimao
Bajonett
Balisong
Bamen
Bamen Wubu
Bang
Baojianggong
Baoxingquan
Bare-knuckle
Bartaxt
Bastone Siciliano
Bate Coxa
Bâton Français
Bauernwaffen
Beipeai Tanglangquan
Berdysch
Bersilat
Beta 8
Binabayani
Binh Dinh
Blackjack
Blankwaffe
Bō
Bökh
Bōjutsu
Borreh
Boxen
Brancaille
Brazilian Jiu-Jitsu
Buckler
Budō
Buduan
Bujinkan
Bujutsu
Bulmudo
Buno
Bushidō
Cailifo
Canne
Capoeira
Chai dao
Chakram
Chan
Changjiaquan
Changquan
Chang Taijiquan
Chénggōng Kung Fu
Chinadi
Chinese Boxing
Chin Na
Chi-ryū Aikijutsu
Chi Sao
Choy Lee Fut
Chung Sin Kuen Do Kung Fu
Cinquedea
Claymore
Combat 56
Combat Hapkido
Combative Concepts
Combative Cross Training
Contus
Coryartes
Cuong Nhu
Daimyō
Daishō
Daitō-Ryū
Dānjiàn
Danza de Tijeras
Dao
Dashengquan
Dim Mak
Ditangquan
Dolch
Donga Stick Fighting
Dongdang
Donggong
Dōtanuki
Dreistock
Dreizack
Dumog
Dynamic Aikido Nocquet
Eiku
Elite Combat Program
El Matreg
Emeici
Enterdregge
Esdo
Esgrima Criolla
Eskrima
Estoc
Fajin
Falchion
Fang
Fangsonggong
Fanziquan
Faustkampf
Fechten
Feihe Quan
Fenjin
Ferozue
Flamberge
Flegel
Fränkischer Haken
Franziska
Freistilringen
Fu
Fujiaoquan
Fukuro shinai
Gaijin Goshin Jutsu
Gatka
Glefe
Glíma
Gohshinkan
Goju-Kann
Gong
Goshin-Jitsu
Goshinkwai Taijutsu
Grappling
Guan
Haidong Gumdo
Hakama
Hamidashi
Han Bai
Hanbō-Jutsu
Hangeomdo
Hanmudo
Hapkido
Hasta
Hayashizaki Musō-ryū
Heft
Henan Xingyiquan
Hequan
He Taijiquan
Hongquan
Hou Quan
Hōzōin-ryū
Hung Gar
Huquan
Huxingquan
HwarangDo
Iaidō
Iaitō
Illustrissimo Kali
Individual Combat System
Inosanto Kali
I-Shin
Isshin-ryū
Jambia
Jeet Kune Do
Jian
Jinggong
Jiu-Jitsu
Jōdō
Jogo do pau
Jūdō
Juego del Palo
Jujûtsu
Jūkendō
Jun Fan Gung Fu
Ju Tai Jutsu
Jutte
K-1
Kadgamala
Kajukenbo
Kallarippayat
Kali Sikaran
Kama
Kampfringen
Kara-Ho
Karate
Kashima Shin-ryū
Kashima Shinto-ryū
Kas-Pin
Katana
Katzbalger
Keiko-Gi
Kemet Mariama
Kempō-Karate
Kempo Naadaa
Kendō
Kenjukate
Ketten-Teile-Peitsche
Kickboxen
Kien Kun Do
Kim Ke
Kirri
Kitō-ryū
Kobayashi Shōrin-ryū
Kobudō
Kobukai Jiujitsu
Kodachi
Kodokan Goshinjutsu
Kombato
Kopesh
Kopis
Koppōjutsu
Koryū
Koshiki Karatedo
Koshinkan
Kosho Shorei-Ryu
Krabi Krabong
Krav Maga
Kriegsgabel
Kriegshammer
Kubikaki-Katana
Kubotan No Jitsu
Kuge
Kukishinden-ryū Happo Hikenjutsu
Kukishin-ryū
Kuk Sool Won
Kumdo
Kung Fu
Kun-Tai-Ko
Kuntao
Kutaeka Do
Kyŏksul
Kyokushin Budo Kai
Kyusho
Langschwert
Lanze
Lao Bazhang
Lee Taijiquan
Leichtkontakt
Lethwei
Lian
Liu He Ba Fa
Lochaber-Axt
Lung Hu Chuan
Luta Livre
Luzerner Hammer
Mabu
Macheira
Maculelê
Marine Corps Martial Arts Program
Meihuaquan
MilNakaDo
Minghe Quan
Miséricorde
Mixed Martial Arts
Modern Self Defense
Morgenstern
Mortuary Sword
Motobu-ryū
Muay Thai
Muay Thai Boran
Mudo
Musado
Nagamaki
Naginata
Nam Hồng Sn
Nanbudo
Nanpai Tanglangquan
Neigong
Neiqi
Nga Mi
Nihon Jujutsu
Nihontō
Ninjatō
Ninjutsu
Niten Ichiryū
Nunchaku
Nuntebō
Ocreae
Ōdachi
Okinawa-Te
Ōtsuchi
Operative Combat System
Pale
Pangai-Noon
Pangamut
Pankration
Panzerstecher
Peking-Form
Pekiti-Tirsia Kali
Pencak Silat
Piguaquan
Progressive Fighting System
Pudao
Qiang
Qiangzhuanggong
Qiankun Tunagong
Qigong
Qi Xing Tang Lang Quan
Quan
Qwan Ki Do
Ranggeln
Real Aikido
Real Arnis
Real Selfdefence Fighting
Richtschwert
Ringen
Ringknaufdolch
Rokushakukama
Romphaia
Rutte
Ryūei-ryū Karate
Ryu Kyu Kobudō
Sai
Sambo
Samurai
San-Bo-Jutsu-Kai
Sanjiegun
San Jitsu
Sanlie
Sanshiqi
San Shou
Sarit-Sarak
Savate
Saya
Schiavonesca
Schlagring
Schweizerdegen
Schwert
Schwingen
Seito Boei
Semikontakt
Seppuku
Serrada Escrima
Shan
Shang Afg Martial Arts System
Shaogun
Shaolin Kung Fu
Shaolinquan
Shemao
Shequan
Shexingquan
Shezhang
Shidokan Karate
Shierduanjin
Shihe Quan
Shikomizue
Shimmei Musō-ryū Iaidō
Shinden Fudō-ryū Dakentaijutsu
Shinjinbukan Shorin-ryū
Shinkendo
Shin-Ken-Ryu-Do
Shinson Hapkido
Shintaido
Shitō-ryū
Shixingquan
Shiziwu
Shōdōkan-Aikidō
Shootboxen
Shooto
Shorinji-Kempo
Shōrin-ryū Seibukan
Shotokai
Shoto Kempo
Shoto-Ryu Karate
Shuaijiao
Shuanggou
Shuriken
Sica
Sikaran
Silat
Singlestick
Sipar
Sōjutsu
Sound-Karate
Ssireum
Stangenwaffe
Stilett
Stilrichtungsfreies Karate
Streitkolben
Subak
Suhe Quan
Sui
Sumō
Sunbinquan
Surik
Suruchin
Svebor
Systema
Tabar Zin
Tachi
Taekgyeon
Taekido
Taekwondo
Taiji
Taijidao
Taijigong
Tàijíquán
Tai Jutsu
Taiken
Taishin Ryu Kobujitsu
Tambō
Tang Lang Quan
Tankendō
Tantō
Tantuiquan
Tatsu-Ryu-Bushido
Tecchū
Tekkō
Tendoryu Aikidō
Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū
Tescao
Tessen
Thaikido
Thaing
Tinbei
Togakure-ryū
Tombo Ryu Kenjûtsu
Tonfa
Tongbeiquan
Tong-Il Moo-Do
Trumbasch
Tsurugi
Tuifa
Tuishou
Uechi-ryū
United Karate System
Vajramushti
Vale Tudo
Varzesh-e pahlavani
Viêt Võ Đao
Vo Dao Vietnam
Võ Khí Đao
Vollkontakt
Vovinam
Wadokai Kono Style
Wadō-Ryū
Wakizashi
Weng Chun
Wing Chun
WonHwaDo
Wrestling
Wudangjian
Wudang Qi Gong
Wudang Tai Chi
Wun Hop Kuen Do
Wurfanker
Wushu
Wu Taijiquan
Wuwei
Wuxingchui
Xiaozhoutian
Xingyiquan
Xiphos
Xyston
Yabusame
Yağlı Güreş
Yang Taijiquan Xiaojia
Yari
Yari-Tantō
Yatagan
Yawara
Yaw-Yan
Ying Zhao Quan
Yin und Yang
Yiquan
Yong Chun Quan
Yoroi-dooshi
Yoseikan
Yoshin-ryū Jujutsu
Yuya
Zhanjing
Zhuajin
Zipota
Zonghe Quan
Zuibaxianquan
Zuiquan
Zweihänder
Vorwort
Was ist ein Buch, wenn es sich nur in den Gedankengängen oder auf der Festplatte des Schreibers befindet? Dies habe ich mir auch gesagt und deshalb dieses Buch geschrieben. Es soll dem Leser einen Anstoß dazu geben, die Faszination und die ganze Vielfältigkeit des Kämpfens kennen zu lernen und falsche Vorstellungen darüber abzubauen.
Ich selbst wurde im Jahr 1968 geboren. Seit dem Jahr 1984 habe ich elf verschiedene Kampfstile trainiert, wie beispielsweise Ninjutsu, Shaolin Kung Fu und Wing Chun. Diese Vielfältigkeit an Erlerntem sehe ich persönlich als das an, was es tatsächlich ist: Eine Erweiterung und Bereicherung von Wissen, Erfahrung, Lebenseinstellung und Bewusstsein.
Aus diesem Erfahrungsschatz heraus hatte ich mich dazu entschlossen, die Kampfkunstschule BUSHIDŌ in Lüdenscheid zu gründen, die Schule später in Kung Fu-Zentrum LÓNG QUÁN umzubenennen und das Chénggōng Kung Fu zu entwickeln. Als Stilgründer bin ich zwar das Oberhaupt und habe den Sigung-Titel (Großmeister), lege allerdings keinen so großen Wert auf diese Anrede, wie andere Kampfkünstler. Für mich ist dies nur ein Titel auf meinem Weg – lernen werde ich allerdings ein Leben lang.
Dieses Buch soll auch all denen helfen, die sich ihre eigenen Gedanken machen und nicht nur stupide nacheifern wollen, was ihnen vorgemacht wird. Das eigentliche Ziel der Kampfkünste besteht nicht darin, zerstörerisch oder gewalttätig zu wirken, sondern das Leben zu bewahren und zu verbessern.
Alles auf der Welt befindet sich im Wandel, so auch der Titel und Inhalt dieses Buches. War noch die erste Auflage unter dem Titel "Der Weg des Kämpfers" erhältlich, so wurde die zweite und dritte Ausgabe „Das Lexikon des Kämpfens betitelt. Die nun vorliegende Ausgabe wurde noch einmal komplett überarbeitet neu betitelt. Es wäre für mich die größte Belohnung für meine Mühe, wenn dieses Buch zumindest teilweise Antworten auf die gestellten Fragen geben kann, denn ein Buch, dass das eigene Nachdenken anregt, ist sicherlich höher zu bewerten als eines, das Problemlosigkeit vermitteln will.
Es wird aber auch Vereine und Verbände geben, die sicherlich eigene Sichtweisen inhaltlicher Art haben. Dies ist auch vollkommen normal und legitim, denn wer 100 Leute fragt, bekommt 100 verschiedene Antworten. Vielleicht trägt dieses Buch dazu bei, das Wissen und Training eines jeden Interessierten zu bereichern und sie dazu anzuregen, neue und unbekannte Bereiche in der Welt des Kampfes zu erschließen.
Jeder Mensch ist ein Individuum und besitzt andere geistige und körperliche Voraussetzungen. Diese sollten auch genutzt und nicht vergeudet werden.
Möge dieses Buch all denen helfen, die sich ihre eigenen Gedanken machen und nicht nur nacheifern, was ihnen vorgemacht wird.
Und nun wünsche ich allen Lesern viel Spaß beim Schmökern und Ihren persönlichen Weg zu finden…
Guido Sieverling
Sigung des Chénggōng Kung Fu, Sifu des Wing Chun, Sifu des Tiě Quán Chénggōng und Inhaber des Kung Fu-Zentrum LÓNG QUÁN
A
Abanico
Bei Abanico (dt. Fächer) handelt es sich um eine Schlagtechnik mit einer scharfen oder stumpfen Waffe. Dabei wird der Unterarm schnell um seine Längsachse gedreht (ähnlich der Bewegung mit einem Fächer). Wird eine Waffe verwendet, trifft so die Klingen-Breitseite den Gegner. Durch die relativ geringe Aufschlagswucht wird diese Technik hauptsächlich zur Vorbereitung eines Wirkungstreffers oder zur Irritation des Gegners benutzt. Das Abanico wird in den philippinischen Kampfkünsten angewandt.
Abe-Ryū
Das Abe-Ryū ist eine Stilrichtung des Ninjutsu und stammt aus Japan.
Ägyptischer Stockkampf
Die traditionelle Kampfkunst des ägyptischen Stockkampfes, stammt noch aus der alten pharaonischen Zeit. Erste Aufzeichnungen befinden sich in einem Tempel bei Luxor. Sie werden um das Jahr 1200 v. Chr. datiert. Dort ist die Ausübung dieses Sports mit kämpfenden Sportlern (die einen Gesichtsschutz tragen) und Schiedsrichtern zu sehen. Heute wird der ägyptische Stockkampf immer noch in manchen Regionen Ägyptens zu festlichen Anlässen vorgeführt. Gekämpft wird dabei mit mannsgroßen Stöcken.
Aikidō
Die moderne Kampfkunst Aikidō entstand erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Gründer Morihei Ueshiba entwickelte sie als Synthese verschiedener Aspekte unterschiedlicher Budō-Disziplinen. Sie ist eine Weiterentwicklung des Daitō-Ryū Aiki-Jūjutsu.
Die Namensbezeichnung setzt sich zusammen aus Ai für Übereinstimmung, Ki für Lebenskraft und Do für (Lebens-)Weg (wird auch als Energie, Harmonie und Weg/Methode übersetzt).
Die Gesamtbezeichnung kann in etwa übersetzt werden: Weg zur Harmonie der Kräfte, Der Weg der Harmonie mit der Energie des Universums oder Der Weg der Harmonie im Zusammenspiel mit Energie.
Foto „Aikido-Schule Takeshin“
Morihei Ueshiba nannte seine Entwicklung mehrfach um. Zuerst erhielt sie die Bezeichnung Aiki-Bujutsu, später Aiki-Budō. Erst im Laufe des Zweiten Weltkrieges erhielt sie ihren endgültigen Namen Aikidō. Der Ausdruck Aiki wurde bereits in älteren japanischen Kampfkünsten verwendet. Dort hatte sie die Bedeutung der „angemessenen Kraft“ im Sinne des Mitgehens mit dem Angreifer. Ueshiba erweiterte die Deutung des Begriffes auf eine auch spirituelle Harmonie.
Aikidō kann von Menschen jeden Alters und jeder Größe trainiert werden. Diese schwer erlernbare Kampfkunst benötigt mehrere Jahre Übung, bis ein Schüler in der Lage ist, sich effektiv zu verteidigen.
Es ist unbestritten, dass man sich durch Aikidō effektiv verteidigen kann, auch wenn diese Art zu Kämpfen meist sehr harmonisch, wenn nicht gar tänzerisch und choreografiert wirkt.
Ziel des Aikidō ist es, die Kraft des gegnerischen Angriffs abzuleiten und dieselbe Kraft intelligent zu nutzen, um den Aggressor vorübergehend angriffsunfähig zu machen, ohne ihn schwer zu verletzen. Ermöglicht wird dies durch Haltetechniken (katame waza oder osae waza) und Wurftechniken (nage waza), die den Hauptteil der Aikidō-Techniken ausmachen.
Es gibt beim Aikidō keine offensiven Angriffstechniken, sondern nur Abwehr- und Sicherungstechniken. Dadurch entwickelt sich eine defensive und verantwortungsbewusste geistige Haltung.
Ein häufig genannter Satz ist folgender: „Die flexible Trauerweide kann einen Sturm durch Biegen widerstehen, während die viel stabilere Eiche brechen wird, wenn der Wind zu stark ist“.
Foto „DJK-Ebnath“
Foto „Aikido-Schule Takeshin“
Aikidō-Techniken beruhen auf physikalischen Prinzipien. Zu nennen sind hier beispielsweise Hebel, Achsen oder Kinetik. Je weiter der Schüler mit dem Training fortschreitet, desto weiter tritt die reine physikalische Kraft in den Hintergrund. Diese wird durch „das Zentriertsein“, der Genauigkeit und der Beweglichkeit ersetzt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kampfkünsten, wird die Angriffsenergie des Gegners nicht geblockt, sondern so umgelenkt, dass der Verteidiger daraus einen Vorteil erlangt. Erreicht wird dies durch zwei Prinzipien:
irimi
: Dies ist das Prinzip des „in den Angriff Eintretens und mit ihm Harmonisierens“ und
tenkan
: Bei diesem Prinzip wird der Angriff mit einer Drehbewegung vorbeigelassen und dabei mit ihm harmonisiert.
Das Aikidō lehrt, dass der Fluss des Kokyū oder des Ki des Trainierenden, den Gegner bewegt oder zu Fall bringt.
Zentrale Kraft im Aikidō ist das Kokyū. Diese Atemkraft ist der Muskelkraft des körperlich stärkeren Gegners überlegen. Genauer ist Kokyū der Atem, Kokyū dōsa die Atemkraftbewegung aus dem Seiza und Kokyū hō ist eine Übung zur Entwicklung der Atemkraft. Das Kokyū und das Ki gehören zusammen. Wenn die Atemkraft richtig geübt wird, beeinflusst dies auch den Fluss des Ki positiv.
Foto „Aikido-Schule Takeshin“
Foto „DJK-Ebnath“
Wettkämpfe sind im Aikidō nicht vorgesehen und wurden auch von Morihei Ueshiba nicht geduldet. Graduierungen werden durch Vorführung diverser Techniken erreicht, ohne dass die Partner dabei als Gegner gegeneinander kämpfen. Während in einigen Kampfkünsten oder Kampfsportarten nur im Zusammenhang mit Jō oder Bokken von Kata gesprochen wird, sind in den meisten Aikidō-Stilen Kata mit Partnern (Kata-Geiko) die zentrale Übungsform. Zum größten Teil bestehen die Übungseinheiten für den Trainierenden (Aikidōka), aus Kata-Geiko. Hierbei sind die Rollen von Angreifer und Verteidiger bereits im Vorfeld festgelegt. Auch der Angriff und die Verteidigung werden meist schon vorgegeben. Erst ein fortgeschrittener Schüler beginnt sich langsam von der Form zu lösen. So sind der Angriff und die Verteidigung nicht mehr streng geregelt. Wiederum später wird die Rollenaufteilung von Angreifer und Verteidiger gänzlich überwunden.
Der Trainierende versucht die Bewegungen frei werden zu lassen und nicht mehr über jeden einzelnen Schritt nachzudenken. Die Bewegungsabläufe sollen dann vom Unterbewusstsein ausgeführt werden. Das Training findet größtenteils ohne Waffen, bzw. Übungswaffen, statt. Die drei Waffen Jō, Tantō und Bokken spielen dennoch eine wichtige Rolle. Diese werden verwendet, da viele Bewegungen und Techniken des Aikidō von Waffentechniken, wie z.B. Stock- oder Schwerttechniken, abgeleitet sind und dadurch waffenlose Bewegungsabläufe besser verstanden werden können. Ja nach Stilrichtung des Aikidō variiert jedoch die Bedeutung des Waffentrainings.
Foto „Aikido-Schule Takeshin“
Die Angriffe bestehen überwiegend aus Schlägen, Würge- oder Haltegriffen. Jede Technik wird zumeist in drei Teile gegliedert:
dem Aufnehmen oder Vorbeigleiten der Angriffsenergie (
Tai no henkō
),
der Weiterführung der Energie bis hin zum Verlust des Gleichgewichtes des Angreifers und
der Abschlusstechnik. Diese kann aus einem Wurf oder einer Haltetechnik bestehen.
Im Dōjō üben meistens zwei Partner miteinander, bei denen regelmäßig die Rolle des Angreifers (Uke) und Angegriffenen (Nage oder Tori) gewechselt wird. Dieser Wechsel findet in der Regel nach zwei bis vier Technikwiederholungen statt. Übungen, bei denen die Technik frei gewählt werden kann, haben den Namen Jiyuwaza.
Foto „Aikido-Schule Takeshin“
Foto „DJK-Ebnath“
Eigentlich ist Aikidō eine friedfertige Kampfkunst. In der Regel soll der Angreifer nicht verletzt, sondern nur in eine Situation geführt werden, in der er sich beruhigen kann. Dem Aggressor wird so die Chance gegeben, einsichtig zu werden und von einem weiteren Angriff abzusehen.
Trotzdem verfügt ein Aikidōka über verschiedene Möglichkeiten, einen Angreifer erheblichen Schaden zuzufügen oder ihn sogar zu töten. Hierzu zwei Philosophien Ueshibas:
„Wenn Du angegriffen wirst, schließe Deinen Gegner ins Herz“ oder
„Wahres
Budō
dient jedoch nicht einfach dazu, den Gegner zu zerstören; es ist viel besser einen Angreifer geistig zu besiegen, so dass er seinen Angriff gerne aufgibt“.
Beim Üben wird als Kleidung, die von Jigorō Kanō (Begründer des Jūdō) Ende des 19. Jahrhunderts eingeführte, Keiko-Gi getragen. Heutige Aikidōka tragen oft erst ab dem 1. Dan den Hakama. Früher trug jeder diese Art von Hosenrock. Diese Änderung stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, da während dieser Zeit für viele Schüler Ueshibas die Stoffe einfach zu teuer waren. Deshalb bat Ueshiba um die Erlaubnis, ohne einen Hakama trainieren zu dürfen. Aus diesem Grund wird heute in vielen Dōjō ohne Hakama trainiert. Die Farbe dessen war früher unerheblich. Heute werden zumeist dunkelblaue oder schwarze Hakama getragen.
Foto „DJK-Ebnath“
Foto „DJK-Ebnath“
Morihei Ueshiba, der von den Aikidō-Anhängern auch O-Sensei (jp. Altehrwürdiger Lehrer oder Großer Lehrer) genannt wird. Er war ein Experte im Jiu-Jitsu, in anderen Kampfkünsten und in der Handhabung mit dem Bō/Jō (dt. Stab/Stock), Katana (dt. Schwert) und Speer.
Morihei Ueshiba begann bereits als Jugendlicher, Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem Studium einzelner Budō-Disziplinen. Nachweislich studierte er Anfang des 20. Jahrhunderts das Tenjin Shinyo ryū Jūjutsu, Goto-ha Yagyu Shingan ryū Jūjutsu (kurz Judō) und ab 1915 Daitō-ryū Aiki-Jūjutsu bei Sokaku Takeda. 1919 lernte er die neoshintoistsche Bewegung Ōmoto-kyo kennen. Deren Lehren beeinflusste seine Budō-Interpretation entscheidend. Diese trug im Wesentlichen zur Entstehung des Aikidō mit bei.
Im Alter von 55 Jahren galt der nur 1,55 m große Morihei Ueshiba in den einschlägigen japanischen Kampfkunstkreisen als unbesiegbar. So wird berichtet, dass der damals berühmteste japanische Ringer in Ueshibas Dōjō kam und ihn bat, seine Kunst zu demonstrieren. Ueshiba sagte zu und forderte den Ringer anschließend auf, ihn hochzuheben, was dem Ringer nicht gelang. Auf die Frage nach dem Trick, antwortete Ueshiba: „Ich bin in Einheit mit dem Universum. Wer kann das bewegen?“
Ueshiba entwickelte bis zu seinem Tode das Aikidō weiter. Dabei wurde seine Kunst immer weicher und harmonischer. Nach seinem Tode interpretierten ehemalige Schüler von ihm das Aikidō unterschiedlich.
Daher gibt es heute viele verschiedene Stilrichtungen dieser Kampfkunst. Bekannte Stile sind:
Stil / Organisation
Begründer
Aikikai
Morihei Ueshiba
Aikido Yuishinkai
Koretoshi Maruyama
Aiki-Osaka
Hirokazu Kobayashi
Dynamic Aikido Nocquet
John Emmerson
Iwama ryū
Morihiro Saito
Iwama Shinshin Aiki
Hitohiro Saito
Kōrindō
Hirai Minoru
Shin-Shin-Tōitsu-Aikidō
Kōichi Tōhei
Shinei Taido
Noriaki Inoue
Shodokan
Kenji Tomiki
Tendoryu
Kenji Shimizu
Yoseikan
Minoru Mochizuki
Yoshinkan
Gozo Shioda
Die zentrale Stadt für das Aikidō ist das japanische Tokyo. Hier steht das Honbu Dōjō (dt. Haupt-Übungshalle). Im Jahr 1951 stellte Meister Mochizuki Minoru das Aikidō in Frankreich vor und begann bereits ein Jahr später mit der Verbreitung in Europa. 1965 wurde dieses Kampfsystem in Australien vor-gestellt. Heute gibt es fast in allen Ländern der Welt Aikidō-Dōjō. Die 1975 gegründete „Internationale Aikidō-Föderation (I.A.F.)“ umfasst sechs kontinentale und mehr als 40 nationale Aikidō-Verbände. Zusätzlich gibt es noch viele weitere Verbände und Dōjō innerhalb und außerhalb des Aikikai.
Aiki-Jojutsu
Das Aiki-Jojutsu, das auch kurz nur Aiki-Jo genannt wird, stammt aus Japan. Es handelt sich um eine Stilrichtung des Jojutsu, aufbauend auf Aikidō-Prinzipien. Entwickelt wurde dieser Stil im 20. Jahrhundert.
Aikijutsu
Das Aikijutsu (dt. die Kunst der Harmonisierung der Energien) ist, ähnlich wie das Aikido, eine moderne Form des traditionellen aus Japan stammenden Daitō-ryū Aikijujutsu/Aikibudo, dass von Sokaku Takeda im 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Ein langjähriger Schüler Takedas war beispielsweise Morihei Ueshiba, der Begründer des Aikidō. Die Aiki-Künste verstehen sich selbst mehr als Kunst zur Selbstverteidigung als Kunst des Kämpfens. Das hervorstechendste und wichtigste Merkmal des Aikijutsu ist die Kontrolle über den Angreifer. Sobald der Aikijutsuka (Verteidiger) Kontakt mit dem Aggressor bekommt, wird das Gleichgewicht des Angreifers derart massiv gebrochen, dass eine Gegenmaßnahme durch ihn unmöglich wird. Das Trainingsprogramm besteht aus Hebeln, Immobilisierungen, Nervengriffen, Schlägen, Stößen, Transportgriffen, Tritten, Waffentechniken (mit Dolch, Kurz-/Langschwert und langen Stöcken), Würfen, Würgegriffen, sowie die Verteidigung gegen multiple Angreifer. Die bekanntesten Vertreter des Aikijutsu in Europa sind das Daisei Ryu Aikijutsu und das Yamaue Ryu Aikijutsu.
Aiki-Osaka
Das Aiki-Osaka ist eine Kampfkunst aus Japan und beruht auf den Prinzipien von Morihei Ueshiba, dem Gründer des Aikidō, die er in seinen letzten Lebensjahren entwickelte.
Die Unterschiede zu klassischen Aikidō-Schulen sind:
Atemi
:
Es werden zur Verteidigung im Aiki-Osaka mehr Schläge als in anderen
Aikidō
-Stilen eingesetzt. Durch die folgende Reaktion des Gegners und dessen nun verringerte Stabilität, können Techniken besser eingesetzt werden
Haltung:
Im Gegensatz zu den klassischen
Aikidō
-Systemen, gibt es keine langen oder tiefen Stände, sondern eine stetige aufrechte Körperhaltung. Anstatt von Körperdrehungen existieren viele lineare Schritte. Auch wird das hintere Bein immer beigezogen, damit eine ständige Mobilität erreicht wird.
Meguri
:
Die
Meguri
sind kleine Drehungen der Handgelenke/Arme. Hierdurch kann der Körper gradliniger und sparsamer bewegt werden. Das
Meguri
-Prinzip ersetzte die Idee der Schwerthand.
Waffen:
Es werden hier keine Angriffe geblockt, es gibt keine Kampfhaltung und der Gegner wird nicht mit den Augen fixiert. Es wird ausschließlich mit Holzwaffen trainiert.
Stilgründer war Hirokazu Kobayashi, der das Aiki-Osaka im 20. Jahrhundert entwickelte. Da er in der Nähe von Osaka lebte, fand deren Name Einzug in die Stilbezeichnung. Seine Schule hat den Namen Bu Iku Kai, was ins Deutsche übersetzt heißt Haus der Ritterlichkeitserziehung.
In Europa existiert für das Aiki-Osaka kein Dachverband.
Aikuchi
Ein Aikuchi ist kurzes Tantō (Kampfmesser), das von den Samurai des 15. Jahrhunderts getragen wurde. Im Nahkampf diente es dazu, dem Gegner den letzten Stoß zu versetzen. Die leicht gebogene Klinge wurde einseitig geschliffen und erreichte eine Länge von bis zu 1 Shaku (= 30,3 cm).
Ajukate
Der Gründer Horst Weiland entwickelte das Ajukate im 20. Jahrhundert, dass in der „Budo Akademie Europa (BAE)“ organisiert ist.
Allkampf
In diesem Selbstverteidigungssystem wurden die effektivsten Abwehrtechniken zu einer Kampfsportart zusammengefasst. Hierdurch entstand ein Kampfsportsystem, das sich durch große Vielseitigkeit und Realitätsnähe auszeichnet.
Anfänger können schnell erste Erfolge erzielen, da die Techniken auf das Wesentliche reduziert wurden und daher leicht erlernbar sind. Das Training wird durch speziell im Allkampf geschulte Trainer geleitet. Allkampf trainiert den ganzen Körper: Muskelaufbau, Dehnung, Schnellkraft und Koordination.
Auch das brasilianische Vale Tudo und die an Popularität zunehmenden Mixed Martial Arts (MMA) und Freefights beleben die Tradition des stilfreien Allkampfes neu.
Gemischte Kampfkünste oder kurz MMA (Mixed Martial Arts; Deutsch vermischte Kampfkünste) ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfsporten oder auch Kampfkünsten, die von einem Kämpfer kombiniert werden. MMA ist ein hybrider Kontaktwettkampfsport.
Die Bezeichnung MMA wird zumeist im englischen Sprachraum verwendet, in Deutschland, Frankreich und Osteuropa sind auch die Bezeichnungen Free Fight oder Mixed Fight verbreitet. Alle diese Begriffe beschreiben denselben Kampfsport.
Bei diesem in Deutschland noch sehr jungen Sport werden alle Kampfdistanzen, das Treten, Schlagen, Clinchen, Werfen und der Bodenkampf in einem Vollkontaktsport mit möglichst wenig Beschränkungen durch Regeln vereint. Die Disziplin ist dem Straßenkampf sehr ähnlich. Ziel des MMA ist es, den Gegner in einem Kampf zu besiegen, bis er durch Abklopfen aufgibt, K.O. geht oder der Schiedsrichter den Kampf abbricht. Das Training ist sehr umfangreich und fordert vom Trainierenden ein hohes Engagement. Die Wettkämpfe sind gestaffelt vom „Newcomer“ (Anfänger) bis hin zu Kämpfen im Rahmen von Galas. Aufgrund der umfangreichen Anforderungen an den Sportler ist eine hohe Trainingsmotivation und -teilnahme Voraussetzung für die Teilnahme am Free Fight.
Anders als beispielsweise viele Kung Fu- oder Karate- Richtungen beinhalten die Mixed Martial Arts keine Formen oder Techniken, die nicht in einem Kampf einsetzbar sind.
Das Neueste wird von einem Kämpfer selbst definiert. Während jedoch das Jeet Kune Do ein Selbstverteidigungssystem ist, ist MMA primär ein – wenn auch sehr rabiater – Sport. Es zeigt sich, dass insbesondere Thai-Box-Techniken im Stand, sowie das japanische Jiu-Jitsu im Boden und Griffkampf dominieren, neben Techniken aus dem Boxen, Jūdō, Ringen und Sambo. Charakteristisch ist, dass der Kampf sich sowohl im Stehen als auch auf dem Boden abspielt.
Die modernen MMA-Kämpfe ähneln dem antiken Pankration-Kampf. Wie bei der Pankration ist auch beim traditionellen Vale Tudo die einzige Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen, den Gegner durch Hebel- oder Würgetechniken zur Aufgabe zu zwingen oder ihn per K.O. kampfunfähig zu machen. Zusätzlich fließen noch Übungsinhalte zur Selbstverteidigung gegen bewaffnete und unbewaffnete Angreifer ein. Die sportliche Kampf und die Selbstverteidigung vermischen sich – sie werden Eins. Es werden die Stärken des Allkämpfers ermittelt und systematisch ausgebaut. Weiterhin lernt er mit stressigen Situationen umzugehen und sich auch in Konfliktsituationen flexibel zu verhalten. Der Allkämpfer geht seinen Weg – der Trainer ist sein Wegbegleiter.
All Out Street Combat
Das deutsche Selbstverteidigungssystem des All Out Street Combat ist eine Symbiose aus den Kampfstilen Jūdō, Jun Fan Gung Fu, Kickboxen, Krav Maga, Muay Thai, Ninjutsu und diversen Nahkampfmethoden. Es beruht auf den natürlichen menschlichen Reflexen.
Stilgründer war Denis Basara (Northeim) im Jahr 2004. Zwei Jahre später erkannte die „International Close Combat Association“ das All Out Street Combat als eigenständiges Nahkampfsystem an.
All-Style-Do Karate
Das All-Style-Do Karate, dass auch ASD-Karate genannt wird, ist ein deutscher Karatestil. Stilgründer war Horst Weiland. Im Jahr 1980 wurde das ASD-Karate als eigenständige Disziplin in die „Budo Akademie Europa (BAE)“ aufgenommen. Das ASD-Karate beinhaltet die effektivsten Techniken aus anderen Karate-Systemen (daher die Namensgebung). Zum Training gehören Fall-schule, Formenlauf, Gelenkhebel, Haltetechniken, Karate-Grundschule, Kihon, Selbstverteidigung und Würfe. Durch das All-Style-Do Karate werden besonders die Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn, Kondition und Koordination gefördert.
Allstyle-Jitsu
Der interessante Aspekt von Allstyle-Jitsu, abgekürzt AJ, liegt bestimmt in seiner Vielseitigkeit in der Anwendung der Techniken. So wird unterteilt in die jeweiligen Disziplinen „Formen“, „Selbstverteidigung gegen einer oder mehrere Angreifer“ und „Bruchtest“.
Es ist ein modernes, der heutigen Zeit angepasstes Selbstverteidigungs-System das sich aus verschiedenen Kampfkunststilen zusammenfügt. Hauptsächlich sind dies Elemente aus Jūdō, Aikidō, Jiu-Jitsu und Taekwondo. Bei dieser Art der waffenlosen Selbstverteidigung wurden viele Techniken „vereinfacht“ um aus einer Situation schnell zu reagieren und somit einen Angriff wirkungsvoll und erfolgreich abwehren zu können.
Aus dem Kobudō sind Bō, Nunchaku und Tonfa im Programm, ideal für Security oder Polizeieinheiten. Bei der Entwicklung wurde an ein System gedacht das für alle, groß oder klein, sportlich oder unsportlich und für jedes Alter geeignet ist, für Kinder, Frauen und Männer. Durch seine Kompromisslosigkeit wird ein schnellerer Lernerfolg erzielt als bei herkömmlichen Kampfsportarten. Der Schüler hat von der ersten Trainingsstunde schon ein Erfolgserlebnis. Man entwickelt schon bald Selbstvertrauen und Gelassenheit.
Durch die spezielle Gymnastik gewinnt der Körper an Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Geschmeidigkeit und Schnelligkeit. Der Geist Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und Selbstbeherrschung.
Formen
Einfach ausgedrückt, ein Kampf gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner. Diese greifen immer in der Einbildung, innerhalb einer genauen festgelegten Weise an und müssen vom Meister oder Schüler mit vorgeschriebenen Techniken bekämpft werden. Die Schönheit einer Form liegt im gleichzeitigen Zutage treten von Kampfgeist, Geschmeidigkeit, Dynamik und Rhythmuswechsel. Somit verkörpert die Form Ästhetik und gleichzeitig Härte und Nutzanwendung für den realen Kampf. Dabei kann der Kämpfer seine Technik voll anwenden, das heißt, jedes Abstoppen des Schlages oder Kicks entfällt. Für den Vortragenden entsteht sich eine reale Situation. Die einzelne Form steigert sich im Schwierigkeitsgrad mit der Graduierung des Sportlers. Sie ist eine der anspruchsvollsten Disziplinen im Allstyle-Jitsu und nimmt wie in den meisten traditionellen Kampfkunststilen einen hohen Stellenwert ein.
Selbstverteidigung
In der Selbstverteidigung zeigt der Schüler erlernte Techniken in der Anwendung von Schlag, Hebel, Wurf und Festlegetechniken an einem Gegner, der (simuliert mit und ohne Waffen) verschiedenartig angreift, dann abgewehrt oder unter Kontrolle gebracht werden muss.
Freikampf
Im Freikampf greifen einer oder mehrere Gegner den Prüfling an und schaffen somit eine reale Situation, bei der insbesondere Konzentration, Reaktion, Sicherheit und Schnelligkeit geschult werden. Bei Meisterschaften verteidigt sich ein Sportler gegen zwei Angreifer. Dieser Kampf ist von drei Sportlern einstudiert, erfordert aber von diesen Höchstmaß an Konzentration und Ausdauer. Ein Kampf hat eine Mindestdauer von einer Minute.
Bruchtest
Beim Bruchtest zeigt der fortgeschrittene AJ-Schüler, ob er die geforderte Technik beherrscht. Größtmögliche Konzentration auf einen Punkt, ein Höchstmaß an Schnelligkeit in der Bewegung, Einsatz des ganzen Körpergewichts und angewandte Atemtechnik sind erforderlich um ein Brett, Ziegelstein oder ähnliche Materialien zu überwinden. In der Regel werden bei Prüfungen und Meisterschaften Fichtenbretter von 30 mal 30 cm verwendet. Je nach Alter und körperlicher Verfassung des Prüflings oder Wettkämpfer unter-scheiden sich die Bretterstärken von 1-3 cm, die je nach den erforderlichen Techniken mit Händen oder Füßen zerbrochen werden.
Das Allstyle-Jitsu wurde von Siegfried Benkel entwickelt, der seit 1972 verschiedene Kampfsport-arten betreibt und darin auch jeweils den Titel eines Großmeisters trägt (ab 5. Dan). Er ist gleich-zeitig Repräsentant und Direktor in Europa für die „Zanshin Martial Arts Association“ England. In Zusammenarbeit mit mehreren anderen internationalen Budo-Organisationen und deren namhaften Großmeister verschiedenster Stilrichtungen wird dem Allstyle-Jitsu -Schüler ein unendliches Spektrum in der Selbstverteidigung garantiert. Für die Ausbildung sind weder Kampfsporterfahrung oder körperliche Voraussetzungen nötig. Jedoch Willenskraft, Ausdauer und guten Charakter wird als selbstverständlich angesehen.
Allstyle Jutsu
Allstyle Jutsu ist ein moderner Selbstverteidigungsstil, der ursprünglich auf die Anwendung durch Frauen und Kinder zugeschnitten war und daher auch von körperlich eher schwachen Personen optimal genutzt werden kann.
Nichts desto trotz handelt es sich um eine moderne und wirkungsvolle Kampfsportart, die auf die jahrhundertealten Wurzeln eines japanischen Kampfstils zurückgreift. Die Kombination traditioneller Katas und moderner Techniken ist auch für erfahrene Kampfsportler und alle Personen im Sicherheitsbereich von Interesse.
Beim Allstyle Jutsu werden Hebeltechniken in Kombination mit Drucktechniken auf Atemi- und Nervenpunkte verwendet. Außerdem wird das Gleichgewicht des Gegners gebrochen. Dadurch ist Allstyle Jutsu optimal zur Selbstverteidigung geeignet: der Angreifer wird kaum verletzt, kann aber überaus wirkungsvoll an seinem Angriff gehindert und überwältigt werden.
Die Anwendung von Messer, Schwert, Schirm, Fächer und anderen Waffen und Gegenständen ist ebenfalls möglich.
Allstyle Jutsu ist eine Kampfsportart mit Prüfungsmöglichkeiten für Kyu- und Dan-Grade und einer Trainerausbildung.
Allstyle Karate
Allstyle Karate ist eine Zusammenstellung von vier verschiedenen Kampfsportarten. Es beinhaltet die effektivsten Techniken aus Karate, Kung-Fu, Jiu-Jutsu und Tae-Kwon-Do. Allstyle Karate ist eine Mischung aus traditionellen und modernen Techniken. Die traditionellen Techniken sind sehr wichtig, da diese schon seit hunderten von Jahren überliefert wurden. Allerdings ist es auch wichtig, sich im Bereich der Selbstverteidigung stets weiterzubilden und eine Verteidigung nach dem heute geltenden, modernen Standards zu beherrschen.
Die Ausbildung erfolgt aber nicht nur in Techniken, Technikserien und Selbstverteidigung, sondern auch mit fest vorgeschriebenen und traditionellen Formen: der Kata.
Doch nicht nur für den Ernstfall bringt uns Allstyle Karate großen Nutzen: es ist ein optimaler Sport, um fit zu bleiben. Körper und Geist werden gestärkt, Muskeln, Kraft, Kondition, Gleichgewicht und Gelenkigkeit werden trainiert und es stellen sich schnelle Anfangserfolge ein.
Nach einer gewissen Zeit des Trainings kann man feststellen, dass auch auf mentaler Ebene eine Veränderung stattfindet: der Geist wird ruhiger, die Konzentration verbessert sich, man gewinnt an Selbstvertrauen und wird ausgeglichener. Und das Wichtigste, Zufriedenheit und Gelassenheit stellen sich ein. Gerade in der heutigen Zeit für Erwachsene, aber auch für Kinder ein nicht alltäglicher Zustand.
Das übliche Training beginnt immer mit Gymnastik, wobei auf jeden Schüler individuell eingegangen wird. Hierbei werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Kondition, Dehnung, Beweglichkeit und Gleichgewichtssinn sollen geschult werden. Die Muskulatur muss für die folgenden Übungen aufgewärmt sein.
Nach der Gymnastik beginnt das Training mit der sogenannten „Grundschule": es werden traditionelle, aber auch moderne Techniken immer und immer wieder geübt und wiederholt. Dies dient zur Perfektionierung der Techniken, aber auch zur „Automatisierung", um im Ernstfall reflexartig und ohne zeitraubendes und damit gefährliches Überlegen reagieren zu können. Eine endgültige Perfektionierung der Technik kann man wohl niemals erreichen, und selbst für die höchsten Danträger ist die Grundschule ein essentieller Bestandteil des Trainings.
Anschließend, nach der Grundschule, wechselt das Training von Woche zu Woche mit Selbstverteidigung und einer Waffenkampfsportform. Hier werden alle Aspekte der modernen Selbstverteidigung geübt bzw. das Beherrschen der traditionellen Kampfsportwaffen erlernt.
Das Training endet immer mit einer Kata ob als Karate-Kata oder mit Waffe. Der Geist wird wieder beruhigt und Konzentration aufgebaut.
Es werden folgende Gürtelprüfungen angeboten: gelb, orange, grün, blau, braun und schwarz (1.Dan). Ab dem Grüngurt ist es möglich, eine Laufbahn als Übungsleiter bei den Erwachsenen oder den Kindern einzuschlagen, um selbst irgendwann als Trainer eine Gruppe trainieren zu können.
Alpha Combat System
Das Alpha Combat System, oder auch kurz ALPHA genannt, ist ein effizientes Nahkampf- und Selbstverteidigungssystemen.
Anfangs vom Nahkampfexperten Paul Soos entwickelt, um beim Militär die Nahkampfausbildung zu optimieren und dadurch die Effektivität der Einheiten im Einsatz zu steigern, wird es heute auch bei der Polizei, Justizvollzug und zivilen Sicherheitsdienstleistern geschult. Seit 2005 wird es sogar Zivilisten zugänglich gemacht, wo es sich nicht zuletzt wegen der Einfachheit und der herausragenden Effektivität wachsender Beliebtheit erfreut.
Zivil: Die Gewaltbereitschaft und insbesondere auch „Qualität“ der Gewalt innerhalb der Gesellschaft nimmt stetig zu. Und genau dafür ist ALPHA eine optimale Lösung, denn es ist nicht nur hocheffektiv und bereitet auf die unterschiedlichsten Bedrohungssituationen vor, sondern ist vor allem auch in kürzester Zeit erlernbar. Die Techniken sind schnell, hart und direkt, ohne Schnörkel und Spielereien. Beim ALPHA zählen allein die Anwendbarkeit (auch unter Stress) und die Effektivität… schlussendlich also das Ergebnis. ALPHA ist für jeden geeignet! Und dies macht es besonders Wertvoll für alle Personengruppen, die mit möglichst kurzem Zeitaufwand verteidigungsfähig werden wollen.
ALPHA ist auch innerhalb der Ausbildungsstruktur besonders. So wird der Schüler durch speziell entwickelte Drills, Szenariotrainings sowie durch spezielle Schulung der mentalen Seite schnellstmöglich an sein Ziel geführt… den Ernstfall meistern zu können!
American Karate System
Das American Karate System, dass auch AKS abgekürzt wird, ist ein US-amerikanischer Karatestil, der aus Elementen des Aikidō, Hapkido, Jūdō, Jujutsu, Karate, Kobudō, Kung-Fu, Taekwondo, sowie aus eigenen Techniken und die des Polizeidienstes und militärischen Nahkampfes besteht. Es gibt innerhalb des AKS Einflüsse bevorzugter Kampfstile. Während das deutsche AKS Techniken berücksichtigt, die an das Wādō-Ryū angelehnt sind, werden in Amerika Techniken bevorzugt, die an das Shōtōkan Karate und Teakwondo angelehnt sind. In beiden Richtungen kommen aber wesentlich mehr Techniken vor, als in den genannten Ursprungsformen.
Die Trainingsinhalte des deutschen AKS sind: Grundtechniken (Kihon), Kombinationen (Renraku-Waza), Wurftechniken (Nage-Waza), Techniken des Ausweichens mit dem gesamten Körper (Tai Sabaki), Traditionelle Kumiteformen, Fallschulkata, Waffenkatas (Bō, Bokken, Hanbō, Sai und Tonfa) Formen (Kata). Für letztere existieren sogenannte „Altersformen“, die dem Alter oder der evtl. gesundheitlichen Beeinträchtigung angepasst werden. Daneben gibt es noch Schülerkatas, die in Richtung und Ausführung den Heian- und Pinan-Kata nahekommen. Sie werden Kata Shodan bis Godan genannt. Den Abschluss bilden die Meisterkata, die Eigenkreationen hoher Dan-Träger sind und Neko Shodan bis Godan genannt werden. Der essentielle Bestandteil des AKS ist jedoch die Selbstverteidigung, die aus Bodentechniken, Handgelenksfassen, Reversfassen, Schlägen, Tritten, Umklammerungen, Waffentechniken und Würgetechniken besteht.
Stilgründer war in den 1960er Jahren Ernest Lieb. Damals hieß der Stil allerdings noch „American Ji-Do-Kwan System“. Erst im Jahr 1973 wurde es in den heute noch gültigen Namen umbenannt. 1980 wurde das AKS in Deutschland eingeführt, 1997 wurde es in den „Karate Verband Niedersachsen (KVN)“ und später in den „Deutschen Karate Verband (DKV)“ übernommen.
Anderthalbhänder
Der sogenannte Anderthalbhänder (in Frankreich auch als Bastardschwert bezeichnet) zählt zu den spätmittelalterlichen europäischen Langschwertern. Die historisch korrekte Bezeichnung lautet das lange Schwert. Es handelt sich bei Anderthalbhändern um eine Weiterentwicklung der damaligen Einhandschwerter. Kennzeichnend war die bis zu 30 cm lange Grifflänge und die bis zu 100 cm erreichende Klingenlänge. In der Regel wurde mit dieser Waffe zweihändig gekämpft. Lediglich einzelne Techniken wurden mit einer Hand durchgeführt. Es gab aber auch einige Techniken, bei der das Schwert mit einer Hand am Griff und mit der Anderen an der Klinge geführt wurde. Diese Techniken wurden Halbschwert-Techniken genannt.
Durch den Einsatz von Langbögen oder der massive Einsatz von Fußkämpfern musste die bisherige Kriegstaktik und Waffentechnik umgestellt werden. So wurde ein Schutzschild immer kleiner, die Rüstungen dagegen zunehmend mit Platten verstärkt (Plattenpanzer). Hierdurch wurden die bisher eingesetzten Schwerter aber auch wirkungsärmer. Durch den massiven Schutz der Plattenpanzer wurden Schilde überflüssig. Somit stand die zweite Hand zum Führen eines Schwertes unterstützend bereit. Dieser Umstand führte zur Entwicklung des großen Anderthalbhänders, in dessen Zuge auch der Anspruch zur Verbesserung der Fechtkunst stand.
Anti-Terror-Kampf
Das Anti-Terror-Kampf-System, dass auch ATK abgekürzt wird, stellt ein eigenständiges direktes Selbstverteidigungssystem dar. Es werden Techniken aus verschiedenen asiatischen Kampfkunstsystemen zu einem komplexen, schnellen und modernen Selbstverteidigungssystem zusammengefasst.
Als Basis dienen Tritte, Schläge, Reiß-, Wurf- und Schocktechniken, die in Angriff und Verteidigung zum Einsatz kommen. Besonderer Bedeutung kommt im Anti-Terror-Kampf die Anwendung der „Kralle“ zu. Sie ermöglicht Schläge mit dem Handrücken, kräftige Reiß- und Drucktechniken, Greifen/Fassen, Stiche, sowie Schläge mit der Handkante, Handballen und mit den Fingerknochen. Der Umgang mit verschiedensten Übungswaffen wird gelehrt, um auf alle Arten von Angriffen reagieren zu können. Alle Angriffe und Abwehren werden aus der Bewegung erarbeitet, es gibt keine statischen Abläufe. Ebenso wird die Fallschule sowohl passiv als auch aktiv trainiert, d.h. dass der Schüler sofort nach dem Fallen in der Lage ist, einen nachfolgenden Angriff abzuwehren.
Die theoretische Ausbildung umfasst rechtliche Aspekte, Kenntnisse verschiedener Kampfkunstsysteme, Erste Hilfe, Kuatsu und Grundlagen der Anatomie. Anti-Terror-Kampf ist für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet. Besonders für Frauen stellt es eine gute Alternative dar, denn die hohe Effektivität basiert auf einen Überraschungs- oder Schockeffekt mit gezielten Angriffen auf empfindliche Nervenpunkte, kombiniert mit Hebel- und Wurftechniken. Im Anti-Terror-Kampf gibt es keine Wettkämpfe, trotzdem ist das Kumite (Übungskampf) fester Bestandteil des Trainings.
Entwickelt wurde das System im Jahr 1963 von Horst Weiland. Heute wird es durch die „Budo Akademie Europa“ und mehrere Verbände vertreten und gelehrt. In den letzten Jahren gingen allerdings ehemalige Meister mit ihren Schülern in andere schon bestehende Verbände, oder traten sogar gänzlich aus der Verbandsstruktur aus. Den Anti-Terror-Kampf gibt es größtenteils in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz.
Arnis
Das Arnis, das auch Eskrima oder Kali genannt wird, ist eine philippinische Kampfkunst. Der Begriff stammt von dem spanischen Wort Arnes ab (zu Deutsch Harnisch). Die Bezeichnung kommt daher, dass die spanischen Besatzer in ihren Rüstungen zu ungelenk und schwer waren, um gegen die Maharlika zu bestehen. Erst durch den Einsatz von Schusswaffen gewannen die Spanier die Oberhand.
Die Kampfkunst des Arnis gehört zu einer Reihe von Künsten und Traditionen der damaligen südostasiatischen Kriegerkaste der Maharlika. Das Hauptaugenmerk des Arnis lag damals auf bewaffnete Auseinandersetzungen. Gelehrt wurde der Umgang mit Lang- und Kurzschwert und der Messer- und Speerkampf. Daneben gab es noch das Ringen, sowie Schlag- und Tritttechniken. Eine besondere Fähigkeit der Maharlika waren der gleichzeitige Umgang mit zwei Waffen des gleichen oder unterschiedlichen Typs.
Die Maharlika benutzten beim Training, anstelle von Schwertern, meist Rattanstöcke. So wurde das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten. Bevor die jungen Krieger aber echte Schwerter benutzen durften, mussten sie ihr Können mit schweren Stöcken aus Hartholz unter Beweis stellen. Diese simulierten das Gewicht, bzw. die Länge, eines echten Schwertes.
Im Arnis wird, wie bei den meisten südostasiatischen Kampfstilen, erst der verantwortungsvolle Umgang mit Waffen gelehrt und erst anschließend der unbewaffnete Kampf. Heute werden die Einzel- und Doppelstocktechniken meistens mit etwa 70 cm langen Stöcken aus Rattanholz trainiert. Auf den Philippinen ist es heute noch üblich, dass Schüler nach mehreren Trainings-jahren mit scharfen Klingen üben. Nur so können sie zu wahren Meistern werden.
Der Rattanstock wird in drei Bereiche eingeteilt:
• Unteres Drittel:
Hier wird der Stock festgehalten. Dabei sollte sich zwischen dem Stockende und der Hand eine Handbreit Platz gelassen werden. Dieser Teil wird
Butt
oder
Punyo
genannt und wird auf kurze Distanzen eingesetzt.
• Mittelteil:
Dieser Bereich des Stockes wird meist zum Blocken benutzt.
• Oberes Drittel:
Das obere Drittel dient dem Angriff. Im Idealfall soll die Spitze des Stockes den Gegner treffen, da dort die Aufschlagswucht und die Reichweite am größten sind.
Neben waffenlosen Anwendungen wird mit folgenden Waffen trainiert (auch in Kombination untereinander):
Alltagsgegenstände (z.B. Gürtel, Handtuch oder Kugelschreiber),
Klingenwaffen (z.B.
Bolo-Macheten
),
Messer,
Stock.
Graduierungen im Arnis wurden erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt. Dabei können die Graduierungen von Verband zu Verband unterschiedlich sein.
Im Jahr 1764 verbot die spanische Kolonialmacht offiziell die Ausübung des Arnis. Trotzdem wurde im Geheimen weiter geübt. Damit das Arnis in diesen Jahren nicht sofort auffiel, wurde sie mit der südostasiatischen Tradition der Folkloretänze verbunden. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Arnis nur innerhalb des eigenen Clans gelehrt. Im Jahre 1991 und 2005 wurde Arnis bei den Südostasienspielen als Disziplin ausgetragen.
B
Baduanjin
Die Baduanjin (dt. acht edle Übungen oder acht Brokatübungen) sind eine achtfache und leicht zu erlernende Qigong-Übungsreihe. Neben den Prinzipien der chinesischen Heilgymnastik finden Atem-, Geistes- und Qi-Kontrolle Anwendung. Heute wird das Baduanjin oft im Taijiquan geübt.
Bafaquan
Bafaquan ist eine Kampfkunst aus China. Stilgründer war Li de Mao während der Qing-Dynastie. Dieser verband Techniken folgender Stile miteinander:
Fanziquan
,
Paochui
,
Tantui
,
Tongbeiquan
und
Xingyiquan
.
Bagua Qigong
Das Bagua Qigong besteht aus Übungen (auch Kellnerübungen genannt) zur Entwicklung des Qi. Es ist in das Baguaquan integriert. Ziel ist das Erlernen der grundlegenden Geschmeidigkeit, die für die baguaquantypischen Dreh- und Wickeltechniken notwendig ist.
Das Bagua Qigong wird anfangs mit einem Pfahl in der Mitte eines Kreises geübt. Später wird dies auf diverse Spiral- und Kreisformen mit zwei oder mehr Pfählen ausgeweitet. Dadurch soll die Zentrierung unterstützt werden. Fortgeschrittene Schüler laufen zudem noch das Yin&Yang-Zeichen, ein Symbol des Taiji, ab. Hierbei wird das Ändern der Laufrichtung einstudiert.
Baguaquan
Das Baguaquan (dt. Boxen der acht Trigramme), dass auch Pakua ch’uan genannt wird, ist einer der größten chinesischen Boxstile daoistischer Prägung mit Verbindung zum Qigong. Es handelt sich hierbei im eine innere Kampfkunst, die von der philosophischen Betrachtungsweise her mit dem Xingyi verwandt ist. Der chinesische Begriff Bagua weist auf die Beziehung zu den acht Trigrammen des I-Ging (Yijing) hin. Obwohl die Prinzipien des Baguaquan bereits sehr alt sind, wurde es erst um das Jahr 1790 entwickelt. Im Gegensatz zum Taijiquan, sind Baguaquan-Bewegungen nicht ganz so weich, jedoch nicht so hart wie im Xingyiquan. Die Wirkungsweise ist kreisförmig und indirekt. Es gibt Techniken mit der offenen Hand, sehr schnelle Dreh- und Kreisbewegungen, bzw. Fußtechniken. Bei fortgeschrittenen Schülern kommen folgende Waffen hinzu: Halbmondschwert, Hellebarde, Messer, Nadel, Säbel, Schwert, Speer und Stock.
Bagua Taijigong
Das Bagua Taijigong ist ein Qigong-System und beruht auf Elementen des Baguaquan und Taijiquan.
Baguazhang
Der chinesische Kampfstil des Baguazhang, das auch Pa Kua Chang genannt wird, zählt zu den sogenannten „inneren Kampfkünsten“. Die Stilbezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:
•
Ba
:
Bedeutet die Zahl Acht.
•
Gua
:
Hierbei handelt es sich um ein Orakelzeichen. In diesem Fall, um ein Trigramm aus dem
I Ging
. Dieses besteht aus drei durchgezogenen oder durchbrochenen Linien. Alle Kombinationen ergeben acht mögliche Trigramme, das sogenannte
Ba Gua
. Dieses hat auch im
Feng Shui
eine große Bedeutung.
•
Zhang
:
Übersetzt bedeutet der Begriff:
Handfläche
.
Im Baguazhang spielt die Zahl „Acht“ eine sehr wichtige Rolle:
Im
Baguazhang
wird im Kreis gelaufen. Ein vollständiger Kreis soll in acht Schritten durchlaufen werden.
Die acht Schritte beziehen sich auch auf die acht Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Westen, Osten, Nordwesten, Nordosten, Südwesten und Südosten.
Ebenso bezieht sich die Acht auf die acht generellen Richtungen des Lebens: Erfolg, Familie, Ruhm, Arbeit, Gesundheit, Zukunft, Wissen und Beziehungen.
Die beiden auffälligsten Eigenschaften dieses Stils sind das Laufen im Kreis und die spiralförmigen Körperbewegungen. Bei den meisten chinesischen Kampfstilen wird mit Fauststößen und anderen Fausttechniken gekämpft. Anders im Baguazhang: Hier werden die Techniken mit der offenen Hand ausgeführt. Die grundlegenden Bewegungen umfassen acht kleine Basistechniken, die jeweils spiegelverkehrt in die beiden Richtungen des Kreises ausgeführt werden. Daraus lassen sich dann Hunderte von höchst effektiven Anwendungen ableiten.
Die Ursprünge dieses Stils sind heute im Dunkel der Geschichte versunken. Er soll aber auf die Traditionen der daoistischen Klöster in den Wudang-Bergen zurückgehen. Baguazhang soll sich aus einer im Kreis gehenden Meditation entwickelt haben. Heute wird in den Wudang-Bergen immer noch Baguazhang praktiziert. Gesichert ist die Existenz des Baguazhang und die Verwendung des Namens erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts (von Dong Hai Chuan, Peking). Durch die sehr vielen zersplitterten Traditionslinien existiert eine Vielzahl von Stilen des Baguazhang. Diese unterscheiden sich zum Teil jedoch nur geringfügig. Die Bekanntesten davon sind das Cheng-Stil-Bagua (nach Cheng Ting Hua) und das Yin-Stil-Bagua (nach Yin Fu). Beides waren direkte Schüler von Dong Hai Chuan.
Das wesentlich bekanntere Baguazhang ist das Cheng-Stil-Bagua. Diesem ähneln auch die meisten anderen Bagua-Stile. Das Cheng-Stil-Bagua zeichnet sich durch besonders weiche, flüssige spiralförmige Bewegungen aus. Dadurch ist es optisch sehr ansprechend. Unbekannter dagegen ist der Yin-Stil-Bagua. Dieser zeichnet sich in großem Maße durch kraftvolle und explosive Bewegungen aus. Er orientiert sich mehr an der kämpferischen Anwendung der Bewegung, als am ästhetischen Eindruck. Trainierende werden in China erst sehr spät und erst nachdem sie Taijiquan und Xingyiquan beherrschen, im Baguazhang unterrichtet.
Baihe Qigong
Das chinesische Baihe Qigong (dt. Qigong des weißen Kranichs) ist eng mit dem Baihequan verbunden und in einer Vielzahl von einzelnen Stilrichtungen unterteilt. Die beiden wichtigsten Richtungen sind das weiche und das harte Baihe Qigong. Während die weiche Richtung unabhängig trainiert werden kann, dient die harte Richtung ausschließlich der Kräftigung des Körpers während des Kampfkunsttrainings. Sämtliche Richtungen haben allerdings folgendes gemein-sam:
•
Tiaoqi
:
Die Energie regulieren.
•
Tiaoshen
:
Den Geist und Körper regulieren.
•
Tiaoxi
:
Den Atem regulieren.
•
Tiaoxin
:
Die Emotionen regulieren.
Bai He Quan
Der jahrhundertealte Kampfstil Bai He Quan (dt. Weißer-Kranich-Boxen) stammt aus China. Er soll auch das Karate und Wing Chun mit beeinflusst haben. Die wahrscheinlich ursprünglichste Version ist das Yongchun Bai He Quan Fa. Sie lässt sich direkt auf das südliche Shaolin Kung Fu in Fujian zurückführen. Aus diesem Grund wird auch die Bezeichnung Fujian Bai He Quan verwendet. Im Laufe der Zeit haben sich aus dem Bai He Quan fünf sogenannte Hybridstile entwickelt, von denen jeder bereits etwa 300 Jahre alt ist:
Feihe Quan
(fliegender Kranich)
Minghe Quan
(schreiender Kranich)
Shihe Quan
(fressender/fütternder Kranich)
Suhe Quan
(schlafender Kranich)
Zonghe Quan
(springender Kranich)
Baihui
Der sogenannte Zwanzigste Punkt, der sich am Scheitel des Kopfes auf der direkten Verlängerung der Ohren befindet, wird Baihui oder auch Niwan genannt. Wenn das Baihui die höchste Stelle des Körpers ist, befinden sich Hüften, Rücken und Nacken in einer idealen Position. In dieser Stellung kann der Atem ungehindert fließen, ebenso ist die Haltung des Ausführenden entspannt.
Bai Lung Chuan Fa
Das Bai Lung Chuan Fa ist eine puertoricanische Kampfkunst, die im Jahr 1990 entwickelt worden ist.
Bai Meimao
Der Stil des Weiße-Augenbrauen-Kung Fu stammt aus Süd-China.
Bajonett
Das Bajonett ist eine, auf einen Gewehrlauf aufgesteckte Stoßwaffe, in Form einer Stahlklinge oder eines langen Dorns. Es wird im demontierten Zustand an der Seite oder am Koppel getragen. Dass auch als Seitengewehr bezeichnete Bajonett wurde nach der französischen Stadt Bayonne bezeichnet.
Bajonette gibt es seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie wurden in den ersten Jahren mit dem Griff in den Gewehrlauf gesteckt. Der Nachteil war, dass dann das Gewehr nicht feuern konnte. Solche frühen Ausführungen wurden Spundbajonett genannt. Ab dem Jahr 1689 wurde die französische Armee mit Bajonetten ausgestattet, die auf eine seitliche Halterung gesteckt wurden. Im Ersten Weltkrieg gab es Bajonette, die eine Länge von bis zu 50 cm erreichten. Auch in den Stellungskriegen des Zweiten Weltkrieges kamen Bajonette auf fast allen Kriegsschauplätzen der Welt zum Einsatz. In der heutigen Zeit besitzen Bajonette die Größe und das Gewicht handelsüblicher Haushaltsmesser.
Balisong
Ein Balisong ist ein philippinisches Klappmesser und wird im Volksmund auch Butterfly genannt. Oft wird es mit den chinesischen Schmetterlingsmessern/-schwertern verwechselt, hat mit diesen allerdings nichts zu tun. Die Begriffsbezeichnung kommt aus dem Tagalog und ist aus den beiden Worten balí (dt. brechen) und sungay (dt. Horn) zusammengesetzt.
Das Messer besteht aus zwei Griffhälften. Diese können jeweils um 180° geschwenkt werden. In der Mitte befindet sich eine Klinge, die mit einem Achsstift an beiden Griffhälften befestigt ist. Am anderen Ende der Griffhälften hält eine Achsstiftsicherung das Messer zusammen. Um das Messer leichter zu machen, existieren oft Bohrungen in den Griffen.
In den Ländern, in denen Balisongs erlaubt sind, werden diese selten als Stichwaffe verwendet, denn deren sichere Handhabung erfordert sehr viel Übung und Können. Vielmehr dient diese Waffe oft der Einschüchterung. Ein Balisong eignet sich im geschlossenen Zustand gut als Verstärkung von Schlagtechniken. Diese Waffenart hat auf den Philippinen die Bezeichnungen Dulo-Dulo, Dos Puntas und Pasak, in Japan Kubotan und Yawara und in Großbritannien Palm-Stick.
Zur Rechtslage:
Deutschland: Der Besitz ist seit dem 1. April 2003 verboten. Das Verbot gilt aber nicht bei einer Klingenlänge von bis zu 4,1 cm und einer Klingenbreite bis 1,0 cm, da im Sinne des deutschen Waffengesetzes dies nicht als Waffe gilt. Erlaubt sind dagegen
Balisong-Trainer
, die nicht über geschliffene oder anschleifbare Klingen verfügen.
Österreich: Balisong sind in Österreich derzeit ab 18 Jahren uneingeschränkt erlaubt.
Schweiz: In der Schweiz sind der Erwerb und der Besitz generell verboten. Auf Antrag sind jedoch Ausnahmegenehmigungen möglich.
Über den Ursprung des Balisong gibt es zwei Entstehungstheorien:
Nach dieser Theorie taucht das
Balisong
erstmals im Jahr 1710 im französischen Buch "Le Perret" auf. In diesem wird die Entwicklung des Messers auf Ende des 16. bis Anfang 17. Jahrhundert datiert. Als Herkunftsland wurde Frankreich angegeben.
Nach der zweiten wahrscheinlicheren Theorie sollen
Balisong
auf den Philippinen als Fischermesser entwickelt worden sein. Die Fischer brauchten ein Messer, das auf einem schwankenden Boot bei einem Sturz ungefährlich war, da die Klinge im Ruhezustand vollkommen in den beiden Griffteilen eingeschlossen war und ist. Um es während der Arbeit zu öffnen, genügte ein Schwung aus dem Handgelenk.
Bamen
Mit der chinesischen Bezeichnung Bamen (dt. acht Pforten) werden die acht Handbewegungen des Taijiquan aus den 13 grundlegenden Bewegungsarten des Shisanshi bezeichnet.
Es gibt vier gerade Sizheng-Handbewegungen und vier in die Ecken gerichtete Siyu-Handbewegungen. Dabei wird einer jeden Handbewegung wird eine Himmelsrichtung und ein Trigramm, dass Bagua genannt wird, zugeordnet.
Sizheng
-Handbewegungen:
Bamen
Himmelsrichtung
Trigramm
Peng
Süden
Qian
Lü
Westen
Kun
Ji
Osten
Kann
An
Norden
Zen
Siyu
-Handbewegungen:
Bamen
Himmelsrichtung
Trigramm
Cai
Nordwesten
Gen
Lie
Südosten
Dui
Zhou
Nordosten
Li
Kao
Südwesten
Sun
Bamen Wubu
Die chinesischen Bamen Wubu stehen für die acht Pforten und fünf Schrittarten der Shisanshi, der dreizehn grundlegenden Bewegungsarten. Diese gelten als Basis der Bewegung des Taijiquan und werden den acht Trigrammen (Bagua) und den fünf Wandlungsphasen (Wuxing) zugeordnet.
Bang
Der Bang ist ein kurzer Stock, der in einigen chinesischen Kung Fu-Stilen, aber auch teilweise als Schwertersatz, verwendet wird. Er besitzt eine Länge von etwa 120 cm, was in etwa der Entfernung vom Boden bis zum Bauchnabel entspricht.
Baojianggong
Hierbei handelt es sich um die äußeren Kräftigungsübungen im Qigong und ein Teilgebiet der chinesischen Atemtherapie. Dort wird es zusammen mit körperlichen Kräftigungsübungen ausgeführt. Das Baojiangong ist ein Teil der „Übungen des Qigong in Bewegung“, die Donggong genannt werden.
Baoxingquan
Das Baoxingquan (dt. Leoparden-Tierboxen) ist ein Bestandteil des Wuqinxi innerhalb des chinesischen Shaolin-Klosters.
Bare-knuckle
Beim Bare-knuckle (dt. bloßer Fingerknöchel) handelt es sich nicht um einen Kampfstil, sondern um einen Begriff aus dem Boxsport.
Bevor es im Boxen die „Queensberry-Regeln“ gab, wurde mit bloßen Fäusten oder Bandagen gekämpft. Die Regeln schreiben u.a. das Tragen von Boxhandschuhen vor.
Bereits im Altertum gab es nachweislich Faustkämpfe mit bloßen Fingergelenken, wie beispielsweise in Afrika (z.B. Ägypten oder Nubien), Griechenland oder Vorderasien. Wenn in der heutigen Zeit mit der bloßen Faust gekämpft wird, nennt man es im deutschsprachigen Raum Bare-knuckle-Fight. In den meisten Ländern werden Bareknuckle-Fights jedoch nicht mehr legal ausgetragen, da die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. Allerdings werden die Kämpfe oft illegal im Untergrund ausgetragen (z.B. in Großbritannien, Irland, Osteuropa oder den USA). In Deutschland gibt es auch die Möglichkeit, legale Bare-knuckle-Kämpfe unter Aufsicht der Polizei und nach vorheriger Anmeldung durchzuführen.
Bartaxt
Eine Bartaxt war eine Streitaxt mit einer großen Klinge, wie sie die Wikinger ab dem 8. Jahrhundert verwendeten. Sie wurde einerseits im Zweikampf eingesetzt, aber auch als Fernwaffe, indem sie in die feindlichen Reihen geschleudert wurde. Höchstwahrscheinlich stammt die Bartaxt von der Franziska der Franken ab.
Bastone Siciliano
Die Kunst des sizilianischen Stockkampfes ist ein Aspekt der Tradition und Kultur des sizilianischen Volkes.
Die Ursprünge des Bastone Siciliano oder die Kunst der „Paranza“, gehen weit zurück. Einige Quellen nennen Ursprung die Ansiedlungszeit der Griechen, zwölftes oder vierzehntes Jahrhundert. Geboren als Waffe der Armen, aber dank der Effektivität seiner Hiebe wurde es eine primäre Waffe der Selbstverteidigung, als ein Mittel zur Wahrung der Ehre oder Kampf für Gerechtigkeit. Nicht umsonst das Sprichwort: „für die Beleidigung den Stock, für die Ehre das Messer“.
Die verwendeten Hölzer sind meist von wilden Olivenbäumen, Bitterorange und Vogelbeere.
Methode San Michele Maestro Vito Quattrocchi
Methode „Siracusa“ (Behüter des Stils Maestro Irmino Raffaele, Andrea Capizzi und Meister Bruno Aglieco)
Zunächst gab es keine Schulen mit technischem Aspekt, diese Entwicklung kam mit der Zeit. Es waren meist Hirten, die sich oft duellierten um mit den Schafen im Gebiet der anderen weiden zu können, oder um den anderen auf einer Weide zu begrenzen. In anderen Fällen kreuzten sich die Stöcke nach verbalen Streitigkeiten zwischen Familien. Viele ältere Menschen kennen zumindest die Grundschläge des Bastone Siciliano.
Im neunzehnten Jahrhundert war die Kunst des Bastone Siciliano verboten so wurde an geheimen Orten trainiert wie beispielsweise Friedhof, Weinkeller oder Scheunen. In diesen Pseudo-Saal/ Schulen gab es einen „Capo Bastone“, der aktuelle Meister der Kampfkunst, ein „Capo Sala“, stellvertretender Saal/Schul-Leiter und dann all die anderen Studenten von ähnlichem Leistungsniveau, es gab auch keine farbigen Gürteln wie in modernen Kampfkünsten. Die wohl bekanntesten Schulen die bis heute überliefert und praktiziert werden sind die A‘Battiri, Rutatu, N‘sutta, Sciurata und Missinisi. Natürlich gibt es in anderen Regionen noch Riali, Sferrá und die Marruggiata Trapanese.
Methode Rutata Maestro Tangona Carmelo
Die „Rutata" (rotierende) ist wohl die am meist verbreitete unter den Sizilianern. Es basiert auf schnelle „Muliné" (Mühlen-Rotation des Hirtenstabs), die von oben nach unten, von unten nach oben, aus horizontaler Drehung ausgeführt werden. Aus diesen Bewegungen werden Hiebe und Stöße ausgeführt.
Die „Sciurata“ (Blumige) für seine Choreographie sehr elegant und technisch schön zu sehen , laut älteren rührt der Name daher das während des Ausholens bzw. Aufladen eines Hiebes hinter dem Kopf eine Art Schwungfigur entsteht die wie eine Blume aussieht. Die Schläge werden auch mit einer Hand ausgeführt oder zum Parieren an beide Stockenden geführt.
„A‘Battiri “ (zu schlagen) diese schlagen den Stock ein oder mehrmals auf den Boden, an eine Wand, einem Baum und führenden Schlag mit maximaler Gewalt mit einer oder zwei Händen aus. Darüber hinaus versucht diese Schule durch schnelle Wechsel der Gangart durch die, die Bastoniere mit festen Auftreten und Lärm des Aufschlagens des Stockes den Widersacher zu stören um letztendlich den Angriff auszuführen.
„N‘sutta“ (drunter/von unten) diese Schule führt meist Schläge von unten raus (Ziele Hände, Genitalien, Kinn) die sehr schwierig zu parieren sind-Auch wechseln sie beim Schlagen die Handpositionen, in denen das Ende für Angriff genutzt wird im Nahkampf. Der Stock hat einen Kopf und einen Schwanz, Bezeichnung für die Stockenden.
„Missinisi“ (Stadt Messina) ist vergleichbar mit Spazierstockfechten wie sie im 19.Jhdt. üblich war, wobei hier auch wieder Strategien die im Bastone Siciliano verwendet werden auch hier ähnlich sind. Einziger Unterschied: im Original gibt es keine Formen sondern Angriff/Parade Drills. Doch im Laufe der Zeit haben einige kleine Formen hinzugefügt.
„Riali“ (königliche) gibt es keine konkreten Beweise und es ist fraglich, wenn einige Formen zeigen. Aus der Region Palermo. Auch hier gibt es ursprünglich keine Formen, sondern Anwendungen. „Sferra“ , aus Vittoria die sowohl einen 70cm Stock, Hirtenstab und Messer nutzen. Eine sehr komplexe Kampfkunst.
„Marrugiata Trapanese“, ähnlich dem Missinisi wird auch hier mit Spazier- oder Doppelstock gefochten. Aus der Trapani-Gegend.
Altmeister Di Bella
Richtig ist auch, dass jede Schule eine Art Schritt oder Stellungsform besitzt, die zum Einladen oder gar dem Kämpfer auf Entfernung erlauben soll, einmal zu pausieren.
Bate Coxa
Die alte Kampfkunst des Bate Coxa stammt aus Brasilien und wurde vor allem von großwüchsigen Farbigen ausgeübt. Jeder Kämpfer musste versuchen, den Gegner mit Schlägen auf dessen Gesäß und Oberschenkel zu Fall zu bringen. Gewonnen hatte derjenige, der die Schläge aushielt und sich auf seinen Beinen halten konnte. Gewettet wurde um Frauen, Geld und sonstige Wertsachen.
Bâton Français
Hierbei handelt es sich um eine französische Stockkampfart. Sie ist vermutlich eine Abwandlung des englischen Quarterstaff, zeigt aber auch Ähnlichkeit mit dem italienischen Schmera di Bastone oder dem portugiesischen Jogo do Pau.
Die Techniken des Bâton Français sind sehr stark denen des Langschwertes entlehnt.
Bauernwaffen
Als Bauernwaffen werden die aus Okinawa stammenden oder dort weiterentwickelten Bauerngerä-te/-waffen bezeichnet. Als Beispiele können hier das Kama, Nunchaku oder Tonfa genannt werden. Der Grund für deren Entwicklung war das Verbot für die einfachen Leute Schwerter zu tragen. Heute wird noch im Kobudō und anderen Kampfstilen die Verwendung der traditionellen Bauernwaffen gelehrt.
Beipai Tanglangquan
Der Stil der nördlichen Gottesanbeterin stammt aus Nord-China.
Berdysch
Die Berdysch war dazu gedacht, schwere Rüstungen mit schwingenden Hieben zu durchschlagen. Außerdem konnte sie stoßend, ähnlich einer Lanze, eingesetzt werden.
Sie besaß ein großes, drei Kilogramm schweres, 60-75 cm langes, halbmondförmiges Axtblatt, welches auf einem 130-180 cm langen Holzschaft angebracht war.
Im späten Mittelalter wurde sie zur bevorzugten Waffe der russischen Palastgarden (Strelizen). Im Laufe des 15. Jahrhunderts breitete sich die Berdysch in osteuropäische Gebiete und nach Schweden aus. Musketiere benutzen die Berdysch als Nahkampfwaffe und zur Ablage und Zielhilfe für ihre Schusswaffen.
Bersilat
Die Kampfkunst des Bersilat findet sich in Malaysia und Singapur. Die Synthese von Kuntao, Pentjak Silat und (später) Quanfa wurde bereits im 15. Jahrhundert in Malaysia begründet.
Das Bersilat wird in zwei Kategorien eingeteilt:
1.
Buah
:
Die nicht öffentlich gezeigte realistische Kampfkunst.
2.
Pulat
:
Die öffentlich gezeigte tanzähnliche Version, aber ohne Kampfrealismus.
Bersilat ähnelt in der Ausführung dem brasilianischen Capoeira. Es wird ohne und mit (kurzen) Waffen trainiert. Die Techniken benötigen nur einen sehr geringen Kraftaufwand.
Ein gut trainierter Bersilat-Kämpfer trifft mit sehr großer Genauigkeit die 12 lebenswichtigen Vitalpunkte, bzw. kritischen Nervenpunkte.
Beta 8
Richard Grannon ist ein "Self Protection Instructor" dessen Sichtweisen und Trainingsmethoden sich in überzeugender Art und Weise von der breiten Masse unterscheiden. Ein Abschluss in Psychologie, NLP-Trainer, Background in den verschiedensten Kampfkünsten und jahrelange Erfahrungen als "Doorman" in Liverpool machen seine Lehrmethoden einzigartig und extrem effizient. Sein Ziel ist es, Menschen so effektiv und so ehrlich wie möglich auf die harte, brutale Gewalt auf den Straßen vorzubereiten - ohne Schnörkel, ohne Geheimnisse, sondern durch hartes und solides Training.
Ein Ergebnis seiner Arbeit mit der Frage "Wie bringe ich dies am besten jemandem bei?" ist Beta 8 - dies ist kein neues System, sondern vielmehr eine komprimierte, zielgerichtete Trainingsmethodik, die es einem erlaubt die kämpferischen Fähigkeiten und Vorgehensweisen zu erlernen, welche einem in einer realen Selbstverteidigungssituation wirklich schützen können.
Kern des Beta 8 ist das Konzept einen "Core Game Plan" aufzubauen und sich anzueignen. Der Core Game Plan ist eine kompromisslose Kampfstrategie mit dem einzigen Ziel einen Angreifer so schnell und so hart wie möglich auszuschalten.