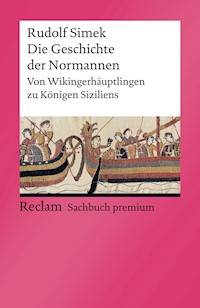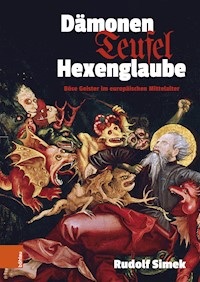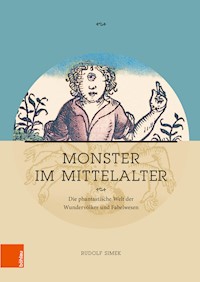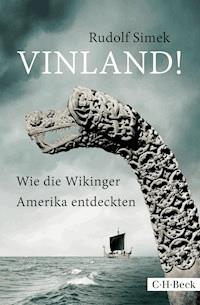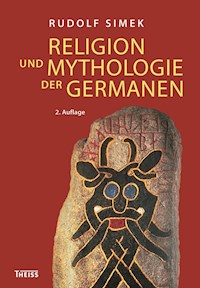7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Zum Buch
Mit den Wikingern verbindet man oft die Vorstellung von beutegierigen und trinkfesten Seeräubern. Rudolf Simek konfrontiert im vorliegenden Band diese und andere Gemeinplätze mit den Ergebnissen der neuesten Forschung und entwickelt so auf ebenso verständliche wie anschauliche Weise das facettenreiche Bild einer faszinierenden Kultur, deren Spuren von Grönland bis nach Sizilien, von Amerika bis weit nach Rußland reichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Rudolf Simek
DIE WIKINGER
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Mit den Wikingern verbindet man oft die Vorstellung von beutegierigen und trinkfesten Seeräubern. Rudolf Simek konfrontiert im vorliegenden Band diese und andere Gemeinplätze mit den Ergebnissen der neuesten Forschung und entwickelt so auf ebenso verständliche wie anschauliche Weise das facettenreiche Bild einer faszinierenden Kultur, deren Spuren von Grönland bis nach Sizilien, von Amerika bis weit nach Rußland reichen.
Über den Autor
Rudolf Simek ist Professor für mittelalterliche deutsche und skandinavische Literatur an der Universität Bonn. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen vor allem zur Literatur und Kultur des mittelalterlichen Skandinavien vorgelegt. In der Reihe Beck Wissen liegen von demselben Autor vor: Die Edda (2007) und Götter und Kulte der Germanen (42016).
Inhalt
Einleitung
I. „Wir haben Fahrtwind selbst gegen den Tod“ – „Nordisches Lebensgefühl“ und die Gründe für die Entstehung der Wikingerzeit
II. Die Geißel der Christenheit – Die Wikinger in europäisch christlicher Sicht
III. Fjordhunde und Wellenwölfe – Die Voraussetzung wikingischer Expansion: Das Schiff
IV. Plünderer als Siedler, Geächtete als Entdecker, Händler als Staatengründer – Die Stoßrichtungen wikingischer Expansion
1. Plünderer als Siedler: Die skandinavische Expansion nach Südwesten
2. Geächtete als Entdecker: Die wikingische Expansion nach Nordwesten
3. Händler als Staatengründer: Die wikingische Expansion nach Osten
V. Alltag und Feste – Alltagsleben und materielle Kultur in der Wikingerzeit
VI. Eine Welt nur für Männer? Die Gesellschaftsordnung der Wikingerzeit
VII. Politische Propaganda, Heldenlieder und Götterdichtung – Skaldendichtung und Eddalieder als Literatur der Wikingerzeit
VIII. Von heidnischen Wikingern und christlichen Heiligen – Die Religionen der Wikingerzeit
1. Die heidnische Zeit
2. Erste Kontakte mit dem Christentum und die Phase des Synkretismus
3. Die Bekehrung der Skandinavier zum Christentum
Literatur
Register
Einleitung: Ungebändigte nordische Lebenskraft: Der Wikinger als Mythos
Wikinger (altnord. víkingr) heißt „Seeräuber“ und bezeichnet somit eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung, nämlich den zur See fahrenden Krieger. Diese Gruppe hat aber einer ganzen Epoche ihren Namen gegeben, sodaß man heute, wenn man salopp von „den Wikingern“ spricht, die Gesamtbevölkerung Skandinaviens vom Ende des 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts bezeichnet. In diesem Sinn ist der vorliegende Titel Die Wikinger zu verstehen, deren Geschichte und Kultur hier auf knappstem Raum vorgestellt werden sollen.
Von Geschichte und Kultur der Wikingerzeit ist aber der Mythos zu unterscheiden, der sich vor allem in den letzten 200–300 Jahren zu diesem Thema entwickelt hat. Dieser ist seiner eigenständigen Entwicklung halber von der Beschäftigung mit der realen Wikingerzeit sorgfältig zu trennen, ohne deswegen weniger real zu sein: der Wikingermythos tradiert weiterhin, daß Wikinger Met tranken, Helme mit Hörner trugen und in flachbordigen, geruderten Drachenschiffen nach Amerika gelangten. Für diesen Mythos „Die Wikinger“ ist es belanglos, daß dem nicht so war, und alle einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse werden keinen Eingang in ihn finden. Für die geläufige moderne Meinung ist die Vorstellung von den gehörnten Helmen oder Christian Kroghs berühmtes Gemälde „Leif Eriksson entdeckt Amerika“ viel relevanter als jedes sachliche Faktum. Es gilt daher im Folgenden, auch diesen Mythos nicht aus den Augen zu verlieren; auf die Wikinger, die nicht unseren historischen Erkenntnissen, sondern dem Wikingermythos angehören, wird daher im Weiteren verschiedentlich als „Die Wikinger“ verwiesen.
Es ist bezeichnend für den Umgang mit der Wikingerzeit, und es macht die Existenz des Wikingermythos verständlich, daß trotz einer Unzahl archäologischer Daten und Artefakten, die in den letzten 200 Jahren zutage gefördert wurden, der Großteil unseres geläufigen Wissens über die Wikingerzeit aus Texten stammt, die von Augenzeugen, Nachfahren, aber auch von mittelalterlichen Historikern in den auf die Wikingerzeit folgenden Jahrhunderten geschaffen wurden. Wie alle Texte tragen sie den Stempel ihrer Autoren und ihrer Entstehungszeit. Man könnte also auch sagen, daß die Wikingerzeit erst von diesen vielen früh- und hochmittelalterlichen Autoren geschaffen wurde. Die archäologischen Funde der Neuzeit werden, so gut es eben geht, mit der Wikingerzeit, die uns in den Quellentexten entgegentritt, in Übereinstimmung gebracht. Oft genug aber ist dies entweder nicht möglich oder die archäologischen Funde bleiben mangels entsprechender Texte weitgehend stumm; selbst die Toten in den großen Schiffsgräbern, die uns so viel über Leben und Tod in der Wikingerzeit mitteilen, bleiben, wenn sie nicht zufällig in irgendwelchen Texten erwähnt sind, für uns recht isolierte Funde. Oftmals müssen wir auch davon ausgehen – manchmal durch nichts mehr als das Genre eines Textes motiviert –, daß Quellentexte unhistorisch, legendenhaft sind, und müssen sie als historisches Zeugnis verwerfen. Andererseits sind die Historiker gelegentlich auch zu weit in ihrer Quellenkritik gegangen. Wenn z.B. der berühmte Wikinger Ragnar Loðbrókr in der Darstellung der Ragnars saga loðbrókar auch völlig ahistorisch sein mag, so geht es m.E. doch zu weit, jede Verbindung zu dem Wikinger Ragnar, der im März 845 Paris eroberte, abzulehnen. Denn als Erzählkern für Wikingergeschichten mag der historische Ragnar sehr wohl gedient haben. Dennoch müssen wir uns natürlich davor hüten, daß das literarische Bild der Wikingerzeit, wie es uns in hochmittelalterlichen Texten entgegentritt und welches unser durch den Wikingermythos beeinflußtes Alltagsverständnis der Wikingerzeit beherrscht, dominant wird, und wir müssen uns daher stets die literarische Qualität dieser Texte vor Augen halten.
Manchmal ist es praktisch, sich an griffigen Daten zu orientieren, und auch die Wikingerzeit genannte Periode spannt man häufig zwischen zwei solche Daten. Den Anfang markiert dabei der angeblich völlig unerwartete Überfall von skandinavischen Kriegern auf die der englischen Nordostküste vorgelagerte Klosterinsel Lindisfarne im Jahre 793. Als das Ende dieser Periode wird im allgemeinen das Jahr 1066 angesehen, das gleich mit einer Reihe von relevanten Ereignissen aufwarten kann. Am Montag, dem 25. September, schlug der englische König Harold Godwinson in der Schlacht von Stamford Bridge das norwegische Heer des Königs Harald des Harten (Haraldr harðráði) und vereitelte damit den letzten Versuch, England unter skandinavischer Hoheit zu halten. Am 14. Oktober aber fiel Harold in der Schlacht von Hastings gegen das normannische Heer unter Wilhelm dem Bastard, später der Eroberer genannt, der in England eine normannische Herrschaft einrichtete. Im selben Jahr 1066 wurde aber auch die bedeutendste wikingische Handelsstadt, nämlich Haithabu (beim heutigen Schleswig), durch ein slawisches Heer so vollständig zerstört und niedergebrannt (Adam von Bremen, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, III, 51, Schol. 81.), daß der Ort nicht wiederbesiedelt wurde, nachdem er schon um 1050 von den Norwegern gebrandschatzt worden war. Die beiden Daten 793 und 1066 sind deswegen brauchbar, weil ihre Ereignisse symptomatisch für die Entwicklung der Wikingerzeit waren. Der Überfall von 793 war das für die Opfer überraschende Werk einer plündernden Seeräuberbande, die Schlachten von 1066 zeigen die wikingische Welt als durch politische, militärische und ökonomische Verbindungen eng vernetzt. Dieses Netz erst erlaubt es uns, überhaupt von einer wikingischen Kultur dieser frühmittelalterlichen Jahrhunderte zu sprechen.
Im Gegensatz zu anderen Büchern der letzten beiden Jahrzehnte über die Wikinger ist es nicht das Hauptanliegen des vorliegenden Büchleins, eine „Ehrenrettung“ der Wikinger zu versuchen. Auch will es nicht, wie eines der jüngsten Werke zum Thema, zeigen, daß „die Wikinger Händler waren, die sich nach und nach, und wenn die Umstände es zuließen, in Piraten verwandelten“ (Boyer 1994, S. 16). Wenn überhaupt eine derartige Definition gewagt werden kann, dann die, daß alle Wikinger Bauern waren, die versuchten, einer prekären Subsistenzwirtschaft zu entfliehen – sei es durch Raub, Handel oder die Bewirtschaftung ertragreicheren Bodens. Es ist mein Ziel, in knapper Weise und an Hand einer im Rahmen des vorgegebenen Raumes größtmöglichen Zahl von Quellen zu zeigen, was die wesentlichen Elemente der Wikingerzeit in den drei Hauptstoßrichtungen nach Südwesten, Nordwesten und Osten waren. Diese seien hier nur kurz mit den Begriffen Okkupation, Kolonisation und ökonomischer Infiltration umrissen. Darüber hinaus möchte ich deutlich machen, was die Geschichte und die Geschichtsschreibung seither mit diesen Quellen gemacht haben, um zu unserem heutigen gängigen Bild der Wikingerzeit zu kommen, das ich als Wikingermythos bezeichnen will. Dabei halte ich es für keineswegs sicher, daß für uns die Wikingerzeit überhaupt noch vom Wikingermythos zu trennen ist, sosehr haben schon die ältesten Quellen die Wikingerzeit selbst mitgeschaffen.
Es geht also nicht um eine Ehrenrettung – im Stil von „Kulturnation statt blutrünstige Barbaren“ –, sondern um die vielen Facetten nationaler, geographischer, ökonomischer und auch mentaler Art, die sich daraus ergeben, daß sich in den knapp 300 hier behandelten Jahren der Wikingerzeit die Skandinavier mit zahlreichen anderen Völkern, Wirtschafts- und Siedlungsräumen, Religionen und politischen Systemen messen mußten. Es ist daher selbstverständlich, daß der Begriff Wikinger hier nur der sehr weite Oberbegriff für alle derartigen skandinavischen Aktivitäten vom 8. zum 11. Jahrhundert sein kann.
Durch die Flut neuer Funde und Erkenntnisse ist es inzwischen fast unmöglich geworden, eine Epoche wie die Wikingerzeit in ihrer Gesamtheit mit allen Belegen darzustellen. Ein solcher Versuch würde zahlreiche Text- und noch mehr Bildbände füllen. Daher ist es auch hier nur mein Anliegen, möglichst viele der genannten Facetten anzuschneiden, um durch die Darstellung des Symptomatischen wie des Idiosynkratischen gleichermaßen der Komplexität des Gegenstandes wenigstens annähernd gerecht zu werden.
I. „Wir haben Fahrtwind selbst gegen den Tod“ – „Nordisches Lebensgefühl“ und die Gründe für die Entstehung der Wikingerzeit
Der von Skandinavien bis Neuseeland belegbare Wikingerboom der Gegenwart ist wohl als harmloses Phänomen zu erachten, auch wenn eine seiner Wurzeln, die Germanenmode vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945, weniger harmlose Verwendung gefunden hat und deswegen nach dem 2. Weltkrieg auch weitgehend geächtet wurde und erst in der allerjüngsten Vergangenheit wieder etwas mehr Interesse erweckt (PM-Perspektive Nr. 39/1995: Die Germanen; Spiegel vom 28.10.1996: Die Germanen – unsere barbarischen Vorfahren). Eine Rückkehr der Germanentümelei ist jedoch wohl nicht zu befürchten, und die Wikingertümelei ist wenigstens außerhalb Skandinaviens eine recht periphere Erscheinung. Wenn die südwestenglische Stadt Tavistock 1997 ihre Brandschatzung durch Wikinger feiert und nachvollziehen will, oder wenn der erst im 19. Jahrhundert gegründete Ort Dannevirke auf North Island in Neuseeland der skandinavischen Herkunft seiner Bewohner mit einem Viking Festival unter Verbrennung eines Wikingerschiffes gedenkt, dann sind die zugrundeliegenden Beweggründe für derartige Feiern wohl nicht in dem Wunsch nach Rückkehr zu wikingerzeitlichen Bräuchen oder Idealen zu sehen. Ähnlich wie in den überaus zahlreichen skandinavischen Aktivitäten wird darin eher die Suche nach vorzeigbaren historischen Wurzeln deutlich, die der Identitätsfindung von Gemeinden oder Regionen in einer immer uniformeren und reglementierten Welt dienen. Diese Suche nach der historischen Dimension einer solchen Identität ist in Skandinavien, hier besonders in Schweden und Norwegen, und auf den nordatlantischen Inseln, insbesondere den Orkneys und Shetlands, längst mit dem Rekurs auf die Wikingerzeit entschieden. In Dänemark ist dies weniger offensichtlich, aber als man während des dänischen EU-Vorsitzes im ersten Halbjahr 1993 ein Schiff von einer bronzezeitlichen Felszeichnung als Logo wählte, wurde es – obwohl immerhin 3000 Jahre älter – durchwegs als Wikingerschiff bezeichnet.
Die Wikingerzeit scheint sich also offenbar als historische Größe im Bereich der Identitätsfindung einer erstaunlich großen Zahl von Ländern, Regionen und Gemeinden anzubieten. Natürlich stellt sich dabei die Frage nach dem Grund für dieses Phänomen, und den wiederum dürfte man in erster Linie im Bild der „Wikinger“ in der öffentlichen Meinung zu sehen haben. Selbst wenn man, wie eine ZDF-Dokumentation am 3.11.1996, eine populäre Darstellung der Wikingerzeit mit dem Verweis auf die „metsaufenden Raufbolde“ aus dem Norden beginnt, so ist es heute üblich, dieses Zerrbild sofort durch eine ausführliche Beschreibung wikingischer kultureller Leistungen zu konterkarieren. So auch im vorliegenden Fall, wo der Film den Titel „Genies aus der Kälte“ trägt. Diese Entwicklung wurde im wesentlichen durch Peter H. Sawyers Buch The Age of the Vikings (London 1962) eingeleitet und ist heute für jeden Diskurs zum Thema Wikinger dominierend. Das Spannungsverhältnis zwischen den Wikingern als mörderischen Barbaren und den Wikingern als Kulturträgern ist wohl einer der Hauptgründe für den gegenwärtigen Wikingerboom: In einer reglementierten, bürokratisierten Welt, in der jedes triebhafte Ausleben des menschlichen Aggressionspotentials streng geahndet wird, muß die – seinerzeit wenigstens innerhalb Skandinaviens – sozial akzeptable Form organisierten Aggressionsverhaltens der Wikingerzeit ideal verklärt als Ventil für entsprechende (auch unterbewußte) Wunschvorstellungen heute herhalten. Andererseits hat die Hervorhebung der kulturellen und organisatorischen Leistungen der Wikingerzeit den Vorwurf entkräften helfen, die Wikinger hätten sich auf einer noch barbarischen Kulturstufe befunden. Der Vergleich mit Skythen, Awaren, Magyaren und Mongolen, die trotz einer von ihrer Umwelt als ähnlich barbarisch empfundenen Kriegsführung eine ebenfalls nicht unbeträchtliche Sachkultur hervorgebracht haben, entfällt dabei meist.
Im Gegensatz zu den Gründen für den Wikingerboom geht es bei den Gründen für den Beginn der skandinavischen Expansion, die man üblicherweise als Wikingerzeit bezeichnet, nur peripher um Identitäten, obwohl diese in der wikingischen Spätzeit eine Rolle gerade bei der Selbstdarstellung gespielt haben mögen. Es muß zudem vorweg festgestellt werden, daß keiner der vielen in der Vergangenheit genannten Gründe allein eine ausreichende Erklärung dafür bieten kann, warum innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte an der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert plötzlich jährlich etliche Flotten mit Dänen und Norwegern aus Skandinavien aufbrachen, um ihr Glück in Friesland, England und Frankreich zu machen. Auch die vorgeschlagene Reduktion auf drei Hauptursachen (Boyer 1994) wird den komplexen Ursachen für diese späte Phase der Völkerwanderungszeit nicht gerecht. Nur eine multikausale Erklärung kann Anspruch darauf haben, die Wurzeln der Wikingerzeit wenigstens einigermaßen sichtbar zu machen.
Es zeigt sich aber schon bei erster Betrachtung, wie sehr gerade bei der Suche nach den Gründen für die Wikingerzeit der Wikingermythos die historischen Fakten in einer Weise überwuchert hat, die für uns die wahren Ursachen kaum mehr zugänglich macht. Das Dilemma der Forschung liegt dabei gerade darin, daß uns zeitgenössische Texte nur wenig über die Ursachen der Wikingerzeit berichten, wohl weil dieses Phänomen auch für sie nicht einsichtig war. Wir sind somit auf wenige Stellen angewiesen, die von der Forschung unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt rezipiert wurden. Die ältere Forschung (so noch Brøndsted 1960) sah in einer angeblichen Überbevölkerung Skandinaviens und in der damit verbundenen Verknappung der agrarischen Ressourcen die Hauptursachen für den Aufbruch größerer Banden jugendlicher Krieger nach Süden. Dieser Erklärungsansatz aber fußt auf den Aussagen des notorisch unverläßlichen normannischen Geschichtsschreibers Dudo von St. Quentin (De moribus et actis primorum Normanniae ducum, verfaßt um 1020 gegen Bezahlung für die normannischen Herzöge), der die Verherrlichung der normannischen Herrscher zum Ziel hatte:
Diese Menschen geben sich unverschämt den Ausschweifungen hin, leben in Gemeinschaft mit mehreren Frauen und zeugen durch diesen schamlosen und gesetzlosen Verkehr eine zahllose Nachkommenschaft. Wenn sie aufgewachsen sind, streiten die Jungen gewaltsam mit ihrern Vätern und Großvätern oder untereinander um Besitz, und wenn sie zu zahlreich werden, und sich nicht mehr ausreichendes Land für ihren Lebensunterhalt erwerben können, wird nach altem Brauch durch das Los eine große Gruppe junger Menschen ermittelt, welche zu fremden Völkern und Reichen getrieben wird, wo sie sich durch Kampf Länder erwerben können und wo sie in dauerhaftem Frieden leben können. (Lib. I,1)
An seiner Beschreibung ist die christliche Entrüstung nur oberflächlich, darunter steckt aber die absichtsvolle Bewunderung für die Virilität der normannischen Adeligen, die zu seiner Zeit neue Aktualität hatte. Es war gerade diese Virilität, die etwa im 2. Viertel des 11. Jahrhunderts dazu führte, daß von den 12 Söhnen des Tancred de Hauteville die meisten nach Süditalien zogen, um dort ihr Glück zu machen, und schließlich die sizilianische Königslinie begründeten. Die Aussagen der normannischen Schriftsteller des 11. Jahrhunderts wie Dudo oder auch Wilhelm von Jumièges müssen also vor dem Hintergrund gesehen werden, daß zu ihrer Zeit eine neue normannische Auswanderungswelle eben nach Süditalien im Gange war, wo sich die Normannen innerhalb der nächsten 100 Jahre ein weiteres Reich erobern sollten.