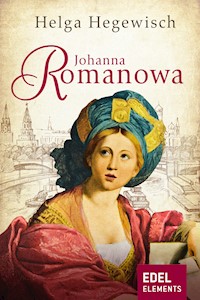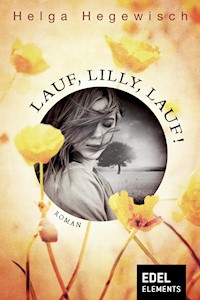4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um sich aus der engen Welt der Wiener Maler, Modelle und Sammler zu lösen, heiratet die junge Serena, angeblich eine illegitime Tochter des Malers Gustav Klimt, den Hamburger Schiffbauer Rudolf Max Magnussen. Einen Mann mit internationalen Beziehungen und einem besten englischen Freund, der auch in Serenas Leben bald eine wichtige Rolle spielt. Sie ahnt nicht, dass sie sich dadurch in eine noch größere Enge begibt. Auf der Elbinsel, wo sich alles nur um Schiffe, um Geschäfte dreht, flüchtet sie sich in Phantasien und Träume. Doch der Zweite Weltkrieg, der auch von den Schiffbauern dramatische Entscheidungen verlangt, setzt ihren Spielen ein Ende. Erst ihre Tochter Nana, die auf der Werft aufwächst, wird sich aus den von der Mutter geknüpften Abhängigkeiten lösen können. Sie wird das alte Spiel um Liebe, um Besitz und Macht selbst in die Hand nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Helga Hegewisch
Die Windsbraut
Roman
Edel eBooks
Inhalt
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil II
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil I
SERENA
Serena war sehr schön. Sie hatte drei Väter.
Albert, der Kohlenhändler, dessen Namen sie trug, war grobschlächtig, und seine wenig markanten Gesichtszüge verschwanden nicht nur unter Kohlenstaub, sondern mehr noch unter Fettpolstern.
Der Maler Gustav Klimt, den sich ihre Mutter zum Kindsvater erkoren hatte, ähnelte mit seiner gedrungenen Gestalt, dem kurzen Hals und den zusammengekniffenen Äuglein eher einem pfiffigen Bauarbeiter als einem Adonis. Und Hugo ten Broich, Serenas »bester Vater«, sah aus wie ein frühzeitig gealterter Don Quijote.
Herma, ihre Mutter hingegen hatte schlanke Waden, extrem lange, feste Oberschenkel, einen Hintern, der laut Klimt intelligenter war als bei den meisten Mädchen das Gesicht, und einen zierlichen runden Busen, der während der Schwangerschaft noch schöner wurde. Eine Idealfigur. Dazu zarte Handgelenke und dünne Finger und nicht nur auf dem Kopf üppige rotblonde Haare. Das Gesicht jedoch ließ zu wünschen übrig, die Nase war zu kräftig, der Mund zu schmal, das Kinn zu lang, wären da nicht ihre Augen gewesen, groß und blau, zwar oft verschleiert, doch von geheimnisvoller Intensität. Vermutlich hat Athene, die Göttin mit den blauen Augen und dem Kuhblick, ihre Partner und Opfer auf ähnliche Weise fixiert. Allerdings dürfte die sich ihrer Wirkung bewusster gewesen sein als Herma.
An einem nasskalten Montag im Februar des Jahres 1902 ging Herma zum ersten Mal, geschoben und gezogen von ihrer Freundin Caroline, in die Modellbörse der Wiener Kunsthochschule.
Was sie zu tun beabsichtigte, passte nicht zu ihrem Leben. Sie wusste, was sich gehörte, sie hatte Prinzipien. Albert, ihr Ehemann, würde einen Wutanfall kriegen, wenn er davon erführe.
Herma war ganz steif vor Aufregung.
»Ich sollt aber nicht hier sein«, flüsterte sie immer wieder.
Caroline, die sehr viel Jüngere, aber offenbar Erfahrenere, rollte die Augen gen Himmel.
»Bist aber hier«, sagte sie, »und du weißt auch, warum. Willst dein eigenes Geld, willst dein eigenes Leben. Willst was aus dir machen.«
»Aber der Albert …«
»Der Albert hat auch sein eigenes Leben. Geht einen trinken, wenn er Lust drauf hat. Und manchmal sitzt er nach der Kohlenlieferung an das Palais Katz unten in der Küche und macht der Mamsell schöne Augen. Und die revanchiert sich dann mit einem Kaffee.«
»Der Albert ist ein Mann.«
»Und du bist eine schöne Frau. Bloß merkt das keiner, weil du dich ja nie so recht herzeigst. Und natürlich auch, weil der Albert keinen Blick für Schönheit hat und dich behandelt wie ein Möbelstück, wie …«, Caroline hielt einen Moment inne, »na, sagen wir mal wie eine alte Couch, auf der er jeden Abend nach der Arbeit ein paar Liegestütze macht.«
»Abends nie«, flüsterte Herma, »immer nur morgens, wenn ich noch nicht ganz aufgewacht bin.«
Caroline lachte. »Na, komm schon, gehen wir ein Stück den Flur entlang. Oder die Treppe rauf und runter, damit man sehen kann, wie du dich bewegst. Und die Schultern zurück und den Hals lang machen. Wenn einer Interesse an dir findet, dann nicht etwa zusammenknicken und den Kopf senken, sondern ihm direkt in die Augen schauen, denn er muss unbedingt sehen, was für einen Blick du hast.«
»Wieso Blick? Ich dachte, der will … also dem geht’s nur um die Figur. Um das rein Körperliche, dachte ich.«
»Klar geht’s ihm darum. Aber das reicht eben nicht.«
»Jesus Maria, was denn noch?«
»Der braucht was Innerliches. Was, das ihn inspiriert – sagt er. Und die Augen sind nämlich das Schaufenster der Seele – sagt er auch. Und ich sag, dass deine Augen ganz was Besonderes sind, und der Blick, den du manchmal hast … also, wenn du’s heute schaffst, deinen Augen genau diesen Blick zu geben, du weißt schon, also dann wird er nicht anders können, er muss ins Geschäft kommen mit dir.«
»Ich hätt nicht herkommen sollen«, sagte Herma weinerlich. »Das Ganze ist ein Unding. Ist irgendwie pervers.«
»Ja, ja, das hast du schon hundertmal gesagt, bist aber trotzdem mitgegangen. Sieh mal, da kommt er.« Sie deutete den Gang entlang, wo beim Treppenabsatz zwei Männer auftauchten, ein junger, magerer mit tief liegenden dunklen Augen und ein untersetzter, bärtiger, der eine Mappe unter dem Arm trug. »Und er ist nämlich nur hier, weil ich ihn gebeten hab. Aber es ist ihm grad recht so gekommen. ›Caroline‹, hat er gesagt, ›ich braucht mal was Neues. Das, was sich hier bei mir so zeigt, das kenn ich zu gut, nichts Überraschendes mehr.‹«
Caroline hüpfte auf die beiden Männer zu und stellte sich ihnen in den Weg. Herma blieb zurück, umklammerte das Treppengeländer.
»Ich hab sie also hergebracht«, sagte Caroline und lachte grundlos. »War gar nicht so einfach. Sie hat partout nicht gewollt. Erst als ich ihr gesagt hab, dass sogar der Kaiser zu Ihnen ins Atelier kommt, da hat sie sich’s anders überlegt.«
Die beiden Männer blieben stehen. »Nicht zu mir ins Atelier«, sagte der ältere, »in die Sezession ist er gekommen, der Kaiser. Und auch nur ein einziges Mal.«
»Ist doch egal«, sagte Caroline. »Hauptsache, dass.«
»Ist leider nicht egal. Könnt man dem Kaiser ein echtes Interesse nachweisen, ihn vielleicht gar bereden, ein paar Bilder zu kaufen – ja, das war dann schon was. Und wen hast du mir eigentlich hergebracht?«
»Sie haben gesagt, Sie bräuchten was Neues. Da steht sie.«
Der Blick des Malers folgte Carolines ausgestrecktem Finger, der auf Herma deutete. »Die da?«
Caroline nickte eifrig.
»Was hat sie denn an Erfahrung?«
»Nix.«
»Und warum sollte ich mich für sie interessieren?«
»Wegen die Augen. Und was nützt denn Erfahrung, wenn man keinen guten Körper hat. Aber die da, die hat einen. Und sie könnt auch ein Zubrot gebrauchen.«
»Ist sie denn in Not?«
»Nein, ist sie eigentlich nicht. Aber ihr Mann ist ein Geizhals.«
»Verheiratet ist sie also auch. Und was sagt der Mann, wenn sie ins Atelier kommt?«
»Er wird’s nicht wissen.«
»Ich will aber keinen Ärger.«
»Kriegen S’ auch nicht, ich garantier. Der Mann ist den ganzen Tag bei der Arbeit und abends in der Kneipe.«
»Was Professionelles war mir aber lieber. Da sind doch genug andere. Ich brauch ja bloß in die Nissenstraße zu gehen.«
Der junge Gefährte, der mit dem eingefallenen Hungergesicht, war inzwischen weitergegangen. Vor Herma blieb er stehen, sehr nah. Er starrte sie an. Herma sackte in sich zusammen, doch dann erinnerte sie sich an das, was Caroline ihr eingeschärft hatte, sie hob den Kopf, streckte sich, machte einen langen Hals und starrte dem Mann, den sie für den berühmten Kunstmaler Klimt hielt, mit ihren herausfordernd blicklosen Augen ins Gesicht.
»Jesus und Maria«, sagte der Mann, wandte sich ab und ging zurück. »Wenn ich du wäre, ich tät’s probieren. Augen hat das Mädel …«
»Und einen Hintern hat sie auch!«, fiel Caroline ein.
»Na gut, dann bring sie mir. Ein Versuch kann ja wohl nicht schaden.«
»Wann?«
»In zwei Stunden bin ich zurück im Atelier.«
So wurde Herma ein Klimt-Modell und hat später durch ein sehr ungewöhnliches Aktbild eine gewisse Berühmtheit erlangt. Dabei hat sie sich anfangs aufgeführt, als wollte man ihr die Haut abziehen.
Im Zimmer neben dem Atelier saßen immer ein paar von den Mädchen herum, die darauf warteten, dass Klimt sie brauchen könnte. Manche in Kleidern, manche nackt, manche in ein Tuch gehüllt. Ins Atelier durften sie erst, wenn sie gerufen wurden. Der Maler selbst jedoch kam oft ins Nebenzimmer – um sich zu erholen. Vor allem, wenn im Hauptatelier eine feine Dame zur Sitzung erschienen war, eine von den jüdischen Jour-Damen, wie er sie hinter vorgehaltener Hand nannte, vermutlich als Unterscheidung von jenen, die ihm gelegentlich die Nächte versüßten. Die Porträt-Sitzungen strengten ihn an, oft hatte er Schweißtropfen auf der Stirn. Kam er dann nach nebenan, setzte er sich nicht etwa und ruhte sich aus, ganz im Gegenteil. Er lehnte seinen großen Skizzenblock an die Staffelei und zeichnete, zeichnete wie besessen, ganze Figuren, einzelne Gliedmaßen, einen gerüschten Saum, Kringellocken über einem Ohr, zeichnete abwechselnd mit der rechten und der linken Hand, das war so, als müsste er sich nach dem Krampf mit der in ihrer Pose erstarrten Jour-Dame nun wieder gelenkig machen.
Anfangs schaute Klimt an Herma vorbei, doch dann beschäftigte er sich – wie nebenher – mit ihr. »Greif dir mal mit der Rechten ins Haar«, sagte er und zeichnete ihr Profil, die Schulter und einen Teil des hochgestreckten Armes. Oder: »Hock dich hier auf den Stuhl, zieh die Knie hoch und leg die Arme um die Beine. Gut so, beweg dich nicht.« Und manchmal sagte er ihr auch, dass sie erst einmal ihre eigene Schönheit begreifen müsse, um die anderen Menschen davon zu überzeugen.
Bald hatte Herma das Gefühl, der Zeichenstift würde zu einem Zauberstab: Hatte der Magier einen Teil von ihr aufs Papier gebannt, dann waren ihr Hals oder ihr gebeugtes Knie oder ihr langer, dünner Oberschenkel tatsächlich schön geworden. Indem sie die Schönheit der Zeichnung erkannte, wurde ihr die eigene bewusst. Dass sie sich daraufhin in Klimt verliebte, war nur eine natürliche Folge dieser Entwicklung.
Ein paar Mal schlief er auch mit ihr, wie mit vielen seiner Modelle. Doch als Herma dann schwanger wurde und behauptete, das Kind sei von ihm, da lachte er nur und sagte: »Aber du bist doch verheiratet!«
Herma bemühte sich um einen klaren Blick: »Verheiratet bin ich. Aber das Kind ist von Ihnen!«
Daraufhin schickte Klimt, um Ärger zu vermeiden, wie er sagte, Herma fort. Schließlich war kein Mangel an willigen Modellen. Herma aber blieb, sie äußerte sich auch nicht zu des Meisters Worten. Sie kam nur einfach immer wieder. Wie eine Katze strich sie lautlos kreuz und quer durchs Atelier, manchmal mit einem dünnen Tuch um die Hüften, meistens nackt. Und Klimt konnte nicht umhin, sie zu beobachten, zu registrieren, wie sich ihr Körper langsam veränderte. So entstand »Die Hoffnung I«, das lebensgroße Aktbild der hochschwangeren Herma.
Die Dargestellte wirkt, als wäre sie sich ihrer Sache sicher – und das war Herma tatsächlich. Sie wusste, dass es für jeden Zustand auf dieser Welt verschiedene Erklärungen und Wahrheiten gibt, und so kam sie gar nicht auf die Idee, den Kohlenhändler Albert an seiner Vaterschaft zweifeln zu lassen. Albert wünschte sich ein Kind, seine Ehefrau Herma würde es für ihn zur Welt bringen, auf dass er sich an der Frucht seiner Lenden erfreuen könnte. Im Atelier des Herrn Klimt jedoch galt eben dieser als Vater des Kindes, ob er es nun anerkannte oder nicht.
Laut Taufschein hieß die Kleine Albertine, nach dem Ehemann-Vater Albert, im Atelier jedoch wurde sie auf Hermas Wunsch Serena genannt, nach der liebreizenden und reichen Serena Lederer, geborene Puchter, die Klimt im Jahr 1899 gemalt hatte.
Wenn Herma ins Atelier kam, brachte sie die Kleine mit, die schon als Baby sehr geschickt darin war, Zuneigung zu erwerben und zu erhalten. Instinktiv erfasste sie die Rangordnung der Menschen, und dass dieser bärtige Mann, dessen struppige dunkle Haarbüschel rechts und links der Stirnglatze wie Teufelshörner abstanden, dass dieser Teufelsmann also der Herr über das kleine Reich war, wusste sie schon, bevor sie richtig sprechen konnte. Sie reagierte darauf vor allem in dem komischen Bemühen, ihn zu imitieren. Eines der Mädchen hatte für sie eine kleine Staffelei gebastelt und ihr einen Zeichenblock und ein paar Stifte geschenkt. So stand sie bereits als Dreijährige in einer dunklen Ecke des Ateliers, gekleidet in ein altes Hemd von Albert, das bei ihr bis auf den Boden reichte – genau wie Klimts berühmter langer Malerkittel –, und strichelte mit konzentrierter Miene und flinken Fingern auf ihrem Zeichenblock herum. »Ganz der Papa!«, flüsterten die Mädchen lächelnd.
Als Serena fast vier Jahre alt war, wurde Herma wieder schwanger und diesmal gewiss nicht von Klimt. Der hatte sein Interesse an ihr längst verloren. Es war keine gute Schwangerschaft, Herma fühlte sich matt und krank, kam aber dennoch ins Atelier in der Hoffnung, durch ihren anschwellenden Leib das Auge des Meisters zurückzugewinnen, was allerdings nicht gelang.
»Kannst keinen Staat mehr machen mit deinem Körper«, sagte Klimt schließlich, »so wie du momentan ausschaust, gehörst du nicht ins Atelier. Also geh nach Haus und bleib da, du verdirbst hier die Stimmung.«
Und diesmal folgte sie seiner Aufforderung. »Ich hab’s ja auch gar nicht mehr nötig«, sagte sie gekränkt, »mein Mann beschäftigt inzwischen vier Arbeitsmänner. Und meine Serena, die nehm ich auch mit. Dann haben S’ eben kein Modell mehr, wenn’s mal um ein Kindchen geht.«
Aber das Kindchen wollte nicht weg. Es machte ein großes Geschrei und musste schließlich mit Gewalt fortgebracht werden. Am nächsten Tag aber kam die Kleine wieder, hatte ganz allein den Weg zurück in die Josefstädter Straße 21 gefunden. Die Mädchen waren gerührt, und sogar der Meister zeigte sich beeindruckt.
»Ein komisches kleines Ding«, sagte er, »sieht aus wie ein weiches Püppchen und hat dabei einen so stählernen Willen. Lasst sie also hier.«
Das ging so lange gut, bis eines Tages ein Holländer namens Hugo ten Broich im Atelier von Klimt erschien. Er war um die fünfzig, groß und dünn, mit schütteren grauen Haaren, mit Spitzbart und Pincenez und mit langen, knochigen Fingern, die nachlässig die Hunderter und gar Tausender hinblättern konnten. Er war durch die Kunstwelt gefahren wie ein Mann auf Freiersfüßen, der unter all den schönen Künsten nach der allerschönsten suchte, um sie zu freien. Und er war äußerst wählerisch. Die englischen Präraffaeliten und Nazarener zogen ihn an, und er besaß mehrere Rossettis und eine Version der klugen und törichten Jungfrauen von Burne-Jones. Letztlich jedoch wagte er nicht, sein ganzes Herz an sie zu hängen. »Das kitschige Element darin ist doch zu offensichtlich, das darf ich mir nicht gestatten«, sagte er. Die Glasgower mit ihrem Macintosh bewunderte er, aber sie waren ihm zu begrenzt. »Immer wieder diese säuberlich stilisierten Rosen, da sehnt man sich schließlich nach einem wilden Bauerngarten!« Eine Zeit lang hatte er für die Berliner Sezession geschwärmt und sich sogar von Liebermann porträtieren lassen, bis ihm ein Bild von Edvard Munch vor die Augen gekommen war, da hatte es ihn machtvoll nach Skandinavien getrieben, viel hätte nicht gefehlt, und er wäre dort geblieben.
Aber die schreckliche Verzweiflung in Munchs Seele war schließlich drauf und dran gewesen, den im Grunde wohl temperierten Geschäftsmann aus Holland mit eigener Verzweiflung zu infizieren, und so hatte sein Abschied von der nordischen Düsternis wohl eher einer Flucht geglichen als dem geordneten Aufbruch zu weiterer kultureller Information.
In Wien blieb er dann wirklich hängen. Besonders Klimts Zeichnungen hatten es ihm angetan, und er kaufte alles, was Klimt bereit war, ihm zu überlassen. Und ganz nebenbei begann er, sich auch mit der kleinen Serena zu beschäftigen.
Die inzwischen fast Fünfjährige mit ihrem untrüglichen Instinkt für Machtverhältnisse hatte sehr schnell begriffen, dass dieser Herr, der das Atelier nun fast täglich besuchte, in gewisser Weise dem Klimt überlegen war, denn der Maler duldete ihn nicht nur, er hofierte ihn sogar. Woraufhin Serena den Mann ebenfalls hofierte. Und es dauerte nicht lange, da stand sie nicht mehr malend hinter ihrer Spielzeugstaffelei, sondern saß bei Hugo auf dem Schoß. Und den zwar welterfahrenen, kunstklugen, in Gefühlsdingen jedoch sehr naiven und unschuldigen Menschen erfasste ein vollkommen unerwartetes Gefühl. Der alte Mann verliebte sich in das Kind und hätte es sich am liebsten gleich einem Kunstwerk angeeignet.
Herma erfuhr von einem der anderen Modelle, was sich im Atelier tat. Es ging ihr immer noch schlecht, doch nicht so sehr, dass sie die Situation zwischen Hugo und dem Kind nicht hätte erfassen und für sich nutzbar machen können. Sie verbot Serena, weiterhin ins Atelier zu gehen und sperrte das Kind zu Hause ein. Daraufhin schickte Hugo Caroline vor.
»Dieser holländische Herr hat nämlich keine Kinder«, begann Caroline das Gespräch mit Herma.
»Traurig für ihn«, sagte Herma ungerührt.
»Aber er hat ziemlich viel Geld«, fuhr Caroline fort, »und das würde er gern nutzbringend verwenden.«
»Tut er doch, er kauft Bilder.«
»Weiß ich. Aber Bilder sind kein Ersatz für Kinder, man kann sie nicht erziehen.«
Herma wurde ungeduldig. »Nun sag schon, was du willst.«
»Es ist so, dass er deine Albertine für hoch begabt hält. Er würde sie gerne erziehen.«
»Zu was?«
»Zu einer jungen Dame.«
»Die Tochter eines Kohlenhändlers kann nie eine junge Dame werden.«
»Aber die Tochter Gustav Klimts kann es – das meint der holländische Herr jedenfalls.«
»Wirklich?« Herma lächelte geschmeichelt. »Er hält sie für Klimts Tochter?«
»Das tun wir doch alle!«, sagte Caroline enthusiastisch.
»Also gut. Ich hab ja schon immer gedacht, dass meine Serena Besseres verdient hat. Obgleich … es war doch wohl nicht richtig, wenn die Kleine zukünftig in Saus und Braus leben soll, während bei der Mutter nach wie vor Schmalhans Küchenmeister ist.«
»Ich dachte, dein Albert verdient inzwischen genug?«
»Lass den Albert aus dem Spiel, der ist nicht verantwortlich. Weil ich doch … hast du ja selbst eben gesagt! Bloß, dass der feine Herr von Klimt nie was für mich getan hat.«
»Aber der Holländer, der würde nun gerne etwas für dich tun. Wie war’s mit zwanzig Schilling pro Tag.«
»Fünfzig«, sagte Herma schnell, »darunter geb ich mein Kind nicht in fremde Hände.«
Sie einigten sich auf dreißig Schilling pro Wochentag, unter der Bedingung, dass Serena die Sonntage stets zu Hause verbringen müsste. »Albert und ich wollen schließlich den Kontakt nicht verlieren«, sagte Herma.
Hugo war für Carolines Vermittlung sehr dankbar. Er hoffte, durch das finanzielle Arrangement seinen beängstigenden Gefühlen eine solide Basis geben zu können und machte sich, eifrig wie ein junger Bräutigam, sogleich an die Organisation seines neuen Lebens. Er gab seine Junggesellenwohnung auf und bezog im Ersten Wiener Bezirk am Ring eine helle, große Wohnung, in der er dem Kind ein zweites Zuhause bereiten wollte. Da er sich immerhin zu der Meinung bequemte, das kleine Mädchen brauchte neben der erzieherischen Liebe seines Ziehvaters auch noch die lenkende Hand einer Frau, bat er die inzwischen zweiundzwanzigjährige Caroline zu ihm zu ziehen und diesen Part in Serenas Leben zu spielen. Und Caroline, die schon lange vor Hugo Serenas Charme verfallen war, willigte glücklich ein.
Hermas Baby wurde dann per Kaiserschnitt geboren, es war ein Junge, und er lebte nur ein paar Tage. Herma war außer sich vor Kummer. Da ihr nichts anderes einfiel, suchte und fand sie Trost in der Kirche.
Albert hingegen war vor allem zornig, »Da kriegt man nun endlich einen Sohn, und dann stirbt er einem gleich wieder weg.«
»Du hast ja mich, Papa«, tröstete Serena.
»Nicht wirklich. Deine Mutter sagt, du musst eine junge Dame werden.«
»Aber doch nur unter der Woche. Am Sonntag bin ich bei dir.«
Serena gab sich große Mühe, für Albert ein ebenso gutes Töchterchen zu sein wie für Hugo.
Allerdings konnte sie es nicht leiden, wenn er sie nach dem Mittagessen, wenn Herma in die Küche gegangen war, um den Abwasch zu machen, mit seinen nie ganz sauberen Händen zu sich auf den Schoß zog.
»Caroline schimpft, wenn mein Sonntagskleid dunkle Flecken kriegt«, sagte sie.
»Was geht mich Caroline an!«, sagte er. »Du gehörst zu mir, und ich kann’s mir inzwischen leisten, dir selbst ein schönes Kleid zu kaufen, sogar zwei, wenn du eine gute Tochter bist.«
Serena-Albertine wusste sehr wohl, dass Albert die Macht hatte, ihrem anderen Leben ein Ende zu bereiten. Und da ihr inzwischen Hugos große Wohnung sehr angenehm war – sie liebte die weichen Teppiche und die Badewanne mit den vergoldeten Füßen, liebte ihre Spielsachen und liebte wohl auch Hugo –, nahm sie dafür Alberts Kohlenhändlerhände in Kauf und blieb nach dem Mittagessen brav auf seinem Schoß sitzen, bis er eingeschlafen war. Dann allerdings schlüpfte sie umgehend aus seinen Armen und lief in die Küche, um für Herma das Geschirr abzutrocknen.
Auf Carolines Anraten bot Hugo für die Sonntage den doppelten Tagespreis, leider jedoch ohne Erfolg. Zwar hätte sich Herma, die jetzt für die Bekehrung eines Negerknäbleins sparte, gern auf den Handel eingelassen, aber Albert bestand auf seinen väterlichen Rechten.
»Was machst du denn so am Sonntagnachmittag?«, fragte Caroline.
»Ich spiel mit meinem Papa ›Mensch ärgere dich nicht‹«, sagte Serena.
Die Spiele, in die Hugo sein Ziehtöchterchen verwickelte, waren anderer Natur: Konservatorium, Ballettunterricht und bald auch neben der privaten Grundschule ein Hauslehrer für Englisch und Französisch. Serena kam Hugos Ansprüchen genauso gutwillig nach wie denen Alberts.
Daneben verbrachte sie nach wie vor viele Stunden im Atelier bei Klimt, der sie inzwischen nicht nur duldete, sondern dazu übergegangen war, wohl angeregt durch Hugo ten Broichs Interesse, ihr höchstpersönlich Zeichenunterricht zu geben.
»Du musst nämlich wissen, dass der Herr von Klimt dein eigentlicher Vater ist«, flüsterten ihr die Mädchen hinter vorgehaltener Hand zu.
»Das weiß ich doch längst«, sagte das Kind.
So pendelte Albertine-Serena zwischen ihren Welten hin und her, sie passte nicht nur ihre Vornamen den jeweiligen Situationen an, sondern auch die Sprache, die Gesten, ja ihr ganzes Verhalten. Geschickt hielt sie auseinander, was nicht zusammengehörte, und sie verwechselte ihre Rollen nie. Im Laufe der Jahre gelang es ihr, sich auf die liebenswürdigste Weise von ihrem Namensgeber zu distanzieren, in ihrem Lehrer Gustav Klimt endlich Vatergefühle zu erwecken und ihrem Ziehvater Hugo ein pädagogisches Erfolgserlebnis nach dem anderen zu bereiten.
Caroline war ihr dabei eine große Hilfe. Sie hielt sich stets im Hintergrund, doch wirkte sie durch ihre bodenständige Art wie ein Sprungtuch, das der Heranwachsenden bei ihren Lebenskunststücken die nötige Sicherheit gab. Nur bei Caroline konnte Serena sich schwach zeigen, und sie nutzte das gründlich aus, weil sie genau wusste, dass Caroline, komme, was da wolle, unverbrüchlich auf ihrer Seite stehen würde.
»Ich hab langsam keine Lust mehr zu dem ewigen ›Mensch-är-ger-dich-nicht‹ am Sonntag«, murrte die Zehnjährige.
»Verständlich. Aber Albert könnte dir große Schwierigkeiten bereiten!«
Die Zwölfjährige jammerte über den ständigen Hausunterricht, den sie neben der Schule zu absolvieren hatte.
»Wenn du erwachsen bist, machen wir beide große Reisen miteinander«, tröstete Caroline, »dann wirst du für mich übersetzen.«
Und die Dreizehnjährige erklärte ihrer mütterlichen Freundin allen Ernstes, dass der Klimt ihr nichts mehr beibringen könne. »Inzwischen bin ich nämlich ebenso gut wie er!«
Caroline sah sie nur an und holte ihr Serenchen durch anhaltendes Gelächter auf den Boden der Tatsachen zurück. »Sei froh, dass er sich überhaupt mit dir befasst!«, sagte sie. »Er gehört nämlich zu den ganz Großen, aber du bist nur eine begabte kleine Nachahmerin.«
»Und du verstehst überhaupt nichts von Malerei!«, tobte Serena, doch fiel Carolines Bemerkung auf sehr fruchtbaren Boden und sollte dort starke Wurzeln schlagen.
Einmal, als der Meister besonders guter Laune war, veranstaltete er mit ihr ein Wettzeichnen. Das gutmütige, dicke Aktmodell Henriette musste sich aufrecht hinstellen, Beine leicht gespreizt, Hände locker auf den Oberschenkeln. Auf die Plätze, fertig, los. Lachen, Schreien, aufmunternde Rufe der anderen Mädchen. Klimt machte Witze, jonglierte mit seinem Stift, benutzte abwechselnd die rechte und die linke Hand und versuchte es sogar mit geschlossenen Augen. Serena hingegen zeichnete voll verbissenem Eifer, korrekt und ohne jede Ironie, dabei mit zielstrebiger Geschwindigkeit. Bis sie dann zu den Händen kam, da stockte sie, wischte, korrigierte und versuchte es von neuem – Klimt konnte sie lässig überholen und den Sieg davontragen.
»Und natürlich war es gerecht«, gestand Serena später Hugo, »er kann’s einfach besser, der Herr Klimt, sogar mit all seinen Faxen. Aber ich war schneller – ehrlich! Bis auf die Hände … da ist mir nämlich eingefallen, dass er einmal gesagt hat: ›An den Händen erkennt man den Meister!‹ Und da konnte ich dann plötzlich nicht mehr weiterzeichnen.«
»Aha«, sagte Hugo, »und was hat er noch gesagt?«
»Dass von den Händen oft mehr ausgeht als vom übrigen Körper und dass man mit den Händen alles ausdrücken kann. Und dann hat er auch noch gesagt, dass der beste Händekünstler, den er kennt, der Egon Schiele ist.«
Hugo, dem der so leidenschaftliche wie verrückte Schiele unheimlich war, wehrte ab: »Bei dem sehen die Hände doch immer gleich aus, lange, dünne Glieder und knochige Gelenke. Absolut keine Variationsbreite.«
Dennoch versuchte er umgehend, den jungen Verrückten für einen speziellen Zeichenunterricht zu engagieren. Und Schiele, stets in Geldnöten, sagte zu.
»Aber nur die Hände, wenn ich bitten darf«, sagte Hugo. »Und zwar jede Art von Händen, kleine, große, kluge, dumme, gierige, großzügige, schwache, wütende Hände und sonst nichts. Der Gustav Klimt hält viel von Ihren Fertigkeiten, und ich wünsche mir, dass Sie diese an meine Tochter weitergeben.«
Serena betrachtete voller Interesse den hageren, glutäugigen Mann, von dem sie bereits manches für junge Mädchen nicht ganz Passende gesehen und gehört hatte. Sie knickste brav, doch bevor sie ihm noch die Hand reichen konnte, zog Hugo sie energisch an den Zeichentisch. »Also dann«, sagte er.
Schieles Blick traf den des jungen Mädchens, ein glühender Blick, dessen Strahlwirkung Serena überrascht in ihrem ganzen Körper spüren konnte. Leider war es das einzige Mal, dass er sie so direkt ansah, von da an galten seine Blicke einzig ihren zeichnenden Händen.
»Dass du auf gar keinen Fall dem Mann je erlaubst, deine Hände zu berühren!«, hatte Hugo sein Töchterchen gewarnt, und um Schlimmes zu verhindern, war er bei den Unterrichtsstunden stets anwesend, schweigend saß er in einer Ecke und bewachte Lehrer und Schülerin. Serena fand das zwar lustig, aber vor allem doch seltsam aufregend. Und als er einmal während des Unterrichts kurz aus dem Zimmer gerufen wurde, streckte sie sofort sanft lächelnd ihrem Lehrer beide offenen Hände entgegen. Der nahm sie, und sie spürte erneut diesen heißen Strom, viel intensiver noch als beim ersten Mal, als einzig sein Blick der Auslöser gewesen war. Der Mann atmete schwer, Serena ebenfalls, und als Hugo wieder hereinkam, wirkten Lehrer und Schülerin, als wären sie beide einer Ohnmacht nahe.
Selbstverständlich kündigte Hugo ten Broich daraufhin den Lehrvertrag, doch hatte Schiele zuvor Zeit genug gehabt, Serena beizubringen, was alles man mit den Händen ausdrücken kann. Und Hugo redete niemals mehr über die mangelnde Variationsbreite von Egon Schieles Umgang mit Händen.
Stattdessen verkündete er, dass Serena mit ihren vierzehn Jahren zu alt sei, im Klimtschen Atelier weiterhin das Kindchen zu spielen und an den Wochenenden dem Kohlenhändler Albert schönzutun. Ihr Leben müsse nun eine altersgemäße Wende nehmen.
Serena, die die verschiedenen Notwendigkeiten und Vorteile besser übersah als Hugo, wehrte sich. Doch bevor es noch zu einem ernsten Konflikt kommen konnte, geschah das Unvorhersehbare und bereitete Serenas Tripelexistenz und damit ihrer Kindheit ein Ende.
Am elften Januar 1918 erlitt Gustav Klimt frühmorgens in seiner Wohnung in der Westbahnstraße 26 einen Schlaganfall, der ihn halbseitig lähmte. Er wurde in das Sanatorium Löw gebracht, und Serena beschloss, ihn dort zu besuchen.
Hugo war dagegen. »Der Mann liegt im Sterben, nur seine engste Familie hat Zugang.«
»Ich bin seine Tochter!«
»Meines Wissens hat er sich nie zu dieser angeblichen Vaterschaft geäußert. Also belaste ihn nicht noch auf seinem Totenbett mit emotionalen Forderungen.«
»Das ist eine sehr persönliche Sache zwischen Klimt und mir. Tut mir Leid, Onkel Hugo, aber dein angebliches Wissen hat damit überhaupt nichts zu tun.«
Serena ging also ins Sanatorium und traf vor der Tür zum Krankenzimmer auf Klimts langjährige Gefährtin Emilie Flöge, die das junge Mädchen misstrauisch beäugte. Beide wussten natürlich voneinander, gaben jedoch vor, sich nicht zu kennen.
>
»Was wollen Sie hier?«, fragte Emilie unfreundlich.
Serena knickste wohlerzogen. »Ich möchte gern den Herrn Kunstmaler besuchen.«
»Das kann ich leider nicht gestatten. Sein Zustand erlaubt ihm nicht, Besuche zu empfangen.«
»Dann sind Sie sicher seine Gattin?«, fragte Serena, die im Atelier viele boshafte Geschichten gehört hatte über Emilies erfolglose Bemühungen, ihren Jugendfreund Gustav zur Ehe zu bewegen. »Es tut mir so schrecklich Leid für Sie!«
Emilie warf Serena einen giftigen Blick zu. »Es ist doch wohl allgemein bekannt, dass der Meister es vorgezogen hat, Junggeselle zu bleiben. Und sowieso wüsste ich nicht, was das mit seiner momentanen Kondition zu tun haben soll.«
Serena lächelte entschuldigend. »Überhaupt nichts, verzeihen Sie bitte. Ich hatte nur Sorge, Ihnen noch zusätzlichen Kummer zu bereiten. Aber wenn Sie nicht seine Frau sind, dann kann ich’s Ihnen ja auch freiweg gestehen: Ich bin nämlich seine Tochter. Und darum habe ich doch gewiss vor allen anderen das Recht, mich von ihm zu verabschieden.«
Mit diesen Worten schob Serena sich an der konsternierten Emilie vorbei und schlüpfte ins Krankenzimmer. Die Tür verriegelte sie von innen.
Als sie Stunden später aus dem Sanatorium zurückkam, war sie zwar sehr aufgewühlt, doch gleichzeitig strahlte sie ein neues Selbstbewusstsein aus.
»Er hat mir gesagt, dass ich für ihn schon immer seine einzige wahre Tochter gewesen sei, dass er es nur nicht hätte öffentlich machen können, um die Emilie nicht zu betrüben«, sagte sie.
»Dann wird es jetzt wohl nie mehr öffentlich werden«, erwiderte Hugo bissig.
»Wozu auch«, sagte sie, »Hauptsache er und ich wissen es.«
Klimt starb am sechsten Februar, und zwar allein. In der Folge beanspruchten vierzehn illegitime Kinder sein Erbe. Selbstverständlich war Serena nicht darunter – das hatte Hugo verhindert. Die vierzehn Illegitimen wurden ohnehin nicht anerkannt, das Erbe wurde aufgeteilt zwischen Klimts beiden Schwestern und Emilie.
»Die Flöge muss sich auch immer in den Vordergrund drängeln«, sagte Serena ärgerlich. »Was ist die denn schon – eine Schneiderin!«
Hugo, der es nicht leiden konnte, wenn Serena sich hochmütig gab, korrigierte sie: »Eine geniale Modeschöpferin ist sie. Eines Tages wirst du vielleicht froh sein, ein Kleid von ihr tragen zu dürfen.«
Klimts Tod war nur der Anfang eines langen Totenreigens, denn nach dem Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen fiel nun auch noch die Spanische Grippe über Europa her – siebenundzwanzig Millionen Tote. Die Wiener Sezession verlor ihre wichtigsten Mitglieder – Klimt starb am sechsten Februar, Otto Wagner im April, Koloman Moser und Egon Schiele starben im Oktober. Trauer, Verzweiflung, schöne Totenreden, gereimt und ungereimt. Unter den siebenundzwanzig Millionen waren auch zwei Menschen, denen niemand eine Rede hielt: Der Kohlenhändler Albert aus dem 14. Bezirk und Herma, die kuhäugige Schwangere von der Hoffnung I.
»Ich hatte drei Väter«, sagte Serena, »das war doch manchmal etwas anstrengend. Zwei sind gestorben, wie gut, dass mir der beste geblieben ist.«
Eines von Klimts letzten Bildern, »Adam und Eva«, von 1917 zeigt die dreizehnjährige Serena. Die lockigen Haare hängen ihr bis zur Taille, um den Mund hat sie ein winzig kleines verführerisches Lächeln, am Körper jedoch hat sie nichts als ihre jugendliche Haut. Sie steht also da in ihrer ganzen Pracht, und als Hugo, der sanfte, zurückhaltende, höfliche Hugo es sah, bekam er einen regelrechten Wutanfall. Serena jedoch blieb ganz ruhig. Voller Interesse betrachtete sie den tobenden Mann und sagte schließlich: »Aber Onkel Hugo, mein Lieber, worüber regst du dich denn so schrecklich auf? Das ist zwar mein Gesicht, aber es ist absolut nicht mein Körper. Oder willst du vielleicht behaupten, dass ich derartig breite Hüften und fette Oberschenkel habe?«
Das verschlug Hugo die Sprache. »Woher soll ich denn wissen, wie genau deine Hüften und Oberschenkel aussehen!«, stöhnte er.
»Natürlich, das kannst du nicht wissen«, sagte Serena, »aber ich zeig’s dir gerne, damit du dich nicht weiter aufregen musst.« Und sie begann ganz umstandslos, ihr Kleid aufzuknöpfen.
Da stieß Hugo einen Fluch aus und verließ Türen schlagend das Zimmer. Und Serena sah hinter ihm her, knöpfte ihr Kleid wieder zu und sagte: »Der arme Hugo!«
Das war der Tag, an dem sich Hugos Verhalten gegenüber Serena änderte, er behandelte sie nicht mehr wie ein Kind, sondern wie eine junge Frau. Und Serena nannte ihn auch nie wieder Onkel.
Niemand wusste etwas Genaues über Hugos Herkunft, seinen Familienstand, den Ursprung seines Reichtums. Innerhalb Wiens pflegte er keine Beziehungen und war auch keiner Gruppe zugehörig: Er war kein Jude, er war kein Aristokrat, er war keiner von den traditionell Besitzenden. Ein reicher Ausländer, der erst durch seine Bewunderung Gustav Klimts für die Wiener überhaupt existent geworden war. Und da sie sich nicht zufrieden geben wollten mit einem Mann ohne Vergangenheit, dichteten sie ihm eine an, so anrüchig wie möglich: heimlicher Sklavenhandel in der Südsee, Börsenmanipulationen in den USA, afrikanische Diamantenminen, in denen die armen Neger nie das Tageslicht erblickten. Und dazu noch eine Ehe in Holland mit einem Haus voller Kinder, um die er sich nicht kümmerte. Dieser Mann also hatte sich ein kleines Mädchen gekauft, das inzwischen kein kleines Mädchen mehr war – man musste den beiden ja nur dabei zuschauen, wie sie einander schöntaten.
Manchmal verschwand Hugo ten Broich allein und mit ungenanntem Ziel. Dass er von diesen Reisen stets ein weiteres Kunstwerk mit nach Hause brachte, hielten die Wiener für Verschleierung. Hinter Kunst konnte man vieles verbergen.
Mit Serena erlebte Hugo ten Broich die glücklichste Zeit seines Lebens. Sie zeigte wenig Bedürfnis, die Gepflogenheiten heiratsfähiger junger Mädchen zu imitieren, ihr reichte Hugos Liebe vollkommen, eine Liebe, deren Ausschließlichkeit sie sehr wohl begriff. Hugo zu Gefallen wurde sie eine gebildete junge Dame und eine Expertin in Sachen bildende Kunst. Ihm zuliebe wäre sie wohl auch gerne eine eigenständige Malerin oder Bildhauerin geworden, zumal sie spürte, wie sehr es ihn danach verlangte, in ihr nicht nur seine Schöpfung, sondern dazu noch eine eigenständige Schöpferin zu sehen.
»Du musst dich doch nur weit genug öffnen«, sagte er, »dann wird dir schon etwas einfallen, etwas Eigenes und Originelles, etwas, das ganz und gar du selber bist.«
So saß sie manchmal stundenlang in ihrem Zimmer, öffnete sich so weit es irgend ging, und alles, was ihr in den Kopf kam, waren zuvor mit Hugo erlebte Kunstwerke, waren die Gemälde der italienischen Renaissance, waren die Niederländer, die Romantiker, waren auch immer wieder Werke von Klimt und Schiele. Sie fand, dass es weiß Gott schon genug Bilder auf der Welt gäbe und dass sämtliche Motive bereits erschöpfend verarbeitet worden wären. Und wenn sie sich dann, wieder Hugo zuliebe, daran machte, etwa eine Madonna mit Kind zu malen, wobei sie der Madonna ihre eigenen Züge geben wollte, dann sah es später eben doch nur wieder so aus, als hätte sie einen El Greco oder einen Botticelli abgemalt – die Technik dafür beherrschte sie ja.
»Es ist eben leider so«, sagte sie zu Caroline, »dass meine Netzhaut bereits voll besetzt ist mit alldem, was Hugo dort unbedingt ansiedeln wollte. Was ich einmal gesehen habe, das werde ich eben nicht wieder los.«
Im Jahr 1922 konnte Hugo nicht länger übersehen, dass sein Vermögen erheblich geschrumpft war.
Zwar hatte er am Krieg noch kräftig verdient, doch war dann die Inflation vernichtend über seine Rücklagen hergefallen, was ihn, im Hinblick auf seine Haupteinnahmequellen, nämlich den Erzabbau und die Holzwirtschaft in Brasilien, nicht allzu sehr beunruhigt hatte. Als diese Quelle dann allerdings plötzlich und unerwartet zu sprudeln aufhörte – man hatte ihm in Brasilien ganz einfach den Hahn zugedreht –, traf ihn dies doch sehr spürbar.
Wäre er, so wie in früheren Jahren, immer noch an finanziellen Eroberungen interessiert gewesen, hätte er sich wohl dem Kampf gestellt, wäre umgehend nach Südamerika gereist und hätte sich die Aussperrung, die von seiner dortigen Familie inszeniert worden war, nicht bieten lassen.
So jedoch, mit der aufblühenden Serena an seiner Seite, hatte er den Sinn für finanzielle Machtspiele verloren.
»Wir werden uns einschränken müssen«, sagte er.
»Warum denn?«, fragte Serena.
»Weil mir inzwischen die Lust am Geldverdienen abhanden gekommen ist.«
»Schade«, sagte Serena. »Ich fand es sehr angenehm, reich zu sein.«
»Mach dir keine Sorgen, Kind. Wir werden in eine etwas bescheidenere Wohnung umziehen und nicht mehr so viel für überflüssigen Luxus ausgeben, das ist alles.«
»Schade«, sagte Serena noch einmal und verließ das Zimmer.
Während der nächsten zwei Jahre zogen sie dann viermal um. Serena flehte Hugo an, doch wieder etwas Lust und Leidenschaft fürs Geldverdienen zu entwickeln. Doch Hugo sagte nur: »Unmöglich, alle meine Energien sind anderweitig festgelegt.«
Serena wusste sehr wohl, was er damit meinte, und zum ersten Mal fand sie, dass er es mit ihr doch etwas übertrieben hätte.
Abends saß er nun oft am Küchentisch, vor sich eine Mappe mit Zeichnungen. »Komm zu mir, mein Töchterchen«, sagte er, »bring deinem besten Vater ein Glas Bier.«
»Du solltest ein paar Zeichnungen verkaufen«, sagte Serena.
»Ganz im Gegenteil. Ich sollte versuchen, noch ein paar Zeichnungen dazu zu kaufen. Ich bin kein Kunsthändler, sondern ein Sammler. Und das werde ich auch bleiben.«
»Aber dafür haben wir kein Geld.«
»Was ist schon Geld, gemessen an künstlerischen Kostbarkeiten. Ich habe mich mein Leben lang gewundert, dass man mit Geld tatsächlich Kunst erwerben kann.«
»Womit denn sonst, Hugo«, sagte sie ungeduldig.
Er zog sie an sich. Das tat er jetzt sehr viel öfter und ungezwungener als früher.
»Ich werde mir etwas einfallen lassen«, sagte er tröstend.
Serena machte sich von ihm los. »Ich mir auch.«
Er schmunzelte über ihren entschlossenen Tonfall. »Was denn?«
»Ich könnte zum Beispiel heiraten, einen reichen Mann. Der würde mit mir in ein großes Haus ziehen, und du bekämst dort deine eigenen Zimmer. Und er würde dir genügend Geld geben, damit du weiter sammeln kannst.«
»Dich werde ich genauso wenig verkaufen wie meine Zeichnungen«, sagte Hugo. »Aber ich habe eine andere Idee. Vor ein paar Tagen nämlich habe ich Emilie Flöge getroffen.«
»Die Schneiderin?«
»Die Modeschöpferin. Sie ist im Besitz einiger Zeichnungen, für die ich … also die in mir das alte Feuer noch einmal entfacht haben. Und die Flöge wäre tatsächlich bereit, sie mir zu überlassen.«
»Nur dass du ja leider kein Geld hast«, sagte Serena.
»Aber ich habe dich. Würdest du mir bitte noch ein Glas Bier bringen?«
Als Serena das Glas vor ihm absetzte, legte er wieder den Arm um ihre Taille. »Dich habe ich doch, oder …?«
Serena machte sich steif. »Du hast mich, Hugo. Aber ich will nicht, dass du mich, nur weil wir jetzt arm sind, anfasst wie Albert es manchmal getan hat.«
Hugo zuckte zurück. »Was hat Albert getan?«
»Albert ist seit vier Jahren tot. Ich habe ihn schon fast vergessen, und ich will nicht, dass du mich an ihn erinnerst. Erzähl mir lieber von der Frau Flöge. Ich wollte schon immer gerne ein Kleid von ihr haben.«
Serena setzte sich Hugo gegenüber an den Tisch und sah ihn erwartungsvoll an. »Also …«
»Nie im Leben kann es mit mir so sein wie bei Albert!«, murmelte Hugo.
»Hab ich das etwa behauptet? Nun erzähl mir, was du mit der Frau Flöge besprochen hast.«
»Dass sie … dass du … also dass sie dringend jemanden braucht, der ihre Kleider vorführt. Jemanden von natürlicher Eleganz, der graziös ist und selbstsicher, der alles richtig macht und der zum Kaufen anregt, dabei jedoch vollkommen unprofessionell wirkt, also jemand, der es aus Spaß tut, aus Freude an der Sache, aus … jedenfalls nicht für Geld, sondern …«
»Sondern eventuell für eine kleine Klimt-Zeichnung?«, vollendete Serena den Satz und lachte. »Du willst mich also doch verkaufen.«
Hugo war dankbar für ihr Lachen und versuchte einzustimmen. »Nicht verkaufen, nur kurzfristig verleihen.«
»Das klingt doch alles sehr vernünftig«, sagte Serena, »aus Spaß und Freude und für die Sammelleidenschaft. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Frau Flöge mich einstellen will. Sie mag mich nämlich nicht.«
»Unsinn. Sie weiß doch überhaupt nichts von dir!«
»Aber sie weiß, dass ich Klimts Tochter bin.«
Hugo lachte etwas gequält. »Ach Serenchen, könntest du nicht diese alte Geschichte endlich begraben?«
»Könnte ich schon, wenn die Flöge es kann. Aber du wirst schon sehen, sie nimmt mich nicht.«
Da irrte Serena. Emilie Flöge war eben alles andere als eine kleine Wiener Schneiderin. Sie stammte nicht nur aus einer gutbürgerlichen Familie – ihr Vater betrieb eine Fabrik für Meerschaumpfeifen –, sie war auch eine kluge Geschäftsfrau, in deren Werkstatt über achtzig Frauen arbeiteten. Ihr Verhältnis zu Klimt hatte ihr – neben der Frustration, nur seine Freundin, nicht aber seine Gattin zu sein – viele Vorteile eingebracht, vor allem war sie durch des Meisters Stoff- und Kleiderentwürfe aufgestiegen von einem reinen Handwerksbetrieb in die Höhen künstlerischen Anspruchs. Zu dem Gesamtkunstwerk eines engagierten Lebens, wie es die Sezession propagierte, gehörte eben auch die passende Kleidung.
Natürlich wusste Emilie, dass ihr Freund den Modellen im Atelier nicht nur künstlerisch zugetan gewesen war, das fand sie zwar überflüssig, doch es betraf sie nicht weiter. Diese Mädchen bewegten sich mitsamt ihrer Nachkommenschaft in einem vollkommen anderen Milieu. Es gab keine Berührungspunkte.
Diese Albertine Schwarzbach jedoch – den meisten Kunstinteressierten war sie bereits als Serena ten Broich bekannt – hatte sich nicht an die alten Klasseneinteilungen gehalten. Eine junge Dame war sie geworden, aufgewachsen in einem Luxus, den Klimt ihr gewiss nie hätte bieten können, falls er’s denn gewollt hätte. Nun allerdings war dem verliebten alten Hagestolz ten Broich das Geld ausgegangen, und das kleine Fräulein musste selbst etwas zu seinem Lebensunterhalt beitragen. Welch eine Gelegenheit für Emilie. Sie würde die hurenhafte Mutter in der Tochter strafen und dem Mädchen das Leben so schwer wie möglich machen.
Serena aber ließ überhaupt nichts mit sich machen. Schon als sie das erste Mal in den Salon in der Mariahilferstraße kam, trat sie auf wie jemand, der sich einzig aus Spaß mit schönen Kleidern beschäftigte. Emilies Versuchen, sie zu verunsichern oder gar zu schikanieren, begegnete sie mit einem derartig ungläubigen Lächeln, dass die im Grunde ihrer Seele freundliche Frau gar nicht anders konnte, als einen Rückzieher nach dem anderen zu machen.
»Sie wollen doch nicht wirklich, dass ich ausgerechnet dieses Kleid hier vorführe«, sagte Serena etwa, »es passt doch überhaupt nicht zu mir, und es tut auch Ihrer Schneiderkunst keine Ehre.«
Serena hatte einen untrüglichen Sinn für das, was ihr stand. Führte sie ein Kleid vor, waren die Kunden davon meist so angetan, dass sie kaum noch auf den hohen Preis achteten. Die Kleider jedoch, die Serena für unangemessen hielt, verloren plötzlich jedes Flair und wurden unverkäuflich.
Emilie begriff schnell, dass ihr die Kooperation mit dem schönen Kind sehr viel mehr einbrächte, als die Befriedigung eines kleinlichen Rachebedürfnisses, und so strich sie den ganzen »Hoffnung-I-Komplex« aus ihrem Gedächtnis, was letztlich auch ihrem Geschmack entsprach: Sie hatte das Bild von Anfang an als peinlich und dem Genie ihres Freundes nicht angemessen empfunden.
Serena ihrerseits war klug genug, ihre zweifelhafte Herkunft nie wieder zu erwähnen. Sie war einzig und allein die Ziehtochter des Kunstliebhabers Hugo ten Broich, dessen Verehrung für Gustav Klimt ihn mit Emilie verband.
Angetan mit dem jeweils allerschönsten Flöge-Modell, schlenderte Serena nun Tag für Tag durch die von den Wiener Werkstätten eingerichteten Empfangsräume, sie gab sich lässig und in Anwesenheit der Ehegatten oder Freunde von Emilies Kunden auch mal lasziv, sie richtete es stets so ein, dass die oft unentschlossenen Käufer sie mehrmals sahen, indem sie so tat, als hätte sie in dem Raum etwas zu erledigen. Manchmal fragte sie auch, ob sie vielleicht einen Mokka bestellen könnte oder ein Tässchen Schokolade, und wenn sie dann einschenkte, schlug sie entweder die Augen schüchtern nieder – sie wusste, dass sie sehr schöne, bläulich schimmernde, fast durchsichtige Lider hatte –, oder sie bedachte den jeweiligen Mann mit einem verführerischen Lächeln und kam ihm beim Einschenken so nahe, dass er ihr Parfüm riechen konnte.
Als Provision für verkaufte Roben brachte Serena nun monatlich eine oder zwei Klimt-Zeichnungen nach Hause. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie etwas für Hugo tun, und das machte sie genauso glücklich wie ihn.
Jeden Vormittag verließ sie leichten Herzens ihren besten Vater und Caroline, um sich in den luxuriösen Salon Flöge zu begeben, wo alles luftig, offen, klar und sehr wohl durchdacht war. Der große Vorführraum mit den spiegelnden Vitrinen voller Spitzen und Stickereien, dazwischen die von Koloman Moser entworfenen Figurinen, zusammengeklebt aus getunktem Papier. Die Wände waren mit hellgrauem Filz bespannt, der dem Licht alle Grellheit wegschluckte und dadurch auch den Älteren und weniger Hübschen schmeichelte. Hinter dem Vorführraum lag das in schlichtem Schwarzweiß gehaltene Comptoir und auf der anderen Seite der Empfangsraum mit den hohen Sesseln und Hockern und dem großen Drachen über dem Gaskamin.
Serena hielt sich am liebsten im Comptoir auf. Sie hatte noch keine Lichtschmeicheleien nötig, ganz im Gegenteil, die strenge Linienführung und die harten Kontraste des Raumes brachten ihre immer noch kindliche Weichheit besonders gut zur Geltung.
An dem Tag, als Rudolf Max Magnussen, Junior eines alten Hamburger Werftbetriebes, im Schlepptau seiner gegenwärtigen Geliebten im Salon Flöge auftauchte, trug Serena ein so genanntes Gartenkleid, gefertigt aus zartem, weißem Mousseline. Als reizvollen Gegensatz zu dem anschmiegsamen Material hatte es eine strenge, aus schwarzen und weißen Quadrätchen à la Hoffmann zusammengesetzte Passe mit einem hohen steifen Stehkragen.
Serena begegnete dem Paar im Empfangsraum, brachte dem heftig rauchenden Fräulein einen Aschenbecher, stellte Mokka in Aussicht, beachtete den jungen Mann kaum, lächelte der munteren Dame jedoch schwesterlich zu und entfernte sich dann in Richtung Comptoir, wobei ihr der hohe Stehkragen eine aufrechte, nahezu hochmütige Kopfhaltung abverlangte, während der fast durchsichtige Stoff ihre langen Schenkel und den kleinen »intelligenten Hintern«, das Erbstück ihrer Mutter, wirkungsvoll zur Geltung brachte.
An der Tür blieb sie kurz stehen und wandte sich zurück. Da traf sie Rudolfs Blick, ein hingebungsvoller und unverstellt besitzergreifender Blick. Verstört und fast ängstlich schloss sie die Augen und verschwand.
»Was ist denn, Kind?«, fragte Emilie.
»Der hat mich angesehen, als ob er mich in der nächsten Minute in sein Bett zerren wollte.«
»Das kann ich kaum glauben. Mir erschien er höflich und zurückhaltend.«
»So darf aber kein Mann eine Frau ansehen!«
Emilie lächelte nachsichtig. »Ach Kind … also geh wieder rein und ignorier seine Blicke. Mit der jungen Frau allerdings solltest du dich verbünden. Sie scheint ganz wild darauf zu sein, das Geld des jungen Mannes auszugeben.«
»Ich möchte bitte lieber hier bleiben«, Serenas Stimme klang, als müsste sie gleich weinen.
»Also gut, ich hol dir ein Glas Wasser und werde mich dann selbst um die Kunden kümmern«, sagte Emilie.
Kaum war sie gegangen, betrat Rudolf Max Magnussen das Comptoir. »Während man an der Dame Maß nimmt«, sagte er, »würde ich gerne hier mit Ihnen die Preise und Zahlungsbedingungen aushandeln.«
Serena sprang auf. »Die Bedingungen …«, stammelte sie, »die Preise …«
Rudolf räusperte sich. »Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Frau Flöges Tochter sind?«
»So ungefähr«, flüsterte Serena.
»Dann werden Sie doch sicher die Preise kennen.«
Serena schüttelte den Kopf. Ihre Augenlider flatterten.
Rudolf Max Magnussen bewegte sich auf sie zu, behutsam, als wäre sie eine Libelle, die sofort abschwirren könnte. Serena wich nicht vor ihm zurück.
»Reden wir nicht mehr über Preise«, sagte er in geschäftlichem Tonfall, »ich bezahle, was verlangt wird. Essen Sie gern Tafelspitz? Der soll im Sacher besonders gut sein.«
»Tafelspitz?«, sagte Serena, als könnte sie sich nicht an den Sinn des Wortes erinnern.
»Wäre Ihnen morgen Abend um acht Uhr recht? Ich würde Sie dann hier im Salon abholen.«
»Nicht hier. Fräulein Emilie mag so etwas nicht.«
»Also dann von daheim.«
»Daheim ist Hugo. Ich will ihn nicht traurig machen.«
»Wer ist Hugo?«
»Mein bester Vater. Und dann ist da noch Caroline, die würde sich über mich lustig machen.«
»Caroline?«
»Meine andere Mutter. Sie hat sehr viel Erfahrung, sie kennt das Leben. Wohnen Sie im Sacher?«
Er nickte. »Ein angenehmes Hotel.«
»Und nach dem Essen wollen Sie mit mir ins Bett gehen?«
Rudolf stutzte, er lachte etwas gezwungen. »Darauf könnte es hinauslaufen, jedenfalls was meine eigenen Wünsche anbelangt.«
»Ich glaube aber nicht, dass ich daran Spaß hätte.«
»Das kommt wohl auf einen Versuch an.«
Er stand jetzt so nahe vor ihr, dass sie seine Körperwärme spüren konnte. Es war ihr nicht unangenehm. »Und was machen wir mit Ihrer Freundin?«, fragte sie.
»Da sehe ich kein Problem. Sie ist mit mir hierher gefahren, damit ich ihr ein Flöge-Kleid und den passenden Schmuck dazu kaufe. Und das werde ich tun. Zu mehr fühle ich mich nicht verpflichtet.«
Als er sie auf die Wange küsste, zuckte sie zurück. »Also morgen Abend im Sacher«, sagte sie, »um acht Uhr. Ich werde jetzt Fräulein Emilie holen wegen der Rechnung.«
Serena saß bereits um halb acht auf einem der durchgesessenen blauen Sessel, die der kleinen Halle des Sacher so ein angenehm schlampiges Aussehen gaben. Vor ihr stand das übliche Kännchen Kaffee. Sie trug einen grauweiß gestreiften Wickelrock aus Seide, der später das Entkleiden leicht machen würde. Dazu einen Gürtel mit Silberschnalle von Koloman Moser, eine graue Jacke und darunter eine brave weiße Bluse mit nicht zu vielen Knöpfen.
War der reiche Mann aus Hamburg tatsächlich der, auf den sie gewartet hatte und mit dessen Hilfe sie aus diesem engen Wien herauskommen konnte? Sicher besaß er ein großes Haus, in dem auch Caroline und Hugo sich wohl fühlen würden. Dass sie dafür mit ihrer Jungfräulichkeit zu bezahlen hätte, fand sie nicht überteuert. Der Mann war ja nicht unsympathisch, er hatte gut gerochen, nach Tabak und teurer Seife, seine Lippen waren weich und trocken gewesen, und er hatte sich ohne zu zögern von seiner Freundin distanziert.
Langsam schob Serena ihre Hand unter Jacke und Bluse und berührte kurz die nackte Brust. Sogleich lief ein warmer Strom durch ihren Körper und landete zielsicher im Unterleib. Sie konnte wohl nicht voraussetzen, dass er es genauso geschickt machen würde wie sie selbst, doch hatte er gewiss viel Erfahrung und würde sich wahrscheinlich nicht allzu tölpelhaft anstellen.
»Das erste Mal ist immer fürchterlich«, hatte Caroline gewarnt, »viele Kerle sehen in dem Blut der Frau eine Bestätigung ihrer siegreichen Männlichkeit, und dann stochern sie umso wilder in ihr herum. Du solltest gut überlegen, wann und aus welchem Grund du dir diese Prozedur zumuten willst.«
Rudolf trat aus dem Lift und kam auf sie zu. Er küsste ihr die Hand.
»Ich bin froh, dass Sie Herrn Hugos Trauer und Frau Carolines Witzen unbeschadet entkommen sind«, sagte er lächelnd.
Immerhin, dachte Serena, er hat zugehört. »Und wie sind Sie Ihrer Freundin entkommen?«, fragte sie.
»Ebenfalls ziemlich unbeschadet, wenngleich ich die Produkte des Hauses Flöge recht teuer fand. Haben Sie Hunger?«
»Ja. Aber ein Stündchen halte ich es wohl noch aus. Erledigen wir doch das andere vorher.«
»Welches andere?«
»Hatten Sie denn nicht gesagt, dass Sie mit mir ins Bett gehen wollen?«
Rudolf starrte sie an und plötzlich errötete er. Mit beiden Händen griff er nach ihr, zog sie hoch und umarmte sie heftig. »Was ist los mit Ihnen?«, flüsterte er verwirrt. »Warum sind Sie so?«
»Wie … so?«
»So direkt und dabei doch so naiv. So vollkommen unraffiniert.«
»Unraffiniert?«, Serena hielt ganz still in seinen Armen. »Ich werd’s schon lernen, ich bin doch noch ganz am Anfang.«
Im Lift dann fragte sie: »Was haben Sie Ihrer Freundin gesagt?«
»Die Wahrheit. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich verliebt habe.«
Serena nickte. »Das wird uns die Sache erleichtern.«
»Haben Sie sehr große Angst?«
»Natürlich.«
»Aber warum wollen Sie’s dann?«
»Weil es nun mal dazu gehört.«
Oben in dem kühlen Hotelzimmer mit dem riesigen altmodischen Doppelbett waren die schweren Vorhänge zugezogen, nur im Spiegel brannten zwei kleine blütenförmige Lampen und verbreiteten ein stilles Dämmerlicht. Steif und vorsichtig, als befürchtete sie, dass ihr Körper in dem weichen Plumeau eine Spur hinterlassen könnte, setzte sie sich auf den Bettrand und faltete ergeben die Hände im Schoß. Da bemerkte sie auf den beiden Kopfkissen, genau dort, wo vermutlich später sein und ihr Kopf liegen würden, je ein in durchsichtiges Papier gewickeltes Stückchen Sachertorte. Mit einer unkontrolliert heftigen Bewegung wischte sie die freundlichen Gaben des Hotels vom Bett. Weder wollte sie Sachertorte essen, noch sich ihren Kopf neben dem seinen vorstellen. Langsam zog sie sich die vielen Nadeln, mit denen Caroline ihr noch am Nachmittag die elegante Frisur aufgesteckt hatte, aus den Haaren.
Als Rudolf zu ihr kam, ihr die Jacke auszog und die Bluse aufknöpfte, fing sie an zu weinen.
»Warum weinst du?«, fragte er und streichelte ihre Brüste. »Noch kann ich aufhören. Obgleich es mir sehr schwer fallen dürfte.«
»Es ist, weil jetzt etwas zu Ende ist«, sagte sie kläglich, »unwiderruflich vorüber. Und weil ich nicht weiß, was danach kommt.«
»Aber ich weiß es. Und ich verspreche dir, dass das Neue besser sein wird als das Alte.«
»Der arme Hugo«, flüsterte sie.
Er öffnete ihre Gürtelschnalle und schlug den Rock auseinander. Darunter trug sie eine kindliche weiße Batisthose mit Spitzeneinsätzen.
»Warum ist er arm?«
»Weil ich kein Kind mehr bin.«
Dann saß sie nackt da. Sie empfand keine Scham, konnte jedoch nicht aufhören zu weinen. Die offenen Haare hingen ihr bis zur Taille. Rudolf stand vor ihr, auch er hatte sich inzwischen seiner Kleider entledigt. Sie sah ihn nicht an. Gleich wird er mich berühren, dachte sie, hoffentlich beeilt er sich, damit wir bald nach unten gehen können zum Essen. Ich werde widerstandslos alles tun, was er von mir verlangt, und ich werde versuchen, dabei an etwas anderes zu denken, vielleicht an die Mädchen in Klimts Atelier, wenn die sich küssten und mit weichen Händen streichelten. Es wäre mir lieber, wenn er mich nicht küssen würde. Sie schloss die Augen und steckte ihre Hände zwischen die Knie, um ihr Zittern zu verbergen.
Da zog er sie vom Bett hoch, nahm sie an beiden Schultern und schob sie quer durchs Zimmer zu dem großen Standspiegel.
»Mach die Augen auf«, sagte er. »Das bist du, und du bist schön. Der Mensch hinter dir, der so viel breiter und größer ist als du, das bin ich. Und ich glaube, ich könnte dich lieben.«
Er neigte seinen Kopf nach links und bettete ihn in ihre Haare. »Durch deine Nähe bin sogar ich ein wenig schön geworden.«
Serena spürte die Wärme seiner Haut in ihrem Rücken, und das Neue erschien ihr nun schon weniger fremd und beängstigend. Als ihre Tränen nicht mehr flossen und sie endlich wagte, die Augen zu öffnen, schloss er die seinen wie in Andacht.
Ein Wiedererkennen durchfuhr sie. Die Szene, die ihr der Spiegel darbot, hatte sie schon einmal gesehen, sie kannte sie gut. Vorne Eva mit den aufgelösten Haaren, hinter ihr der lachende, ganz und gar an sie hingegebene Adam. Es war das Bild, über das Hugo so empört gewesen war, weil Klimt der nackten Eva ihre Gesichtszüge gegeben hatte. Sie lächelte. Ihr anderer Vater war ihr zu Hilfe gekommen, er hatte ihr ein Bild gemalt, und alles, was sie jetzt noch tun musste, war, sein Bild nachzustellen. Sie stand bewegungslos und imitierte das verheißungsvolle Klimtsche Eva-Lächeln.
»Mach doch die Augen wieder auf«, flüsterte sie.
Als es vorüber war und ihrer beider Köpfe nun tatsächlich dort ruhten, wo vorher die Sachertorte gelegen hatte, sagte Serena leise: »Caroline hat sich aber doch geirrt.«
Rudolf wandte sich ihr zu. »Verzeih mir, ich konnte nicht wissen, dass du noch Jungfrau bist.«
»Hätte das denn etwas geändert?«
»Ich weiß nicht. Nein … doch ja, ich wäre vorsichtiger gewesen, hätte dir nicht so wehgetan.«
»Du hast mir nicht sehr wehgetan«, sagte sie, »und es blutet auch schon kaum noch. Mir geht’s gut, ehrlich. Und ich habe jetzt schrecklichen Hunger.«
Er richtete sich auf, stützte sich auf die Ellbogen und schaute ihr ins Gesicht. »Warum ausgerechnet ich?«
»Das hat wohl an deinem Blick gelegen, und weil du’s ja eigentlich schon gestern versucht hast, in Gedanken, meine ich. Außerdem glaube ich an Vorgefühle.«
»Vorgefühle?«
Sie lachte und gab sich schnippisch. »Und weil’s doch endlich mal passieren musste.«
»Und weil ich zufällig grad verfügbar war?«
»Auch.«
»Und wenn nicht ich, dann eben ein anderer?«
Serena sprang lachend aus dem Bett und lief zum Badezimmer. »Es war doch kein anderer da, du warst es. Aber glaub deshalb nur ja nicht, dass ich mich so ohne weiteres in Besitz nehmen lasse. Ein wenig Blut, was ist das schon.«
Serena beschloss, Rudolf Max Magnussen zu heiraten. Er war offenbar sehr reich, er war attraktiv und er lebte in einer großen Hafenstadt, deren weltoffene Bürger gewiss Besseres zu tun hatten, als sich über ihre, Serenas, unklare Herkunft den Kopf zu zerbrechen.
Vor ein paar Jahren war sie einmal zusammen mit Hugo nach Hamburg gereist, um die Kunstschätze dort zu inspizieren. Die Kunsthalle, ein großer kühler Bau, direkt an der Eisenbahnlinie gelegen, war Serena nicht gerade anheimelnd erschienen, doch Hugo hatte die Solidität der Sammlung gelobt. »Rundum gute Qualität, zwar kein leidenschaftliches Engagement für Risikoreiches, aber auch keine Schaumschlägerei, damit kann man leben.«
Und er hatte ihr die schönen Villen an der Elbe gezeigt und die Stadtpalais in Harvestehude. Damals war ihr die kühle, strenge, übersichtliche Hansestadt als vollkommener Gegensatz zu dem schlampigen, vertratschten, verlogenen Wien erschienen. »Würdest du dich in so einer Stadt wohl fühlen können?«, hatte sie Hugo gefragt, und er hatte ausweichend geantwortet, dass er, um sich wohl zu fühlen, nichts weiter bräuchte, als hervorragende Kunst und die Nähe seines Töchterchens.
»Würdest du mich denn vermissen?«
»Höchstens deine negativen Seiten«, hatte er lächelnd geantwortet.
Serena kam bei der Planung ihrer Zukunft gar nicht auf die Idee, diese etwa allein, ohne Hugo und Caroline antreten zu müssen. Sie sah sich bereits in einem dieser wunderschönen hellen Häuser an der Binnenalster, alle Wände voller Bilder, oben ein ganzes Stockwerk für Hugo und Caroline, und unten eine elegante Terrasse, auf der Rudolf und sie Tee tranken. Emilie Flöges Gartenkleid würde sich hier sehr gut machen.
Vorerst allerdings schien Rudolf Max Magnussen nicht an Heirat zu denken. Er wollte nur immerfort mit ihr schlafen, und da sie es ihm beim ersten Mal so leicht gemacht hatte, schien er daraus zu schließen, dass sie überhaupt leicht zu haben sei – eben nur eine Vorführdame in einem Modesalon.
Serena begriff, dass da etwas falsch lief. Ihre Männerkenntnis bezog sie einzig von ihren Vätern, um deren Engagement sie sich nie hatte bemühen müssen – es war sozusagen naturgegeben.
Auch bei diesem, ihrem ersten jungen Mann, spielte die Natur eine große Rolle – doch ihre Großzügigkeit verpflichtete ihn offensichtlich nicht.
Caroline, deren Wissen über diese Dinge zwar groß, doch rein theoretisch war – sie hatte sich der praktischen Überprüfung nie ausgesetzt –, erklärte ihrem Schützling: »Den Köder hat der Fisch jetzt im Maul, er scheint ihm gut zu schmecken. Wenn du zu heftig an der Leine ziehst, kann es passieren, dass er den leer gefressenen Haken ausspuckt. Erst wenn er ihn runtergeschluckt hat, ist der Fisch dir hilflos ausgeliefert.«
»Und wie bring ich ihn dazu?«, fragte Serena.
»Der Fisch muss glauben, dass er den Angler zu sich zieht, nicht umgekehrt.«
Serena lernte schnell. Sie begann sich rar zu machen, manchmal ließ sie die Angelleine so weit durchhängen, als hätte sie jegliches Interesse an dem Fischfang verloren. Sie wurde unzuverlässig, war oft überhaupt nicht auffindbar, vergaß Verabredungen, gab dafür fadenscheinige Erklärungen, bis sie dann wieder mit halb offener Bluse, geschürztem Rock und einem unwiderstehlichen Sehnsuchtslächeln auf ihn zurannte.
Rudolf, der Zielstrebige, der immer genau Bescheid wissen musste, dem alles Vage verdächtig war, erlebte dadurch Momente tiefster Verunsicherung. Doch kaum sah er Serena wieder, etwa im Café Mozart, wo sie allein an einem Zweiertischchen saß, umwerfend elegant, mit Handschuhen, Hut und Schleier, und ihm wohlerzogen entgegenlächelte, fand er zu sich selbst zurück. Er zog ihr den rechten Handschuh von den Fingern, um den bloßen Handrücken zu küssen.
Manchmal verbrachte Rudolf eine ganze Woche in Wien, ohne Serena auch nur zu Gesicht zu bekommen. Und wenn sie dann endlich doch bei ihm war, vielleicht an seinem allerletzten Tag, in seinem Zimmer, in seinem Bett, in seinen Armen, wenn sie dann lachte über die Dringlichkeit seines Begehrens und sich möglicherweise schon nach wenigen Minuten unter ihm hervorrollte und sagte, sie müsse jetzt gehen, habe eine wichtige Verabredung, dann wusste er kaum noch was er tat.
Einmal erhob er sogar die Hand gegen sie, schlug dann allerdings nicht zu, weil ihm ihr Blick in die Quere kam. In dem Aufruhr seiner Gefühle fragte er sie noch im gleichen Moment, ob sie ihn nicht endlich heiraten wolle.
Serena jedoch war klug genug, den Antrag nicht ernst zu nehmen. Sie wandte sich ab und sagte: »Ich glaube nicht, dass ich jemanden heiraten möchte, der die Hand gegen eine Frau erhebt.«
»Ich habe doch nicht zugeschlagen«, sagte er kläglich.
»Aber fast«, war ihre Antwort, und sie kleidete sich wortlos an und verließ ihn.
Inzwischen war Caroline der Meinung, dass Serena das Hin- und Hergezerre übertrieb.
»Anscheinend bist du dir selbst nicht ganz im Klaren darüber, was du willst.«
»Ich will ihn heiraten, damit wir alle zusammen in einem großen schönen Haus leben können. Hugo mit dir und mir und seiner Kunst, du mit Hugo und mir und ich mit Hugo und dir.«
»Offenbar vergisst du dabei, dass du in erster Linie mit dem Mann zusammenleben musst. Tag für Tag und vor allem Nacht für Nacht. Dann wird’s keine vergnügliche Weigerung mehr geben, mit der Eheschließung hast du dich per Unterschrift zu jeder Art sexuellen ›Frondienstes‹ verpflichtet. Und falls du mal keine Lust hast, kann er dich ohne weiteres zwingen. Kein Richter würde ihn deshalb belangen, weil nämlich in der Ehe der Tatbestand einer Vergewaltigung nie gegeben ist.«