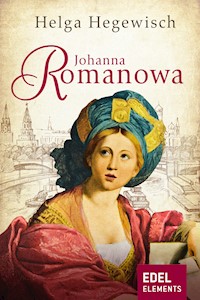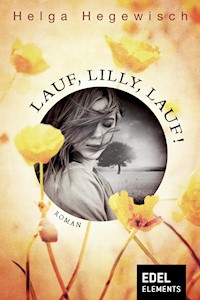
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein wunderbares Buch über das Erwachsenwerden in schwieriger Zeit." (Focus) Plötzlich sind die Flugzeuge über ihnen, offenbar hat niemand sie kommen sehen. Es knallt und kracht. Ruckartig kommt der Wagen zum Stehen. Die Insassen springen heraus. "Lauf, Lilly, lauf, so schnell du kannst!" Und das tut sie. Kein einziges Mal dreht sie sich um. Sie rennt und rennt, quer durch den Wald, sie denkt nichts, sie weiß nicht einmal, dass sie rennt, sie ist wie ein Fahrzeug ohne Fahrer, immer gerade aus, immer weiter... Krieg und trügerischer Friede, Jahre des Erwachsenwerdens in Zeiten politischer Umorientierung, das Niemandsland zwischen Naivität und Wissen, erste Liebe, Vertrauen und Verrat – und am Ende ein neuer Anfang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Helga Hegewisch
Lauf, Lilly, lauf!
Edel:eBooks
Inhalt
Wendepunkt
Part 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Part 2
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Impressum
Wendepunkt
Oktober neunzehnhundertvierundvierzig. Seit ein Großteil von Lillys Heimatstadt Hamburg zerstört ist, wohnt sie mit ihrer Familie in Mecklenburg auf der Domäne Staaken außerhalb des Dorfes Galitz. Irgendwo, sehr weit weg, tobt der Krieg.
»Gar nicht mehr so weit weg«, sagt die Mutter, »und er kommt näher, jeden Tag.«
Lilly weiß, dass ihre Mutter, wenn sie so etwas sagt, Angstaugen kriegt. Angst jedoch hilft überhaupt nichts, die macht alles nur noch schlimmer. Darum versucht Lilly, nicht hinzuschauen und nicht hinzuhören und ganz schnell an etwas anderes zu denken. Lilly ist sehr gut im Wegdenken.
»Möchte nur mal wissen, wo du jetzt grad wieder bist«, sagt dann die Mutter.
Lilly zuckt die Schultern. Sie hat keine Lust zu antworten. Lilly ist fast fünfzehn Jahre alt und davon überzeugt, dass die Erwachsenen sie nicht verstehen. Zwar ist man von ihnen abhängig und man kann sie sogar gerne haben und vielleicht auch lieben und ihnen zuhören und sich von ihnen beschützen lassen, aber man sollte nie auf Verständnis hoffen. Ebenso wie die Erwachsenen nicht erwarten können, dass ihre Kinder sie verstehen. Daran scheint ihnen allerdings auch kaum gelegen zu sein, denn meistens geben sie sich nicht die geringste Mühe, ihr Verhalten zu erklären. Obgleich das, was sie tun und beschließen, oft auch ihre Kinder betrifft, erwarten sie keine Rückfragen.
Und wo ist Lilly, wenn sie weghört und wegschaut und wegdenkt? Ziemlich oft bei ihrer Freundin Isa oder auch bei dem Buch, in dem sie gerade liest (momentan »Die Barrings«, wo alles so schön vornehm und so schrecklich traurig ist), oder irgendwo in ihrer Phantasie.
»Im Krieg braucht man sehr viel Phantasie«, sagt Onkel Jupp, Vaters jüngerer Bruder, der seit seiner Verwundung meist bei ihnen ist. Man hat ihm an der Ostfront einen Fuß weggeschossen, deshalb arbeitet er jetzt in der Verwaltung, wie er das nennt, und diese »Verwaltung« befindet sich nur eine Autostunde entfernt von Galitz. Für Lilly gehört er in die Abteilung »Gern haben und sich beschützen lassen«, und er ist ihr inzwischen vertrauter als der Vater, der vor über zwei Jahren während des Afrika-Feldzugs vermisst gemeldet wurde und von dem die Familie seither nichts gehört hat. Mama und Onkel Jupp sind der Meinung, dass Lillys Vater tot ist. Lilly selbst will sich damit nicht abfinden und wartet immer noch auf eine Nachricht.
Montagmittag. Die müde träge Stunde nach Schule und Mittagessen. Im Hause ist es sehr still. Lilly liegt auf dem Bett und hat zu nichts Lust, schon gar nicht zu den Hausarbeiten. Außerdem hat sie Bauchweh, vermutlich kriegt sie ihre Tage. Eine schrecklich überflüssige Angelegenheit, findet Lilly, daran ändern auch die schlauen Erklärungen der Erwachsenen nichts. Lilly beschließt, ein Stündchen zu schlafen. Sie legt sich auf die rechte Seite und schiebt den linken Arm über ihre Augen.
Schön, das Wegrutschen in den Schlaf, die Wirklichkeit stellt keine Ansprüche mehr, alles wird möglich.
Und plötzlich bricht aus der Mittagsstille das Chaos hervor, es knallt und kracht und detoniert, die Welt ist verrückt geworden.
Lilly springt vom Bett und rennt nach unten in die Diele. Da sind auch schon die anderen. »Hinlegen, verdammt noch mal, legt euch hin«, schreit Onkel Jupp.
Im Niederwerfen schlägt Lilly sich die Stirn an der Heizung auf. Das ist der Krieg, denkt sie, nun ist der Krieg auch zu uns gekommen. Platt auf den Boden gedrückt bedeckt sie ihren Kopf mit den Händen, obgleich das kaum etwas nützen dürfte, wenn eine Bombe das Haus trifft. Wieso Bombe, wir sind hier auf dem Lande, weit und breit kein lohnendes Ziel. Krieg, Krieg, Krieg. Lilly denkt immer nur dies eine Wort, dabei erklärt es überhaupt nichts. Die Angst ist wie eine große nasse Pferdedecke, die auf Lilly heruntergefallen ist und sie zu ersticken droht.
Und ebenso plötzlich, wie es begonnen hat, ist es vorüber; ein schnell leiser werdendes Brummen, das war’s dann. Tatsächlich, war’s das?
Onkel Jupp fasst sich als Erster. »Vielleicht kommen sie wieder«, ruft er, »alle runter in den Keller.«
Auf die Idee ist Lillys Bruder Joachim auch schon gekommen, aber der Keller ist abgeschlossen. Wieso denn das? Natürlich, ja, wegen der Vorräte! Wo ist der Schlüssel? Sie drängeln sich allesamt vor der Kellertür und der Schlüssel ist nicht da.
»Irene, gib den Schlüssel her«, schreit Onkel Jupp.
Mit hastigen Bewegungen greift sich Mama in die Tasche, fährt über den Fenstersims, sucht hinter dem Blumentopf. Mama kann den Schlüssel nicht finden. Lilly starrt sie an. Angstaugen, was denn sonst, Keuchen und Schluchzen.
»Tut mir Leid, ich … ich weiß nicht … heute Morgen war der Schlüssel noch …«
»Oma Elli«, ruft Onkel Jupp, »hast du den Schlüssel gesehen?«
»Ich weiß genau, dass ich ihn Irene gegeben habe. Nimm dich zusammen, Tochter, gib jetzt sofort den Schlüssel her!«
Und da sind die Flugzeuge auch schon zurückgekommen und donnern erneut über sie hinweg. Die Familie auf dem Boden vor der Kellertür eng aneinander gedrückt. Mama schreit, die anderen sind ganz still.
»Ruhig, Irene«, sagt Onkel Jupp, »ganz ruhig, die meinen nicht uns.«
»Aber wen meinen sie denn?«
»Hör auf zu schreien, du machst die Kinder verrückt.«
»Es ist meine Schuld«, jammert Mama, »immer verlier ich die Schlüssel.«
Onkel Jupp legt seinen Arm um die Mama. »Hör doch, sie ziehen wieder ab.«
Alle lauschen. So seltsam, die plötzliche Stille, niemand rührt sich vom Fleck. Es war ja auch wieder nur eine Schleife. Diesmal schreit Mama nicht. Onkel Jupp hält sie ganz fest, kann sein, dass er ihr die Hand auf den Mund gelegt hat. Die schwere Angstdecke drückt Lilly das Herz zusammen, sie würde gern ohnmächtig werden, aber das passiert ja nur in Büchern.
Noch zweimal kommen die Flugzeuge zurück, dann endlich machen sie sich davon. Was war das nur, was haben sie hier gewollt? Das Haus jedenfalls ist nicht getroffen.
»Ich weiß«, sagt Joachim zu Onkel Jupp, »dein Lastwagen, der steht vor der Scheune. Den wollten sie treffen. Ich hab schon immer gesagt, dass das unvorsichtig ist!«
»Na klar«, reagiert Onkel Jupp ärgerlich, »unser Joachim hat es schon immer gesagt!«
Aber es war nicht der Lastwagen, der steht an seinem üblichen Platz, heil und unberührt, man kann ihn durch das Fenster sehen. Onkel Jupp reicht zuerst Oma Elli die Hand und dann Mama und zieht sie beide vom Boden hoch. Er kann schon wieder lachen. »Da sieht man mal, wohin eure Sparsamkeit führt!«, sagt er. »Eher lasst ihr uns alle zu Grunde gehen, als dass ihr uns Zugang zu euren Vorräten gestattet!«
»Ich werd den Schlüssel schon finden«, schluchzt Mama, »bestimmt finde ich ihn!«
»Aber sicher.« Er schiebt Mama ins Wohnzimmer und drückt sie in den großen Lehnsessel. »Ich geh jetzt und seh nach, was passiert ist.«
»Werden sie wiederkommen?«, fragt Mama.
»Das glaube ich nicht. Aber ich will auf keinen Fall, dass einer von euch das Haus verlässt, jedenfalls nicht, bis ich zurück bin. Das ist ein Befehl!«
Nie zuvor hat Onkel Jupp gesagt, dass irgendetwas ein Befehl ist. Lilly hätte das auch ziemlich blöd gefunden. Heute allerdings erscheint es ihr vollkommen richtig.
Kaum ist Onkel Jupp gegangen, verzieht sich Oma Elli ins Badezimmer. Das tut sie immer, wenn sie sich aufregt. Mama sitzt mit geschlossenen Augen im Sessel und atmet schwer. Der kleine Felix drückt sich an ihre Knie. Obgleich sie sich am meisten von allen aufgeregt hat, ist sie doch der Mittelpunkt der Familie, dem sie alle nahe sein wollen. So sitzen und stehen die drei Kinder und die beiden polnischen Mädchen Magda und Danuta um die Mutter herum und schauen sie an und erwarten von ihr irgendwelche Anweisungen.
Die kommen dann auch bald. Mama nimmt sich zusammen. »Ich weiß jetzt, wo der Schlüssel ist«, sagt sie zu Lilly. »Oben im Schlafzimmer, hinter Papas Foto. Geh bitte und hol ihn mir.«
Lilly läuft die Treppe hinauf, greift sich den Schlüssel und rennt, so schnell sie kann, wieder hinunter, sie will jetzt nicht allein sein. Der sechzehnjährige Joachim hat sich hinter Mamas Stuhl aufgebaut und ihr die Hände auf die Schultern gelegt. Lilly findet, dass er aussieht wie der Hitlerjunge auf diesem Reklameplakat mit der Inschrift »Die deutsche Jugend kennt ihre Verantwortung«. Eigentlich hat ihr das Plakat immer ganz gut gefallen, aber dass Joachim jetzt so tut, als wäre er ein jungdeutscher Held, der seine arme alte Mutter beschützen muss, das erscheint ihr albern und unpassend. Erstens zweifelt sie stark an der Heldenhaftigkeit ihres Bruders und zweitens hat Mama nicht die geringste Ähnlichkeit mit der Frau auf dem Plakat, an der alles grau ist, Haare, Gesicht, Kleid und Strümpfe. Lillys Mutter jedoch hat eine weiße Haut und dunkellockige Haare und ihre Lieblingsfarbe ist Rot. Schutzbedürftig ist sie allerdings sehr.
Lilly hat ihrer Freundin Isa erzählt, dass seit einiger Zeit die Angst in ihrer Mutter drinhockt wie eine Krankheit. »Manchmal sitzt sie nur so da mit einem Buch in der Hand, am Abend, wenn alles still und friedlich ist, und plötzlich kann ich es ganz deutlich spüren: Mama zittert vor Angst und ist nahe daran, laut aufzuschreien.«
»Und was dann?«, hat Isa gefragt.
»Nicht viel. Sie blättert schnell ein paar Seiten um. Oder sie sieht zu mir hin und sagt: ›Ich mag nicht, wenn du mich so anstarrst.‹ Oder sie geht in die Küche und macht sich einen Kamillentee.«
»Wovor hat sie denn Angst?«
»Ich weiß nicht. Wenn Onkel Jupp da ist, geht es ihr sofort besser. Aber kaum ist er weg, fängt es wieder an. Und dann kommt mein Bruder, dieser Blödmann, und macht hier den großen Beschützer. Totaler Käse, sag ich dir, wenn’s wirklich ernst wird, kann er nicht mal sich selbst beschützen!«
»Weißt du doch gar nicht«, hat Isa, die Joachim nicht ganz so kritisch beurteilt wie Lilly, darauf gesagt.
Lilly legt ihrer Mutter, die mit geschlossenen Augen im Sessel sitzt, den Schlüssel in den Schoß. »Ich mach ein Band dran«, sagt sie, »dann kannst du ihn dir um den Hals hängen.«
»Und wenn die nun doch wiederkommen …«, sagt die Mama.
Lilly gibt sich zuversichtlich. »Bestimmt nicht. Onkel Jupp hat gesagt, dass die nicht uns gemeint haben.«
»Wen denn sonst?«
»Irgendetwas drüben auf dem Hof. Ich hab gelesen, dass die neuerdings auch auf Pferde und Kühe schießen.«
»Warum gehen wir nicht alle in den Keller und warten dort, bis Onkel Jupp zurückkommt?«
»Ich geh nicht in den Keller«, verkündet Joachim. »Wenn das Haus getroffen wird, kriegt man da unten keine Luft mehr und muss langsam ersticken.«
»Und hier oben bist du gleich tot«, sagt Lilly, »dann kommst du schneller in den Himmel. Natürlich in einen feudalen Sonderhimmel, reserviert für die tapferen Führer der Hitlerjugend.«
»Während du direkt in die Hölle abrauschst. Dann brauchen wir uns nie mehr wieder zu sehen.«
»Immer dieses Streiten …«, flüstert die Mutter und beginnt zu weinen. Sie schluchzt nicht, verzieht nicht das Gesicht, sie lässt nur die Tränen still die Wangen hinunterlaufen. Ihre Hände im Schoß hat sie so fest zusammengepresst, dass die Knöchel ganz weiß aussehen. »Wenn Jupp nur nichts passiert!«, sagt sie.
Die beiden Polinnen tuscheln miteinander und schieben sich dann langsam in Richtung Tür. Doch bevor sie hinausgehen können, fährt Joachim sie an: »Der Major hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Also richtet euch gefälligst danach.«
Magda und Danuta schrecken zusammen und kommen zurück. »Ist doch der kleine Mischa drüben auf dem Hof«, jammert Magda, »muss ich doch nach ihm sehen!«
»Musst du gar nicht. Du hast doch gehört, was der Major gesagt hat!«
Joachim nennt Onkel Jupp immer den Major, obgleich dieser es sich verbeten hat.
»Aber der kleine Mischa …«, murmelt Magda. »Ist doch erst vier Jahre alt, rennt draußen rum.« Ächzend hockt sie sich neben Mamas Sessel auf den Teppich.
Da nimmt die Mutter ihre verkrampften Hände auseinander, wischt sich mit der einen die Tränen weg und legt die andere auf Magdas Schulter. »Der Major gibt schon Acht«, sagt sie, »hab keine Angst.«
Merkwürdig, denkt Lilly, nun spricht die Mama auch schon vom Major.
»Vielleicht war das Ganze ja ein Irrtum und sie kommen wirklich nicht wieder«, sagt Mama mit inzwischen tränenfreier Stimme. »Joachim, schließ die Kellertür auf und lass den Schlüssel stecken. Magda und Danuta gehen in die Küche und machen für alle Tee, und Lilly kümmert sich um den Kleinen.«
»Lilly Blut am Kopf«, sagt der kleine Felix.
Mit gerunzelter Stirn betrachtet die Mutter ihre Tochter. »Was hast du denn gemacht?«
»Weiß ich nicht.«
»Tut’s dir weh?«
»Nicht sehr.«
»Also geh und hol dir ein Pflaster. Der Kasten steht im Schrank neben dem Herd.«
Als Lilly aus der Küche zurückkommt, steht die Mutter in der Diele am Fenster und starrt hinüber auf die andere Straßenseite, wo die Hofgebäude liegen und die Felder beginnen.
»Ein ziemlich langer Riss«, sagt Lilly »vielleicht muss er genäht werden.«
Die Mutter wendet sich ihr zu und sieht sie verständnislos an. »Was muss genäht werden?«
Lilly deutet mit dem Finger auf ihre verpflasterte Stirn. »Der Riss an meiner Stirn.«
»Ach Unsinn. Sieh doch mal, all die vielen Menschen auf dem Hof. Was machen die da nur?«
Lilly ist gekränkt. Seit sie die Wunde gesehen hat, tut ihr die Stirn tatsächlich sehr weh, und ihre Mutter könnte sich gern etwas interessierter zeigen.
Joachim kommt heran. »Die Menschen da drüben, die gehören zu dem Gefangenenzug. Die sind gestern Abend hier angekommen, sie sollen weiter nach Westen verlegt werden. Der Major hat den Inspektor dazu überredet, sie in der großen Feldscheune schlafen zu lassen. Ich dachte, die wären längst weg.«
»Kriegsgefangene?«, fragt die Mutter.
»Engländer«, erklärt Lilly. »Sie sind schon seit über einer Woche unterwegs.«
»Woher willst denn du das wissen?«, fragt Joachim.
»Weil ich gestern Abend drüben war. Zum Milchholen. Da hat mich einer von denen angesprochen, konnte sogar etwas Deutsch. Ich hab ihm eine Kanne Milch gegeben.«
»Du hast sie wohl nicht alle«, blafft Joachim böse. »Wie kannst du denen unsere Milch geben?«
»Und wieso nicht? Deutsche Soldaten sind ja auch irgendwo in Gefangenenlagern.«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»Auf solche dämlichen Fragen antworte ich nicht«, sagt Lilly.
Mama seufzt. »Kinder, Kinder …! Wenn doch endlich Onkel Jupp zurückkäme!«
Der kleine Felix krabbelt auf die Fensterbank. Mama legt beide Arme um ihn und zieht ihn an sich.
Wenn ich jetzt rausdürfte, denkt Lilly, würde ich mich aufs Fahrrad setzen und zu Isa fahren.
»Ich geh mal telefonieren«, sagt Lilly.
»Kommt nicht in Frage«, sagt Joachim.
»Und wieso nicht?«
»Weil man in Kriegszeiten keine Privatgespräche führen darf. Alle Leitungen werden gebraucht.«
»Du spinnst wohl. Schließlich dauert der Krieg schon über fünf Jahre und soviel ich weiß, hast du bislang beim Telefonieren nie darauf Rücksicht genommen.«
»Bislang war der Krieg ja auch noch nicht bei uns.«
Obgleich Lilly ihrem Bruder in diesem Fall Recht geben muss, sagt sie trotzig: »Wenn ich telefonieren will, dann tu ich’s auch!«
»Versuch’s doch mal«, sagt Joachim und hält ihren Arm fest.
Mama seufzt. »Wo musst du denn so dringend anrufen, Lilly?«, fragt sie.
»Im Schloss. Isa macht sich bestimmt Sorgen.«
»Wenn sie sich so schreckliche Sorgen macht, dann könnte sie ja auch hier anrufen«, sagt Joachim.
»Könnte sie nicht. Weil sie nämlich für jedes Telefonat bezahlen muss und weil sie kein Geld hat.«
»Ach Gott, die Arme!«, feixt Joachim. »Wohnt im Schloss und hat kein Geld.«
»Halt den Mund, Joachim«, sagt Mama. Unverhofft nimmt sie Lillys Gesicht in beide Hände und küsst sie auf die Stirn, gleich neben das Pflaster. »Dann geh schnell und ruf sie an.«
Lilly begreift nicht, wieso sich ihre Mutter plötzlich so liebevoll benimmt, und es gefällt ihr sehr. »Ist ja nicht so eilig«, stottert sie, »vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich hier bleibe und mit dir warte, bis Onkel Jupp zurückkommt.«
»Ja, bleib da, das ist gut«, murmelt Mama und hält nun in dem einen Arm den kleinen Felix und in dem anderen ihre große Tochter. Hinter ihnen steht Joachim, der seine Hände wieder auf Mamas Schulter gelegt hat.
Plötzlich weiß Lilly mit absoluter Sicherheit, dass die Ereignisse des heutigen Tages ihr Leben nachhaltig beeinflussen werden. Was auch immer dort draußen passiert sein mag, was die feindlichen Flugzeuge gewollt und was sie angerichtet haben, es hat mit ihr ganz persönlich zu tun und es wird ein Vorher und ein Nachher geben. Obgleich Lilly keine Ahnung hat, woher ihr dieses plötzliche Wissen kommt, zweifelt sie jedoch keine Sekunde daran.
Das ist der Krieg, denkt sie, mein Krieg.
Während der Bombennächte in Hamburg hat sie Häuser einstürzen sehen und Menschen schreien hören, sie hat den beißenden Brandgeruch in Nase und Kehle gespürt und das zersplitterte Fensterglas von ihrem Bett geschüttelt. Sie ist halb ohnmächtig gewesen vor Angst und in sich zusammengesackt, weil ihre Knochen sie nicht mehr halten wollten. Aber sie hat das alles nie auf sich selbst bezogen. Es war der Krieg der anderen, der Erwachsenen, irgendetwas, das scheinbar mit Ruhm und Ehre zu tun hatte, mit Vaterlandsliebe und Heldentum. Etwas, das passierte, nichts, auf das sie irgendeinen Einfluss nehmen konnte.
Und jetzt, wieso soll das jetzt plötzlich anders sein? Lilly weiß es nicht. Aber sie weiß, dass sie von nun an beteiligt sein wird und selber Entscheidungen treffen muss. Und das gefällt ihr überhaupt nicht.
»Da kommt der Major«, sagt Joachim.
Onkel Jupp überquert mit schnellen Schritten die Straße und läuft auf das Haus zu. Er wirkt verschlossen, fast böse. Seine Jacke ist übersät mit großen roten Flecken. Er reißt die Haustür auf. »Unglaublich«, keucht er, »Tote, Verletzte, die meisten Engländer, aber auch Deutsche. Joachim, du bringst alle verfügbaren Decken und Kissen in den Lastwagen. Die Frauen bleiben zu Hause. Holt die Vorräte aus dem Keller und kocht eine große Suppe. Ich muss wieder raus.«
Die Tür fliegt ins Schloss.
»Wieso …«, flüstert Mama, »das ist doch nicht möglich, haben die etwa ihre eigenen Leute …?«
»Wahnsinn!«, sagt Joachim. »Absoluter Wahnsinn! Ich glaube, ich zieh doch besser meine Uniform an.«
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Der Krieg begann an einem Freitag. Lillys Mutter saß vor dem Radio und weinte.
»Ab heute Morgen schießen sie zurück« oder so ähnlich. Warum auch nicht, dachte Lilly. Sie war neun Jahre alt und ging in die vierte Klasse der Volksschule am Kirchgarten.
Aber die Mutter weinte. Nach einer Weile stand sie plötzlich auf, durchquerte mit raschen Schritten Esszimmer und Flur und lief zur Wohnungstür hinaus.
Lilly trödelte in der stillen Wohnung herum, trank ein Glas Milch, legte sich flach auf den Wohnzimmerteppich, zählte die Rosetten an der Stuckdecke und ging immer wieder auf den Balkon, um nach Mama Ausschau zu halten.
Sie fühlte sich sehr allein. Ihr älterer Bruder Joachim war mit dem Jungvolk auf Fahrt, Papa wie üblich unterwegs, Oma Elli wegen ihrer kranken Knochen zur Kur und sogar die Tageshilfe, Frau Gössel, war heute nicht erschienen. Nur Lilly in der großen Wohnung, von allen vergessen. Sie weinte etwas, aber das nützte auch nichts.
Die Mama kam erst nach zwei Stunden zurück. Sie hatte zerzauste Haare, rote Wangen und die Arme voller Lebensmittel. »Wieso bist du denn nicht in der Schule?«, fragte sie ihre Tochter.
»Weil Krieg ist«, sagte Lilly. »Da wird zurückgeschossen. Das hast du doch auch vorhin im Radio gehört.«
Mama sah Lilly an und schüttelte missbilligend den Kopf. »Was du dir immer so alles einbildest. Das Leben geht weiter. Und du gehst morgen wieder zur Schule.«
Aber das tat Lilly nicht. Zwar verließ sie am nächsten Morgen wie üblich um Viertel vor acht das Haus, doch kaum war sie außer Sichtweite, flitzte sie hinüber zum Volkspark und landete schon Minuten später bei ihrem Baum.
Lillys Baum war nicht nur ein erstklassiger Kletterbaum, sondern er hatte in seinem Stamm auch noch eine tiefe Höhlung, in der man sich gut verstecken konnte. Die Höhlung war Lillys Wohnzimmer, die Baumkrone war ihr Garten. Lilly erzählte dem Baum alles, was sie wusste, und manchmal wusste sie es überhaupt erst richtig, nachdem sie’s ihm erzählt hatte. Lilly begriff früh, dass sich die Dinge ändern, wenn man sie ausspricht. Darum musste man in der Wahl seines Gesprächspartners sehr vorsichtig sein.
Lilly warf ihren Schulranzen in die Höhlung und kletterte nach oben. Aufatmend lehnte sie sich gegen den Himmelsast und begann: »Es ist Krieg, und seit gestern wird zurückgeschossen, wie findest du das?«
Die Frage war: Wer schoss hier eigentlich auf wen? Irgendwie hatte das mit Polen und England zu tun. Die Polen waren dreckig und faul, das hatte Lilly in der Schule gelernt. Und die Engländer? Arrogant und frech, aber sonst ziemlich sympathisch. Beinahe hätte Lilly sogar einen englischen Vater gehabt. Mama war nämlich in England aufgewachsen und zur Schule gegangen, weil ihr Vater, Oma Ellis verstorbener Mann, dort bei der Niederlassung einer deutschen Bank gearbeitet hatte. Englisch war Mamas Kindersprache gewesen und darum hatte sie es an ihre eigenen Kinder weitergegeben und mit ihnen abwechselnd englisch und deutsch gesprochen. Oft schien sie gar nicht zu wissen, welche Sprache gerade aus ihrem Mund herauskam.
Im Alter von siebzehn Jahren hatte Mama sich mit einem Engländer verlobt, das war der lustige Jack, von dem Mama immer noch gerne sprach. Aber als Mama dann achtzehn wurde und grad mit der Schule fertig war, da starb plötzlich ihr Vater, und ihre Mutter, Lillys Oma Elli, ging mit ihr nach Deutschland. Zuerst fühlte Mama sich in Deutschland sehr einsam, aber dann traf sie den Papa, der Bauingenieur war und schon sehr erwachsen, mindestens fünfzehn Jahre älter als Mama. Er hatte bereits einen Beruf und ein Auto und eine Wohnung und ein Büro, deshalb heiratete die Mama ihn. Und natürlich auch aus Liebe, klar. Und Onkel Jack tröstete sich dann sehr bald mit Tante Elisabeth, und die wurde Lillys Patentante, alles in bester Ordnung. So jedenfalls hatte Mama die Geschichte erzählt.
Lillys Eltern waren sehr verschieden und wer sie nicht gut kannte, wäre kaum auf die Idee gekommen, dass sie miteinander verheiratet waren. Papa war groß und breit gebaut. Seine blonden Haare lagen ordentlich gescheitelt eng am Kopf. Er trug eine dicke Brille, sprach langsam und deutlich und wusste viele Sprichwörter. Wenn Lilly ihre zapplige kleine Hand in seine große ruhige steckte, fühlte sie sich sicher. Papa tat nie etwas Überflüssiges, bei ihm ging jeder Schritt in die beabsichtigte Richtung, hatte jede Unternehmung einen Zweck und jedes Wort einen Sinn.
Mama dagegen war zart und schlank und leichtfüßig und es schien ihr nicht nur beim Gehen große Mühe zu machen, ihren Rhythmus dem ihres Mannes anzupassen. Sie hatte sehr weiße Haut, braune Augen und lockige dunkle Haare, die sie meist am Hinterkopf zu einem Knoten aufsteckte.
Rot war Mamas Lieblingsfarbe, und immer war irgendetwas Rotes an ihr, die Bluse, der Schal oder wenigstens die rote Korallenkette, die Papa ihr zur Verlobung geschenkt hatte. Im Schrank hingen sogar zwei leuchtend rote Kleider, allerdings trug Mama sie fast nie. Wenn sie allein über die Straße ging, machte sie manchmal, mitten aus dem zielsicheren Gehen heraus, ein paar sinnlose kleine Hüpfschritte.
»Mit Onkel Jack ist sie oft zum Tanzen gegangen«, erzählte Oma Elli. »Aber natürlich müssen wir froh sein, dass wir jetzt den Papa haben, auf seine Weise ist er doch ein sehr guter Mensch. Und so zuverlässig!«
Das klang, als ob ihm sonst einiges fehlte. Doch Lilly vermisste dieses Fehlende nicht, denn Papa hatte einen Bruder, Joseph, allgemein Jupp genannt, und der verfügte über alle jene Eigenschaften, die Papa anscheinend abgingen. Onkel Jupp war sehr viel jünger als Papa. Er sah ihm zwar ähnlich, doch wirkten seine blonden Haare immer unordentlich, und wenn er eine Brille trug, dann war’s eine Sonnenbrille. Er konnte Trompete blasen und Stepp tanzen und Stimmen imitieren. Er konnte auch zeichnen und auf den Händen gehen und statt Papas Sprichwörtern wusste er viele Schlagertexte und Melodien auswendig und auch ein paar lustige Gedichte. Schon dreimal hatte er ihnen ein hübsches junges Mädchen als »meine Verlobte« vorgestellt, aber irgendwie war’s dann mit der Ehe nie etwas geworden.
Früher war er ein Geschäftsmann gewesen, Lebensmittelhandel, nicht sehr erfolgreich. Einmal war er sogar Pleite gegangen und Papa hatte seine Schulden bezahlt. Aber dann hatte Onkel Jupp sich für Hitler begeistert und war Soldat geworden. Inzwischen war er natürlich Offizier, irgendetwas ganz Hohes, Lilly konnte sich nie die einzelnen Ränge merken. Jedenfalls sah er sehr gut aus in seiner Uniform.
Wenn er kam, machte sich sogar Oma Elli schön. Mama kriegte Glitzeraugen, zog hochhackige Schuhe an und band nicht nur sich selbst, sondern auch ihrer Tochter ein rotes Band ins Haar. Onkel Jupp brachte Mama die neueste Platte mit den Liedern von Zarah Leander, schenkte Oma Elli eine seidene Rose und Frau Gössel eine Flasche 4711, kaufte für Lillys Bruder Joachim Groschenhefte mit spannenden Soldatengeschichten und für Lilly Zopfspangen mit bunten Blümchen drauf, die Lilly so sehr begeisterten, dass der Onkel seine Nichte von da an gelegentlich Blümchen nannte.
Sogar Papa veränderte sich in Onkel Jupps Gegenwart. Er benutzte weniger Sprichwörter, lachte häufiger und legte seine Lektüre zur Seite, um ihm zuzuhören.
»Papa und Onkel Jupp sind nämlich nicht nur Brüder«, sagte Lilly zu dem Himmelsast, »sie sind auch richtig miteinander befreundet. Und weil Onkel Jupp bestimmt nicht so zuverlässig ist wie der Papa, dafür aber viel fröhlicher, brauchen wir sie alle beide. Ich finde das eigentlich sehr praktisch, besonders weil Papa so viel unterwegs sein muss. Wir haben zwei Männer, wo andere nur einen haben.«
Den ganzen Vormittag verbrachte Lilly in ihrem Baum. Langweilig wurde es ihr nicht, denn sie hatte sehr viel zu bereden. Die Frage, wer hier auf wen geschossen hatte, ließ sich nicht klären. Jedenfalls war Krieg, das ist ein böser Streit unter Erwachsenen, bei dem es um Erwachsenenprobleme geht, Länder und Grenzen und Macht und Ehre und so was. Einer schießt zuerst, der andere schießt zurück. Dass Deutschland etwa den Streit angefangen hätte, konnte Lilly sich nicht vorstellen. Die Deutschen sind ein friedliebendes Volk, das stand jeden Tag in der Zeitung und wurde auch im Radio gesagt.
Kurz nach zwölf stieg sie hinunter, nahm ihren Ranzen und machte sich auf den Heimweg. Sie fühlte sich gut und ausgeruht und hatte momentan nicht das geringste schlechte Gewissen.
Kapitel 2
Ostern 1940 wurde Lilly, seit dem Winter zehn Jahre alt, von der Volksschule am Kirchgarten umgeschult in das Immanuel-Kant-Gymnasium in der Bismarckstraße. Um dorthin zu kommen, musste sie drei Stationen mit der S-Bahn fahren.
Leider war immer noch Krieg. Lillys Papa war tatsächlich eingezogen worden, allerdings nicht als Frontsoldat. Die Heldentaten, so wie sie in Joachims Kriegerheften beschrieben wurden, überließ er Onkel Jupp, der bereits Kompanieführer war und das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen gekriegt hatte. Papa jedoch tat in Frankreich dasselbe wie vor dem Krieg in Deutschland: Er baute Straßen und Brücken.
»Zum Kämpfen ist er auch viel zu alt und zu vernünftig«, hatte Oma Elli dazu gesagt, »dem würde es doch verrückt vorkommen, auf einen anderen Menschen zu schießen.«
»Das kommt vielen Leuten verrückt vor«, hatte Mama geantwortet, »auch den jungen und unvernünftigen. Und wenn’s dann so weit ist und sie kriegen ein Gewehr in die Hand, dann schießen sie doch.«
»Aber bestimmt nur auf Feinde«, hatte Lilly sich eingemischt. »Und Feinde sind keine richtigen Menschen. So jedenfalls hat Lehrer Bender es uns erklärt. Feinde sind wie Juden.« Mama hatte Lilly einen kurzen zornigen Blick zugeworfen, so als wolle sie ihre Tochter zurechtweisen, aber dann hatte sie nur den Kopf geschüttelt, sich umgewandt und war ins andere Zimmer gegangen.
»Was ist denn los mit ihr?«, hatte Lilly Oma Elli gefragt.
»Sie ist sehr nervös und sie redet nicht gern über Politik. Außerdem ist gestern Doktor Rosenbaum abgeholt worden.«
»Doktor Rosenbaum, warum denn das?«
»Weil er Jude ist, natürlich.«
»Kann nicht sein. Der ist bestimmt kein Jude, es muss sich um einen Irrtum handeln.«
»Bei so was gibt’s keine Irrtümer«, hatte Oma Elli gesagt.
Hätte Lilly in der neuen Schule eine Freundin gefunden, dann wäre ihr wahrscheinlich sogar die Lateinstunde als heitere conditio sine qua non – das heißt »unerlässliche Bedingung« – erschienen. Aber die Mädchen, die ihr gefielen, allen voran die blonde Annelies Kretschmar, die schon Schaftführerin bei den Jungmädeln war, wollten sie nicht, und diejenigen, die sich um Lilly bemühten, fand sie blöd oder langweilig.
Einmal, ganz zu Anfang, hatte sie Annelies gefragt, ob sie nicht vielleicht gemeinsam ins Kino gehen wollten, in »Hitlerjunge Quex«.
Entschieden, wenn auch nicht unfreundlich, hatte Annelies abgelehnt.
»Und warum nicht?«
»Also, wenn du mich schon fragst und weil ich mich ja zur Wahrheit verpflichtet fühle: Ich kann nicht mit dir gehen, erstens weil du so jüdisch aussiehst und zweitens weil deine Mutter Engländerin ist.«
Lilly war der Unterkiefer heruntergefallen. »Jüdisch?«, hatte sie gestammelt. »Und wieso Engländerin?«
In allergrößter Ruhe hatte Annelies ihr erklärt: »Mit deinen dunklen Haaren und braunen Augen und schiefen Zähnen. Und dann kriegst du ja auch schon Busen. Juden sind nämlich frühreif. Deine Mutter ist ja genau der gleiche Typ, und man hat mir erzählt, dass sie nur gebrochen deutsch spricht.«
Lilly war ganz still geworden vor so viel gemeiner Verleumdung. Natürlich hätte sie sich wehren müssen, hätte ihren Onkel ins Feld führen können und ihren Vater und das Hitlerbild, das in ihrem Zimmer hing; aber sie hatte sich nur abgewandt, war davongegangen und hatte seitdem nie wieder das Wort an Annelies gerichtet.
Die ganze Angelegenheit war für Lilly besonders kränkend, weil sie nämlich den Führer Adolf Hitler sehr verehrte und sogar liebte. Das taten übrigens alle Menschen, die sie kannte, jedenfalls alle, die darüber sprachen. Vielleicht gab’s ja auch solche, die gegen ihn waren, aber die sagten es nicht.
Früher wollte Lilly immer möglichst schnell erwachsen werden – jetzt nicht mehr. Erwachsensein bedeutete momentan nichts als Mühsal und Sorgen. Sie wollte auch keine Verantwortung übernehmen müssen, sich nicht um den Luftschutz kümmern und um die Lebensmittelmarken und Bezugsscheine. Und schon gar nicht um Politik, wo man so anstrengend dafür sorgen musste, dass man selber immer Recht hatte und der andere Unrecht. Am liebsten wäre Lilly in einen Dornröschenschlaf versunken, um erst vom Friedensengel wieder wachgeküsst zu werden.
Oft hatte sie tatsächlich das Gefühl, in einer Art Schlaf zu sein. Sie mochte sich an nichts wirklich beteiligen, sie wartete. Sie wurde elf, zwölf Jahre, immer noch war Krieg, immer noch hatte sie keine Freundin. Sie fühlte sich sehr allein. Wenn sie ihren Baum nicht gehabt hätte, wäre es noch viel schlimmer gewesen.
Papa kam nur alle fünf, sechs Monate nach Hause und Onkel Jupp kämpfte inzwischen irgendwo in Russland. Mama lachte kaum noch. Sie trug keine roten Sachen mehr und war sehr schweigsam geworden.
Lilly fragte Oma Elli: »Warum redet Mama nicht mehr?«
Oma Elli zuckte die Schultern, überlegte einen Moment und antwortete dann: »Vielleicht hat sie Angst, das Falsche zu sagen.«
Während Papas letztem Urlaub vor sechs oder sieben Monaten hatte Mama so viel geweint, dass er sich schon nach einer Woche wieder davongemacht hatte, obgleich sein Urlaub eigentlich noch gar nicht abgelaufen war. »Sie hat eine Depression«, erklärte Oma Elli, »das ist eine Art Krankheit.«
Nur wenn Onkel Jupp auf Urlaub kam, war es fast wie früher. Dann lachte Mama sogar und wusch sich jeden Tag die Haare und schlug für den Nachtisch die Magermilch so lange mit dem Schneebesen, bis eine steife cremige Masse entstand, fast wie echte Schlagsahne.
Bei seinem letzten Urlaub im Februar zweiundvierzig hatte er ganze zwölf Tage bleiben dürfen, es war wunderbar gewesen. Am letzten Abend von Onkel Jupps Urlaub saßen sie alle noch lange beisammen, tranken und aßen und sprachen vom Frieden, von erleuchteten Straßen und vollen Geschäften und darf’s-ein-bisschen-mehr-sein und vom Tanzvergnügen. Kein Wort von Krieg. Sogar Joachim hielt sich zurück und spielte sich ausnahmsweise mal nicht als zukünftiger Held auf.
Spät in der Nacht, als sie alle längst zu Bett gegangen waren, wachte Lilly noch einmal auf. Unterwegs zum Klo hörte sie aus dem Wohnzimmer leise Musik. Sie schaute durch die angelehnte Tür, und das, was sie dort sah, würde für immer in ihrer Erinnerung hängen bleiben. Im Laufe der kommenden Jahre würde sie der Szene verschiedene Erklärungen zuordnen, freundlich liebevolle und auch böse, anklagende. Wirklich begreifen würde sie sie nicht:
Mama und Onkel Jupp tanzten miteinander. Mama hatte ein rotes Kleid an und ihre dunklen, lockigen Haare waren weder aufgesteckt noch zusammengebunden, sondern hingen offen herunter, fast bis zur Taille. Sie war barfuß und sah in Onkel Jupps großen Armen sehr zart und zerbrechlich aus.
Die beiden drehten sich ganz ruhig umeinander, nach einer langsamen Walzermelodie. Mamas Kopf war weit zurückgebeugt und auf ihrem Gesicht lag ein merkwürdiges Lächeln, nicht froh, aber auch nicht traurig, etwas sehr Fremdes, Fernes, etwas, das Lilly an ihrer Mutter noch nie gesehen hatte.
Onkel Jupps Gesicht dagegen war sehr streng, fast grimmig. Auf seiner Stirn standen feine Schweißperlen und seine sonst so lebhaften, fröhlichen Augen starrten blicklos über Mamas Kopf hinweg.
Sehr früh am nächsten Morgen musste der Onkel abreisen. Mama schloss sich im Schlafzimmer ein und war nicht zu bewegen, sich vom Onkel zu verabschieden. Und mit Joachim war in solchen Fällen ohnehin nicht zu rechnen. Für nichts und niemanden würde man ihn vor seiner üblichen Zeit aus dem Bett holen können. So waren es nur Oma Elli und Lilly, die Onkel Jupp das Geleit bis hinunter zur Straße gaben. Und als Oma Elli die Tränen kamen, da nahm Onkel Jupp sie in die Arme und stemmte sie hoch, als wäre sie nicht siebzig Kilo schwer, sondern leicht wie eine Feder. »Was hast du denn? Ich komme doch bald wieder. Kannst schon Gurken für mich einlegen und Plätzchen backen und Fleischmarken sammeln.«
Und zu Lilly sagte er: »Kümmere dich um deine Mutter, sie braucht dich jetzt. Auch wenn sie manchmal etwas schwierig ist, du musst ihr helfen und auf sie aufpassen.«
»Mach ich«, hatte Lilly gesagt und an den vorherigen Abend gedacht.
Seitdem waren drei Monate vergangen. Der Onkel kämpfte mit seiner Kompanie weit weg in Russland und die Nachrichten von ihm kamen spärlich. Einmal jedoch wurde sein Name sogar im Wehrmachtsbericht erwähnt, das war, als man ihm das Ritterkreuz verliehen hatte für irgendeine besonders tapfere Tat, durch die sich seine Kompanie aus einer nahezu aussichtslosen Lage ohne Verluste hatte befreien können.
Papa befand sich nach wie vor in Frankreich. Manchmal zweifelte Lilly daran, dass er überhaupt je wiederkommen würde. Lilly nahm es ihrer Mutter sehr übel, dass sie für Onkel Jupp lachte und für Papa nur Tränen übrig hatte.
Mamas Zustand hatte sich kaum gebessert, die zehn Tage mit Onkel Jupp waren nur eine kurze Unterbrechung gewesen. Sie sprach kaum, weinte oft, lag viel im Bett, und wenn sie auf war, schrieb sie Feldpostbriefe.
Eines Tages bat Mama Lilly, sie zum Arzt zu begleiten.
»Wieso?«, fragte Lilly erschrocken. »Bist du krank?«
»Nicht wirklich«, sagte Mama, »nur eine Routineuntersuchung, aber es wäre nett, wenn du mitkommst.«
Lilly war begeistert, dass ihre Mutter sie um etwas bat. »Gehst du zum Arzt wegen der Depressionen?«, fragte sie.
»Auch«, antwortete Mama.
Während ihre Mutter bei der Untersuchung war, saß Lilly allein im Vorzimmer bei der Sprechstundenhilfe. Die hatte einen großen breiten Busen und ein strenges Gesicht mit Haaren auf der Oberlippe. Direkt unterhalb des Doppelkinns prangte eine silbern gerandete Rot-Kreuz-Nadel und an der rechten Hand trug sie zwei Eheringe. »Na«, sagte sie, »was schaust du mich denn so an?«
Lilly wurde rot. »Ich hab mir bloß überlegt«, stotterte sie, »warum Sie zwei Eheringe tragen. Heißt das, dass Sie vielleicht zwei … ich meine … also zwei Männer, nicht direkt zwei Ehemänner natürlich, aber irgendwie … ach, ich weiß auch nicht.«
»Das heißt«, sagte die Schwester ohne eine Miene zu verziehen, »dass ich Witwe bin. Kriegerwitwe.«
»Oh«, sagte Lilly erschrocken, »tut mir Leid, wirklich.«
»Mir auch«, sagte die Schwester. »Sonst noch Fragen?«
Lilly nahm sich zusammen. »Ja, schon. Nämlich: Was ist eine Depression?«
»Das ist, wenn man grundlos traurig ist.«
Lilly horchte auf. »Grundlos?«
»Hm«, machte die Schwester.
»Und was ist, wenn man Grund hat?«
»Dann ist man nicht deprimiert, sondern einfach nur traurig.«
»Ja, dann …«, sagte Lilly nachdenklich, »dann kann es im Krieg eigentlich kaum Depressionen geben, weil doch fast jeder Grund hat, traurig zu sein.«
»Du bist gar nicht so dumm«, sagte die Schwester. »Bist du schon beim BDM?«
»Natürlich. Jungmädelschaft fünf Strich dreizehn.«
»Sehr gut.« Aus einer großen blauen Flasche schüttelte die Schwester ein paar Tabletten in die Hand und reichte sie Lilly: »Vitamin C zum Lutschen. Probier mal.«
»Kenn ich«, sagte Lilly, »die schmecken sehr gut.«
Es waren die gleichen Pillen, die täglich in der Schule ausgegeben wurden, eine pro Kind und Tag. Sie galten allgemein als Zahlungsmittel für kleine und große Gefälligkeiten. Natürlich nicht bei Annelies und ihrer Gruppe, aber bei den etwas weniger Verantwortungsbewussten wie Lilly. Dankbar griff sie zu.
»Die helfen gegen alles«, sagte die Schwester.
»Auch gegen Depressionen?«
Die Schwester sah Lilly ins Gesicht. »Wer ist denn deprimiert? Du?«
»Nein, ich bin nur manchmal traurig.«
»Wer denn sonst?«
»Meine Mutter. Deshalb ist sie zum Arzt gegangen.«
»Deprimiert, so so«, sagte die Schwester. Es klang nicht sehr überzeugt. »An welcher Front kämpft denn dein Vater?«
»Frankreich«, sagte Lilly. »Und er kämpft nicht, er baut Brücken und Straßen.«
»Kommt er oft auf Urlaub?«
»Nein. Er kann es nicht leiden, dass Mama so viel weint.«
Die Schwester zuckte die Schultern. »So sind sie eben, die Männer.«
»Aber Onkel Jupp kommt. Er ist Papas Bruder und kümmert sich um uns. Papa und Onkel Jupp sind sehr eng. Sie wechseln sich ab.«
»So so«, sagte die Schwester und steckte sich selbst ein Vitaminbonbon in den Mund.
Lilly überlegte, was sie anstellen könnte, um noch ein paar weitere Pillen zu ergattern. »Weinen ist irgendwie wehrzersetzend«, sagte sie, »finden Sie nicht auch?«
Mit gerunzelter Stirn sah die Schwester Lilly an. »Wann ist denn dein Vater zuletzt auf Urlaub gewesen?«
Plötzlich wurde Lilly die Unterhaltung sehr unangenehm. »Aber meine Mutter kann nichts dafür, wirklich nicht«, sagte sie hastig, »es ist nur wegen der Depression.«
»War dein Vater Ostern da? Und Weihnachten?«, beharrte die Schwester auf ihrer Fragerei.
Lilly wich aus. »Er schickt uns Pakete. Aber leider hat er wenig Zeit. Zu viele kaputte Straßen und Brücken. Und die Franzosen selbst können das wohl nicht so gut, deshalb muss mein Vater es machen, ist ja auch wichtig. Und richtig kämpfen, so wie in den Sondermeldungen, das macht dann mein Onkel Jupp.«
»Keine ernsthaften Leute, diese Franzosen«, sagte die Schwester. »Zu viel Parfüm und Schnickschnack. Nicht gut für unsere Jungs.«
Die Vorstellung, dass die Schwester mit »unsere Jungs« auch Papa gemeint haben könnte, fand Lilly ziemlich abwegig. »Aber mein Papa ist nicht so«, wehrte sie sich. »Und Onkel Jupp ist in Russland.«
»Lass mal«, sagte die Schwester, »mir brauchst du nichts zu erklären. Die Verhältnisse in deiner Familie sind kompliziert und unübersichtlich. Und ich bin allemal auf Seiten der Frauen.«
Irgendwie war das Gespräch falsch gelaufen. Lilly wusste nicht, wieso. Hatte die Schwester etwas gegen Papa? »Sie kennen meinen Vater doch gar nicht«, sagte sie.
Die Schwester zog die Augenbrauen hoch. »Dein Vater ist in Frankreich und kommt selten nach Haus. Ich hoffe, er tut da sein Bestes. So wie deine Mutter hier. Die ist zwar sehr zart und hat einen schwachen Kreislauf, aber sie ist keineswegs wehrzersetzend, sondern schwanger. Und während der Schwangerschaft verändert die Frau manchmal ihr Wesen, das liegt nicht am Charakter, sondern an der Biochemie.«
Mit offenem Mund starrte Lilly die Schwester an. »Was …?«
»Schwanger!«, donnerte die Schwester, als ob Lilly schwerhörig wäre. »Weißt du denn nicht, was das ist? Schwanger. Sie hat ein Baby im Bauch, trotz der komplizierten Verhältnisse in eurer Familie. Von jetzt ab wirst du dich intensiv um sie kümmern. Wir Frauen müssen zusammenhalten, vor allem, wenn der Feind nicht nur auf dem Feld der Ehre zu schlagen ist, sondern auch noch auf dem der Unehre.«
Lilly begriff immer weniger. »Welche Unehre und wessen Baby?«, stotterte sie.
»Das Baby deiner Mutter, verdammt noch mal!«
Lilly hatte noch nie eine Frau »verdammt noch mal« sagen hören. Die Schwester schien wirklich etwas verrückt zu sein. Und was sie jetzt hinzufügte, war noch verrückter: »Der Vater spielt dabei überhaupt keine Rolle. Jetzt, da die Männer so viel töten, müssen die Frauen umso mehr gebären. Und je weniger sie sich dabei auf ihre Männer verlassen, umso besser.«
»Aber mein Vater ist wirklich ein sehr guter und zuverlässiger Mensch«, sagte Lilly. »Das sagt auch meine Oma Elli. Und er hat noch nie jemanden getötet.«
»Genau«, sagte die Schwester, »ich hab’s kapiert. Für das Töten habt ihr Onkel Jupp, und dein Vater amüsiert sich in Frankreich. Und wenn deine Mutter auch zwei Männer hat, so muss sie ihr Baby trotzdem ganz allein austragen und zur Welt bringen. Und das wird nicht einfach sein. Hier …«, sie reichte Lilly die noch fast volle Tablettenflasche, »sorge dafür, dass sie täglich eine isst. Und dann gibt es ja auch Extralebensmittelmarken für Schwangere. Ich hoffe, ihr habt sie bereits angefordert.«
»Wann kommt denn …«, stotterte Lilly, »ich meine, wann soll es denn zur Welt kommen?«
»Soviel ich weiß, im November. Die schlechte Zeit ist vorüber, von nun an wird sie nicht mehr spucken und nicht mehr deprimiert sein. Dafür bist du mir verantwortlich!«
»Aber … weiß sie’s denn schon?«, fragte Lilly.
Die Schwester rollte die Augen gen Himmel. »Ich hab gedacht, du wärest ein kluges Mädchen.«
Auf dem Nachhauseweg jubelte Lilly. »Ich freu mich ja so! Wirklich, Mama, das ist das Beste, was mir seit Jahren passiert ist, vielleicht sogar das Allerbeste, seit ich auf der Welt bin!«
Mama warf ihrer Tochter, die ganz zapplig vor lauter Aufregung neben ihr herlief, einen erstaunten Blick zu. »Über was freust du dich denn so?«
»Über unser Baby natürlich.«
»Ach. Hat die Schwester es dir erzählt?«
Lilly nickte heftig. »Und sie hat auch gesagt, dass du dich jetzt nicht mehr übergeben musst und dass die Depression aufhört.«
»Hat sie gesagt, so so.« Mamas müde Stimme klang alles andere als begeistert. Sie sah aus, als ob sie bis oben hin angefüllt wäre mit Tränen.
O Gott, dachte Lilly, das Baby wird bei ihr ertrinken. »Hast du’s Papa schon geschrieben? Und Onkel Jupp?«, fragte sie.
Mama zuckte nur die Schultern.
So kam es, dass Lilly sich nun doch beteiligen und verantwortlich fühlen musste, allerdings nicht für Politik und die Kriegsauswirkungen und sonst welchen Erwachsenenkram, sondern für ein ungeborenes Baby und für dessen traurige Mutter, in der es heranwuchs. Deshalb tat sie, was immer sie konnte, um den gefährlichen Tränensee in ihrer Mutter auszutrocknen.
Kapitel 3
Vier Wochen nach dem ersten Arztbesuch kam Papa auf Besuch, ernst und streng wie immer. Und sehr traurig. Mama weinte und versteckte sich und verriegelte ihre Schlafzimmertür. Papa schlief im Gästezimmer.
Lilly hatte ihren Vater plötzlich so lieb, dass es ihr unter den Rippen brannte. »Als Onkel Jupp hier war, hat sie sich auch immer versteckt«, log Lilly. »Sie glaubt, dass ihr Männer schuld seid am Krieg. Und die Krankenschwester hat gesagt, dass Frauen sich während der Schwangerschaft oft verändern. Das liegt dann nicht am Charakter, sondern an der Biologie.«
Papa nickte. »Jaja, die Biologie.« Das klang fast so traurig, als ob Mama es gesagt hätte.
»Und ich freu mich nämlich schrecklich auf das Baby«, trumpfte Lilly auf.
Papa nahm Lillys Kopf in beide Hände und küsste sie auf die Stirn. »Zwischen Freud und Leid ist die Brücke nicht breit. Einer muss sich ja freuen. Und du bist stark, du wirst es schon schaffen.«
Beim Abschied küsste er auch Mama auf die Stirn, mit der gleichen Geste. Ganz so, als ob Mama und Lilly beide Papas Töchter wären.
Im Juli kam dann auch Onkel Jupp. Er sah sehr verändert aus, mit eingefallenen Wangen und mit einer Haut so zerfurcht, als wäre er mindestens sechzig Jahre alt. Zwar lachte er immer noch, sogar lauter als früher, aber seine Augen lachten nicht mit. Als Mama ihn begrüßte, fiel sie ihm weder um den Hals, noch strahlte sie ihn an. Sie sagte nur: »O Gott, was haben sie mit dir gemacht!«
In der darauf folgenden Nacht startete die englische Luftwaffe einen ersten Großangriff auf Lillys Heimatstadt.
Da Joachim sich mit seinem Fähnlein, dessen Führer er inzwischen war, im Ernteeinsatz befand und Oma Elli zu Frau Gössel nach Lesitz gefahren war, saßen sie nur zu dritt in der für die Familie Steinhöfer reservierten Ecke im Luftschutzkeller, als um sie herum das Chaos ausbrach. Draußen knallte und krachte und heulte es und hier drinnen schrien die Menschen vor Angst, einige stöhnten oder röhrten wie Tiere, und andere starrten in todesähnlichem Schweigen vor sich hin.
Lilly konzentrierte ihren ganzen Überlebenswillen auf das Baby, und das half ihr, einigermaßen ruhig zu bleiben und nicht ähnlich durchzudrehen wie die Frau Neuhauser aus dem zweiten Stock, die immer nur »Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben« schrie. Als die dicken Stützbalken unter der Decke zu ächzen und zu splittern begannen, warf sich Lilly quer über Mamas Schoß, um mit ihrem Körper das Baby zu schützen. Mama selbst gab keinen Ton von sich. Onkel Jupp hielt sie umfangen und hatte die freie Hand über ihre Augen gelegt.
Es dauerte nicht viel länger als eine halbe Stunde und das Haus blieb stehen. Als es still wurde und Lilly aufstehen wollte, gaben ihre Beine plötzlich unter ihr nach und sie rutschte auf den Boden.
Onkel Jupp zog sie hoch und sagte: »Was soll denn das, Blümchen, jetzt, wo’s vorbei ist.«
Sie stolperten die Kellertreppe hinauf zur Straße. Viele Häuser waren eingestürzt, andere brannten lichterloh, und der Gestank, der ihnen entgegenschlug, nahm ihnen fast den Atem. Mama, ihren Bauch weit vorgestreckt, hing wie leblos in Onkel Jupps Armen.
»Es stinkt nach verbrannten Menschen«, sagte Frau Neuhauser.
Onkel Jupp fuhr sie an: »Sie halten jetzt besser Ihren Mund, gute Frau. Es reicht schon, dass Sie uns unten im Keller mit Ihrem Geschrei auf die Nerven gegangen sind.«
»Und die da«, keifte Frau Neuhauser, die sonst doch immer vernünftig und nett war, »geht die einem etwa nicht auf die Nerven mit ihrem ewigen Ohnmachtsgetue?«
Da nahm Onkel Jupp Mama auf die Arme und trug sie nach oben in die Wohnung, wo alle Fensterscheiben zerbrochen waren und die Möbel kreuz und quer herumlagen, als hätte ein Riesenkind beim Spielen einen Wutanfall gekriegt.
Lilly hockte sich neben die umgekippte Vitrine, mitten zwischen die Scherben, und begann die wenigen heilen Kristallgläser aus den zerbrochenen herauszuklauben.
»Lass das jetzt«, sagte Onkel Jupp, »wir müssen erst einmal Mama ins Bett bringen.«
»Das kann ich allein«, sagte Mama.
»Aber ich helf dir dabei«, sagte Lilly.
Sie schüttelte die Scherben von Mamas Bett und breitete ein neues Tuch darüber.
Als Mama lag, lächelte sie sogar ein wenig. »Jetzt geht es mir besser«, sagte sie, »tut mir Leid wegen dem Ohnmachtsgetue.«
»Die Frau Neuhauser ist eine blöde Kuh«, sagte Lilly.
Onkel Jupp schien sehr nervös zu sein. Beim Aufräumen stieß er mehrmals wie in großer Wut mit dem Fuß gegen ein Möbelstück.
»Der Kleiderschrank kann doch nichts dafür«, sagte Mama leise.
»Kein fairer Kampf«, wütete Onkel Jupp. »Nicht mehr Männer gegen Männer, sondern Männer gegen Frauen und Kinder.«
»Machen unsere Leute doch auch, sogar im eigenen Land«, murmelte Mama. »Holen ganze Familien aus ihren Häusern und sperren sie ins Lager.«
Lilly kam Onkel Jupp zu Hilfe. »Das sind keine normalen Familien, Mama, das weißt du doch. Das sind Juden. Und die werden nicht eingesperrt, sondern in Schutzhaft genommen. So ist das.«
Mama seufzte. »Ja ja.«
Krachend warf Onkel Jupp eine Schaufel voller Scherben in den Abfalleimer. »Morgen früh werden wir von hier fortfahren, damit sie uns nicht doch noch erwischen.«
»Wohin?«
»Ich werde mir etwas einfallen lassen.«
Das, was Onkel Jupp sich einfallen ließ, hieß Domäne Staaken und war in Mecklenburg gelegen, am Rande des Dorfes Galitz. Es handelte sich um ein Staatsgut, sogar um einen Musterbetrieb, alles war hier sauber und ordentlich und sehr gepflegt, ganz anders, als Lilly es von Frieda Gössels Bauernhof her kannte.
Eine Woche lang wohnten sie im Dorfgasthof, dann zogen sie um in ein kleines Haus, das offenbar noch vor sehr kurzer Zeit von anderen Leuten bewohnt gewesen war. Lilly, die froh war, so schnell wieder ein eigenes Bett und sogar ein eigenes Zimmer zu haben, machte sich keine Gedanken über die Vorbewohner.
Überraschend kam Papa nach Staaken. Onkel Jupp hatte ihm eine Nachricht geschickt und Papa hatte Sonderurlaub bekommen.
Die beiden Brüder, die sich doch zuvor so gut verstanden hatten, sprachen kaum miteinander. Doch fuhren sie gemeinsam in einem großen Lastwagen, den Onkel Jupp organisiert hatte, nach Hamburg und holten aus der halb zerstörten Wohnung Möbel und Hausrat, um sie nach Staaken zu transportieren.
Kurz danach war Onkel Jupps Urlaub abgelaufen.
Als er ging, sagte Mama mit ungewohnt fester Stimme zu Papa: »Ich will, dass du dich richtig von ihm verabschiedest. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass du ihn siehst. Er ist dein Bruder!«
»Und du bist meine Frau!«
»Unsere eigenen Probleme werden wir später lösen. Jetzt ist Krieg.«
»Was haben unsere Probleme mit dem Krieg zu tun?«, sagte Papa. Aber er umarmte Onkel Jupp dennoch, so wie Mama es gewollt hatte.
Mit dem Fahrrad erkundete Lilly die Gegend. Das Dorf war klein. Den Mittelpunkt bildete eine große alte Schnapsbrennerei, deren dreistöckiger, klotziger Bau aus schwarzroten Ziegeln seltsam fremd inmitten der kleinen Häuser stand. Lilly, der man in der Schule und beim BDM eine romantische Vorstellung vom Landleben beigebracht hatte, war enttäuscht über die Armut und Hässlichkeit des Dorfes.
Ganz am Ende der Dorfstraße in Richtung Lehseburg befand sich in einem struppigen, ungepflegten Park das Schloss. Leider war es aber kein golden schimmernder, türmchenbewehrter Märchenpalast, sondern ein schmutzig grauer, riesengroßer Kasten mit fünf bröckelnden Säulen davor. Und es wohnte auch keine wunderschöne Prinzessin darin und nicht einmal eine vornehme Grafenfamilie, sondern eine Gruppe Arbeitsmaiden, die hier als Hilfskräfte bei den Bauern eingesetzt wurden.
Im Dorfladen hörte Lilly, wie eine Frau zu der anderen sagte: »Diese Stadtfräuleins sollte man lieber lassen, wo sie hingehören. Hier sind sie zu gar nichts gut. Wenn unsere Jungs auf Urlaub kommen, verdrehen die ihnen die Köpfe mit ihrem Getue. Und unsere Mädels haben das Nachsehen.«
Zwischen dem Gut und Galitz lag ein ausgedehnter Mischwald mit dichtem Unterholz. Auf der Suche nach einer neuen Baumhöhle radelte Lilly eines Tages weit in diesen Wald hinein. Als der Weg, eher ein schmaler Trampelpfad, nicht mehr befahrbar war, ließ sie ihr Rad stehen und ging zu Fuß weiter. Es war sehr heiß, das immer dichter werdende Gestrüpp zerkratzte Lillys Arme und Beine, und gerade als sie beschloss, doch besser umzukehren, stieß sie auf einen schmalen Fluss, der träge plätschernd zwischen den Bäumen dahintrödelte. Das Ufer war mit hohem Schilf bestanden und mit Mümmelchen und Wiesenschaumkraut und Pechnelken verziert. Und dort, wo das Flüsschen eine Biegung machte, reichte moosiges Gras direkt bis ans Wasser. Lilly hatte so etwas noch nie in Wirklichkeit gesehen, nur im Kino oder in Bilderbüchern. Sie zog ihre Sandalen aus, steckte den Rocksaum ins Taillenband und watete beglückt am Ufer entlang. Und dabei entdeckte sie etwas, das ihr zuerst einen großen Schreck einjagte: eine Hütte, direkt hinter der Biegung des Flüsschens gelegen und nur vom Wasser her einzusehen.
Vorsichtig stieg sie ans Ufer zurück und blieb eine Weile im Gras sitzen.
Eine Hütte, was war das schon. Vermutlich hatte jemand sie vor langer Zeit gebaut und inzwischen längst vergessen. Ein einsames Waisenkind vielleicht oder sogar die schöne blondlockige Prinzessin, die im Schloss gewohnt hatte, bevor sie vom Arbeitsdienst vertrieben worden war.
Lilly schaute sich die Sache etwas genauer an und war enttäuscht. Eine wacklige Konstruktion aus alten Brettern und ineinander geflochtenen Zweigen. Statt der Tür hing über dem niedrigen Eingang eine alte Pferdedecke, an deren oberer Ecke Lilly zu ihrer Überraschung das Zeichen der Domäne Staaken entdeckte. Lilly lüftete die Decke ein wenig, sah, dass die Hütte leer war, und schob sich hinein. Drinnen war es dämmrig und es roch nach Erde und Baumrinde und trockenem Gras, kaum anders als draußen, nur intensiver. In der hinteren Ecke befand sich ein Laubbett. Dann gab es noch eine große Kiste als Tisch und eine kleine als Stuhl. Auf der Tischkiste lag ein zerfleddertes Buch, »Heidis Lehr- und Wanderjahre«. Ein Mädchen also, dachte Lilly, denn sie wusste von Joachim, dass Jungen dieses Buch absolut weibisch und bescheuert fanden.
Lilly legte sich auf das Lager, das angenehm weich war, und dachte nach. Als sie zu Ende gedacht hatte, war sie zu dem Entschluss gekommen, dass das Mädchen, Prinzessin oder Waisenkind oder was auch immer, inzwischen erwachsen geworden war und die Hütte längst vergessen hatte. Das Heidibuch gab’s schon seit vielen Jahren und die Pferdedecke war zerschlissen und hatte alle Farbe verloren, kein Diebstahl aus jüngster Zeit. Und so stand Lillys Inbesitznahme der Hütte eigentlich nichts entgegen. Wenn der Onkel ein ganzes Haus organisieren konnte, dann war es ja wohl in Ordnung, dass Lilly eine leere Hütte übernahm.
Von nun ab verbrachte sie jede freie Stunde am Fluss. Sie war sehr vorsichtig und achtete immer darauf, dass niemand sie sah, wenn sie von der Straße in den Wald abbog. Und während Papa das Familienhaus, das zuvor anscheinend ziemlich vernachlässigt worden war, in Ordnung brachte, tat Lilly das Gleiche mit ihrer Hütte.
Niemand fragte, was sie da draußen trieb, alle waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Nur Mama schaute manchmal nachdenklich ihre Tochter an, und einmal sagte sie: »Dir geht’s hier besser als in Hamburg, oder?«
Lilly nickte.
»Keine Angst vor der neuen Schule?«
Lilly schüttelte energisch den Kopf. »Schlimmer als zu Haus kann’s nicht werden.«
»War es wirklich so schlimm?«
»Hab ich dir doch erzählt«, sagte Lilly. »Aber du hörst ja nie zu.«
»Doch, doch«, entgegnete Mama, »ich hör dir schon zu. Es ist nur, weil es doch momentan so viel Schlimmeres auf der Welt gibt als Ärger in der Schule.«
Plötzlich kriegte Lilly einen Wutanfall, ebenso unsinnig wie unkontrollierbar. »Typisch«, schrie sie, »du nimmst mich eben nicht ernst und hast mich nie ernst genommen. Immer und ewig gibt’s für dich Wichtigeres und Schlimmeres. Aber lass mal, ich komm schon allein zurecht.« Und damit rannte sie aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
Da Oma Elli den neuen Haushalt noch nicht wieder so fest unter Kontrolle hatte wie den alten in Hamburg, konnte Lilly unbemerkt ein paar Gegenstände mit zur Hütte nehmen, Teller und Becher, eine Wolldecke, Messer, Gabel, Löffel und sogar ein kleines Tischtuch für die Holzkiste. Von Tag zu Tag fühlte sie sich sicherer und sie machte bereits Pläne, wie sie im kommenden Frühjahr das Baby hierher bringen würde.