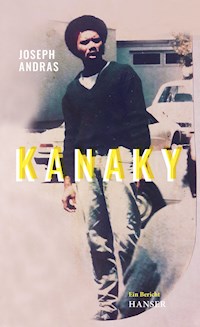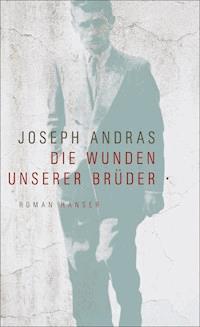
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fernand Iveton ist dreißig, als er im November 1956 für die algerische Unabhängigkeitsbewegung in einem verlassenen Gebäude eine Bombe legt. Der Algerienfranzose will ein Zeichen setzen, ohne Opfer zu riskieren. Doch Iveton wird verraten und noch vor der Detonation verhaftet. Nach tagelanger Folter verurteilt ein Militärgericht in Algier ihn zum Tode, und unter Mitterrand, dem damaligen Justizminister Frankreichs, wird er am 11. Februar 1957 hingerichtet. Ein Franzose auf Seiten der Algerier ist nicht tragbar. Joseph Andras erzählt diese wahre, ungeheuerliche Geschichte in all ihrer Aktualität. Sein gefeiertes Debüt ist ein literarisches Kunststück, „kurz und dicht birgt es eine unerhörte Kraft.“ (Le Monde)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernand Iveton ist dreißig, als er am 14. November 1956 für die algerische Unabhängigkeitsbewegung FLN eine Bombe legt. Der Algerienfranzose und Kommunist will nicht mehr nur reden, sondern im Kampf für die Freiheit seines Landes ein klares Zeichen setzen. Um keine Opfer zu riskieren, deponiert Iveton den Sprengsatz in einem verlassenen Gebäude einer Gasfabrik in Algier. Doch noch vor der Detonation wird er verhaftet. Nach tagelanger Folter fällt vor einem Militärgericht das Todesurteil, und nur drei Monate später, am 11. Februar 1957, wird Iveton unter dem damaligen Justizminister François Mitterrand in Algier hingerichtet. Joseph Andras erzählt Ivetons Verhaftung und Prozess in schnellen, scharf geschnittenen Bildern. Dazwischen entfaltet er in Rückblenden dessen private Geschichte – die Kindheit in einem arabischen, fast dörflichen Viertel von Algier, das Leben als Fabrikarbeiter mit kommunistischen Überzeugungen, den der Tod des besten Freundes zum politischen Handeln treibt, die große Liebe zu seiner Frau Hélène. All das verschmilzt zu einem dichten, zutiefst menschlichen Roman, der ein neues Licht auf Frankreichs Kolonialgeschichte und die Hintergründe vieler heutiger politischer Entwicklungen wirft.
Hanser E-Book
JOSEPH ANDRAS
DIE WUNDEN UNSERER BRÜDER
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Hamm
Carl Hanser Verlag
Iveton bleibt ein irgendwie verfluchter Name … Man fragt sich, wie Mitterrand das ertragen konnte. Ich musste den Namen zwei-, dreimal in seiner Gegenwart erwähnen, er löste jedes Mal ein fürchterliches Unbehagen bei ihm aus, das sich in einen Schluckauf verwandelte … Da prallt man auf die Staatsräson.
BENJAMIN STORA UND FRANÇOIS MALYE,
François Mitterrand et la guerre d‘Algérie
Kein aufrechter, stolzer Regen, nein. Kümmerliches Geniesel. Verkniffen. Halbherzig. Fernand wartet zwei, drei Meter neben der asphaltierten Straße im Schutz einer Zeder. Dreizehn Uhr dreißig hatten sie gesagt. Mehr als vier Minuten. Dreizehn Uhr dreißig, so war es doch. Unerträglich, dieser kriecherische Regen, nicht mal Mut zu ordentlichen Bindfäden, nur ein paar geizige Tropfen, die mit spitzen Fingern den Nacken befeuchten, so einfach kann man es sich machen. Drei Minuten. Fernands Blick klebt an seiner Uhr. Ein Auto fährt vorüber. Ist sie es? Der Wagen hält nicht. Vier Minuten Verspätung. Hoffentlich nichts Schlimmes. In der Ferne das nächste Fahrzeug. Ein blauer Panhard. Nummernschild aus Oran. Sie hält am Straßenrand – der Kühlergrill scheppert, ein altes Modell. Jacqueline ist allein gekommen, beim Aussteigen schaut sie sich um, erst nach links, dann nach rechts und noch einmal nach links. Hier, die Papiere, es steht alles drauf, Taleb hat an alles gedacht, keine Sorge. Zwei Zettel mit genauen Angaben, einer pro Bombe. Zwischen 19 Uhr 25 und 19 Uhr 30. Zündfrist 5 Minuten … Zwischen 19 Uhr 23 und 19 Uhr 30. Zündfrist 7 Minuten … Er macht sich keine Sorgen: Sie ist da, hier, nur das zählt. Fernand schiebt die Blätter in die rechte Tasche seines Blaumanns. Als er sie zum ersten Mal bei einem Genossen gesehen hat, die Jacqueline, bei gedämpften Stimmen und Lichtern, wie es sein muss, hat er sie für eine Araberin gehalten. Dunkel war sie, sehr dunkel, das schon, lange Hakennase und volle Lippen, das schon, aber trotzdem, nein, keine Araberin … Rund gewölbte Lider über großen, dunklen und doch offen lachenden Augen, schwarzen Früchten mit leichten Schatten darunter. Eine schöne Frau, kein Zweifel. Sie hebt zwei Schuhkartons aus dem Kofferraum, Größe 42 und 44 steht auf der Seite. Zwei? Oh, das geht nicht. Ich habe nur diese Tasche hier, schau, die ist nicht groß genug, mehr als eine passt da nicht rein. Außerdem hat mich der Vorarbeiter im Visier, ich fliege auf, wenn der mich mit einer zweiten Tasche zurückkommen sieht. Doch, wirklich, glaub mir. Fernand hebt eine der Schachteln ans Ohr: Was für ein Höllenlärm, sag mal, tick tack tick tack tick tack, bist du sicher, dass …? Taleb hat getan, was er konnte, besser ging’s nicht, aber alles wird gut gehen, keine Sorge, erwidert Jacqueline. Klar. Steig ein, ich setz dich ein Stück weiter ab. Komischer Name, die Ecke hier, nicht? Über irgendwas muss man ja reden, sagt sich Fernand und denkt, solange es nicht getan ist, redet man besser sonstwas als darüber. Die Schlucht der Wilden Frau. Kennst du die Legende?, fragt sie. Nicht wirklich. Oder ich habe sie vergessen … Eine Frau – es war im letzten Jahrhundert, aber das macht uns auch nicht jünger – , eine Frau hatte ihre zwei Kinder im Wald dort unten verloren, nach einer Mahlzeit, einem Picknick, einem kleinen Nickerchen im Gras im Frühling – aufzeichnen muss ich es dir wohl nicht –, die armen Kleinen waren in der Schlucht verschwunden, niemand hat sie je wiedergefunden, und die Mutter drehte vollkommen durch, sie wollte nicht aufgeben, sie suchte ihr ganzes Leben lang weiter nach ihnen, deshalb nannte man sie die Wilde, sie sprach nicht mehr und stieß höchstens kurze Schreie aus wie ein verletztes Tier, tja, und irgendwann fand man irgendwo ihre Leiche, vielleicht dort, wo du auf mich gewartet hast, wer weiß? Fernand lächelt. Komische Geschichte, wirklich. Sie hält an. Steig hier aus, die sollen das Auto nicht in der Nähe der Fabrik sehen. Viel Glück. Er steigt aus dem Fahrzeug und winkt ihr nach. Jacqueline erwidert den Gruß und drückt aufs Gaspedal. Fernand schiebt die Sporttasche auf seiner Schulter zurecht. Blassgrün mit einem hellen Streifen an der Riemenöffnung – ein Freund hat sie ihm geliehen, sonst geht er sonntags damit Basketball spielen. So natürlich wie möglich aussehen. Als ob nichts wäre, gar nichts. Seit mehreren Tagen schon trägt er sie mit sich zur Arbeit, um den Blick des Wachpersonals daran zu gewöhnen. An etwas anderes denken. Die wilde Frau aus der Schlucht, komische Geschichte, wirklich. Mom’ ist da. Seine schwere, entschlossene Nase über dem Schnauzbart. Alles noch in Ordnung? Ja, klar, ich war nur ein bisschen draußen, mir die Beine vertreten, die Maloche heut Morgen hat mich ziemlich erledigt. Mit dem Regen hat das nichts zu tun, Mom’, ’ne Lappalie, sag ich dir, nur ein kleiner Sprühregen, gleich wieder vorbei … Lappalie, Lappalie, wie der redet, dieser Franzmann. Mom’ klopft ihm auf die Schulter. Fernand denkt an die Bombe in seiner Tasche, die Bombe und ihr Tick-tack-tick-tack. Vierzehn Uhr, Zeit, um an die Maschinen zurückzukehren. Ich komme, Mom’, ich stell nur meine Tasche ab, ja, bis gleich. Fernand fegt mit einem Blick den Hof durch und dreht sich wohlweislich nicht um. Als ob nichts wäre. Keine plötzliche Bewegung. Er schlendert zu dem leerstehenden Raum, den er vor drei Wochen gefunden hat. Der Gasometer der Fabrik wäre unerreichbar gewesen, drei Wachposten hätte er überwinden müssen und Stacheldrahtzäune. Schlimmer als eine Bank mitten in der Stadt oder ein Präsidentenpalast – ganz zu schweigen davon, dass man sich von Kopf bis Fuß ausziehen muss, bevor man hineindarf, zumindest fast. Unmöglich halt. Außerdem zu gefährlich, viel zu gefährlich, hatte er dem Genossen Hachelaf anvertraut. Keine Toten, vor allem keine Toten. Besser der kleine, verlassene Raum, den nie jemand betritt. Matahar, der alte Arbeiter mit dem Gesicht wie zerknittertes Papier voller Senf, hatte ihm ohne das geringste Misstrauen den Schlüssel gegeben – nur für eine kleine Siesta, Matahar, ich gebe ihn dir morgen zurück, sag den anderen nichts, versprochen? Nur eine Antwort hatte der Alte darauf gehabt, , von mir erfährt niemand ein Sterbenswörtchen, Fernand, schlaf ruhig. Er zieht den Schlüssel aus seiner rechten Tasche, dreht ihn im Schloss, schaut verstohlen hinter sich, niemand, geht hinein, öffnet den Schrank, stellt die Sporttasche ins mittlere Fach, schließt die Tür wieder und dreht den Schlüssel einmal um. Dann geht er zum Haupteingang der Fabrik, grüßt wie üblich den Wachmann und begibt sich an seine Werkzeugmaschine. Siehst du, Mom’, der Regen hat schon aufgehört. Ja, tatsächlich, er hat es bemerkt, trotzdem, ein Novemberdreckswetter, auch wenn es nur sein eigenes graues Gesicht beleidigt. Fernand setzt sich an seine Drehmaschine und zieht seine an den Handgelenken abgewetzten Handschuhe über. Ein Kontaktmann, dessen Namen und Vornamen er nicht kennt, wird heute Abend um neunzehn Uhr, kurz bevor die Bombe explodiert, am Fabrikausgang auf ihn warten. Dann wird er ihn zu einem Versteck fahren, dessen Adresse er ebenfalls nicht kennt, er weiß nur, dass es sich in der Kasbah befindet, von wo aus er dann zum Unterschlupf gelangen soll. Vielleicht am nächsten Morgen oder ein paar Tage später, darüber entscheidet nicht er. Hinter der Maschine bleiben und geduldig auf Betriebsschluss warten, wie jeden Tag und wie jeder, die grünen, abgewetzten Handschuhe ablegen, wie immer, ein bisschen mit den Freunden scherzen, bis morgen, das war’s, schönen Abend zusammen, grüß die Familie. Nicht den geringsten Verdacht erwecken: Hachelaf hat es ihm noch und noch einmal eingeschärft. Fernand versucht, an nichts zu denken, doch er denkt an Hélène, er kann nicht anders – das Gehirn, dieses anderthalb Kilo schwere Balg, ist launisch. Wie wird sie reagieren, wenn sie erfährt, dass ihr Mann Algier verlassen hat, um in den Untergrund zu gehen? Ahnt sie es schon? War es wirklich richtig, dieses Geheimnis für sich zu behalten? Die Genossen waren sich sicher. Der Kampf zwingt die Liebe zu Versteckspielen, die Ideale fordern ihre Opfer – der Kampf und das Blau der Blumen verhalten sich wie Hund und Katz zueinander. Doch, für den reibungslosen Ablauf der Sache war es besser. Es ist fast sechzehn Uhr, als man ihn von hinten ruft. Fernand dreht sich um, will auf das Fragezeichen antworten, das seinen Namen heraushebt. Bullen. Verdammt. Kaum dass ihm die Idee kommt loszurennen, packt man ihn schon und hält ihn fest. Sie sind zu viert, vielleicht zu fünft – auf die Idee, sie zu zählen, kommt er jetzt nicht. Etwas weiter entfernt der Vorarbeiter Oriol, der vorgibt, nicht zu … – und doch muss sich sein schmales Drecksmaul zwingen, nicht zu lächeln, nichts zu verraten, man weiß ja nie, was man so hört, sind die Kommunisten Meister der Vergeltung. Drei Soldaten eilen herbei, bestimmt Gefreite der zur Hilfe geholten Luftwaffe. Wir haben die Fabrik umzingelt und alles durchsucht, bis jetzt haben wir nur eine Bombe entdeckt, in einer grünen Tasche in einem Schrank, berichtet einer von ihnen. Ein Bubi. Bartloses Baby. Kindskopf unter rundem Käppi. Alle drei tragen Maschinengewehre über der Schulter. Fernand sagt nichts. Wozu auch? Er hat eine fürchterliche Niederlage erlitten, seine Zunge hat zumindest den Anstand, das zuzugeben. Einer der Polizisten durchwühlt seine Taschen und findet in der rechten Talebs Zettel. Es gibt also noch eine weitere Bombe. Aufregung in den vereidigten Köpfen. Wo ist sie, herrscht es Fernand an. Es gibt nur eine, das ist ein Irrtum, Sie haben sie schon gefunden. Bringt ihn ins Hauptrevier von Algier, sofort, befiehlt der Chef. Oriol hat sich nicht von der Stelle bewegt; wäre ja schade, auch nur ein Fitzelchen zu verpassen. Als Fernand, jetzt in Handschellen, an ihm vorbeigeführt wird, mustert er ihn: Fernand hat mit einem als Schuldbekenntnis getarnten Grinsen gerechnet, doch nichts da, nicht mal ein Zucken; der Vorarbeiter bleibt unbewegt und sichtlich heiter und unbeirrt, sollen die Soldaten doch die Sache regeln. Hat er ihn verpfiffen? Hat er ihn den Raum betreten und ohne Tasche herauskommen sehen? Oder war es der alte Matahar? Nein, so etwas würde der Alte nicht tun. Nicht wegen einer kleinen Siesta. Der Kastenwagen rumpelt durch die Stadt. Der Himmel wie ein nasser Hund, voller angeschwollener Wolken. Bleierner Winter. Wir wissen, wer du bist, Iveton, auch wir haben unsere Zettelchen, ein Kommunistenarschloch bist du, wir wissen es, aber drüben im Revier wirst du nicht mehr großtun mit deiner kleinen Fresse, Iveton, mit deinem kleinen Kameltreiberbärtchen, da drüben wirst du dein Maul schon aufmachen, glaub uns das, dafür haben wir ein Händchen, wir kriegen, was wir wollen, glaub mir, mit deiner dreckigen Kommunistenfresse tun wir, wozu wir lustig sind, wir bringen selbst einen Stummen zum Plaudern, der singt uns eine Arie nach der anderen, wir müssen nur mit den Fingern schnipsen. Fernand antwortet nicht. Seine Hände sind im Rücken gefesselt, er starrt auf den Fahrzeugboden. Abgenutztes, gesprenkeltes Grau. Schau uns an, wenn wir mit dir reden, Iveton, weißt du, du bist jetzt ein großer Junge, du musst jetzt Verantwortung übernehmen für das, was du anstellst, kapierst du, Iveton? Einer der Polizisten zieht ihm eine über, es ist kein heftiger Schlag, keiner, der knallt, eher ein dumpfer, der demütigt, statt zu schmerzen. Boulevard Baudin. Die Arkaden. Sie steigen in die erste Etage hinauf zum Polizeirevier. Ein quadratischer Raum, vier mal vier Meter, ohne Fenster.
Der Schuhkarton steht auf dem Küchentisch. Nein, das ist viel zu gefährlich, rühr ihn nicht an, sagt Jacqueline. Die Zeitschaltuhr tickt pausenlos, es ist zum Verrücktwerden, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Bist du sicher?, fragt Djilali – das Personenregister führt ihn als Abdelkader, und manche Aktivisten, man verliert fast den Überblick, nennen ihn Lucien. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Ganz sicher. Gehen wir zu Jean, der kennt sich da besser aus, wahrscheinlich weiß er, wie man die entschärft. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Jacqueline öffnet einen der drei Schränke und holt eine metallene Zuckerdose heraus. Leert den Inhalt aus und versucht, die Bombe darin unterzubringen. Zu klein – Djilali hatte es gleich gesehen.
Wo ist die Bombe, du Hurensohn? Fernands Augen sind mit einem dicken, zerfetzten Tuch verbunden. Sein Hemd liegt am Boden, die meisten Knöpfe abgerissen. Aus einem Nasenloch blutet er. Ein Bulle schlägt zu, so fest er kann; der Kiefer knackt. Wo ist die Bombe?
Jacqueline hat den Sprengkörper in weißes Papier gewickelt und das Etikett von der Zuckerdose gelöst, nun klebt sie es vorsichtig auf das Paket. Das dürfte im Fall einer Kontrolle erst einmal ablenken. Djilali beißt die Zähne zusammen. Tick tack, tick tack, tick tack. Sie steckt das Paket mit einigen Tafeln Bitterschokolade und ein paar Billigseifen in eine große Einkaufstasche.
Mit angezogenen Beinen auf dem Linoleumboden versucht Fernand, seinen Schädel zu schützen. Eine Sohle knallt an sein rechtes Ohr. Mach ihn nackt, wenn er nicht reden will. Zwei Polizisten zerren ihn hoch, und während sie ihn unter den Armen festhalten, schnallt ein dritter ihm den Gürtel auf und zieht ihm die Hose und seine marineblaue Unterhose herunter. Legt ihn auf die Bank! Seine Hände und Füße sind gefesselt. Ich muss durchhalten, sagt er sich, ich muss standhaft bleiben. Für Hélène, für Henri, das Land, die Genossen. Fernand zittert. Und schämt sich, dass er jetzt so wenig Kontrolle über seinen Körper hat, sein eigener Körper könnte ihn verraten, ihn aufgeben, an den Feind verkaufen. Es steht doch auf deinen Zetteln, in zwei Stunden geht sie hoch, wo habt ihr sie versteckt?
An der Tür klopft es. Hämmert es. Polizei! Aufmachen! Hélène ist sofort klar, dass sie wegen Fernand da sind. Wenn sie hierherkommen, dann haben sie ihn nicht bei sich. Ist er auf der Flucht? Was hat er bloß gemacht? Sie stürzt ins Schlafzimmer, reißt ein Dutzend Blätter aus dem Nachttisch, und zerpflückt sie in kleine Stücke. Polizei! Aufmachen! Es trommelt. Fernand hatte es ihr eingeschärft: Wenn mir mal etwas zustößt, zerstörst du das alles sofort, ja? Sie rennt zur Toilette, wirft die Schnipsel hinein, zieht die Spülung. Ein paar Fetzen schwimmen noch an der Oberfläche. Sie zieht noch einmal.
Die Bombe, du Arsch, rede! Die Elektroden kleben am Hals, an den Kopfwendemuskeln. Fernand heult auf. Er erkennt seine eigenen Schreie nicht wieder. Raus damit! Der Strom brennt ins Fleisch. Bis zur Lederhaut ist er schon gedrungen. Sobald du redest, hören wir auf.
Djilali und Jacqueline erreichen den Platz. Ein paar Nonnen gehen an einem alten, bärtigen Mann mit Turban vorbei, ein anderer, jüngerer Araber, aber mit einem dunkelbraunen Anzug bekleidet, hilft ihm beim Überqueren, so betagt zittert der Alte auf seinem Stock dahin. Die Kakophonie der Automobile und Oberleitungsbusse, ein Fahrer schimpft und schlägt mit der flachen Hand gegen die Tür seines Fahrzeugs, ein paar Jungen spielen unter einer Palme Ball, eine Frau in Haik trägt ein in ihre Umarmung verkrochenes Kleinkind. Die zwei sagen nichts, aber sie bemerken es beide: Die Mannschaftswagen der Compagnies Républicaines de Sécurité in den Straßen kann man kaum noch zählen. Die ersten Attentate, zu denen der FLN sich bekannt hat, haben die Nerven der Stadt gelinde gesagt blankgelegt. Noch niemand nennt ihn so, aber er ist da: der »Krieg«, den man der öffentlichen Meinung unter dem bescheidenen Namen »Ereignisse« verkauft. Erst Ende September die Explosionen in der Milk-Bar und im La Cafétéria in der Rue Michelet und dann vor zwei Tagen der Bahnhof von Hussein Dey, der Monoprix in Maison-Carrée, ein Reisebus, ein Zug auf der Strecke Oujda-Oran und zwei Cafés in Mascara und Bougie … Jean wohnt in der Rue Burdeau. Geh lieber zuerst allein rauf, flüstert Djilali Jacqueline zu, dann kann ich dir den Rücken decken. Sie stößt die Tür mit ihrer Einkaufstasche auf. Er schaut sich um, nichts Verdächtiges, kein Polizist weit und breit.
Aufmachen! Hélène zerzaust sich das Haar und zerwühlt das Bett. Sie öffnet das Schlafzimmerfenster, tut, als ob sie gähnt, und entschuldigt sich bei den Polizisten, Verzeihung, ich habe geschlafen, ich habe Sie eben erst gehört. Drei Tractions stehen vor ihrem Haus. Die Arroganz glänzenden Metalls. Etwa zehn Männer. Was wollen Sie von mir?, fragt sie. Sehen Sie das nicht? Wir haben einen Durchsuchungsbefehl, machen Sie auf, sofort! Ich bin allein, ich muss Ihnen nicht öffnen, ich kenne Sie ja gar nicht, was beweist mir, dass Sie wirklich von der Polizei sind? Hélène sagt sich, wenn Fernand etwas passiert ist, ist es wohl das Beste, Zeit zu schinden und sie so lange wie möglich aufzuhalten. Einer der Polizisten ist sichtlich irritiert und verschärft den Ton, er befielt ihr zu öffnen, sonst brächen sie die Tür auf. Aber was wollen Sie denn? Meinen Mann? Der ist in der Fabrik, gehen Sie doch direkt zu ihm! Hélène rührt sich nicht vom Fenster. Wir schlagen die Tür ein!
Warum deckst du die fells, was nützt dir das? Pack aus und wir hören auf, Iveton, los, mach dein Maul auf! Die Elektroden sind an seinen Hoden befestigt. Ein Polizist sitzt auf einem Schemel und treibt mit Pedalen den Dynamo an. Fernand, dessen Augen immer noch verbunden sind, brüllt wieder auf. Ich muss durchhalten, ich muss dichthalten. Nichts preisgeben, nichts rausrücken. Den Genossen wenigstens die Zeit lassen, sich, sobald sie es begreifen, in Sicherheit zu bringen, wenn sie es nicht schon wissen, aber wie sollten sie, wie spät ist es eigentlich, wenn sie nicht wissen, dass ich verhaftet wurde. Ja, wie spät ist es überhaupt? Warum verrätst du deine eigenen Leute, Iveton?
Jean steht über die Bombe gebeugt. Der Raum ist abgedunkelt, fahles Licht. Jacqueline hat sich auf den einzigen Stuhl gesetzt, Djilali kommt mit zwei Glas Wasser aus der Küche zurück. Tick tack, tick tack, tick tack. Kannst du sie stoppen? Jean verzieht unschlüssig das Gesicht. Er hat es schon einmal geschafft, ja, aber das war ein anderes Modell, diesmal ist er nicht sicher, ob er den Mechanismus versteht. Er blickt auf die Drähte, die die Bombe mit dem als Zeitschaltung eingesetzten Jaz-Wecker verbinden. Taleb hat Jacquelines Vornamen weiß auf die Bombe geschrieben. Hommage an die Aktivistin, die Schwester im Kampf, die ihr Leben für Algerien riskiert, ohne Moslemin oder Araberin zu sein – Jacqueline ist Jüdin. Wenn du dir nicht sicher bist, fass lieber nichts an, sonst fliegt sie uns noch um die Ohren. Jean schlägt vor, sie weit wegzuschaffen, an einen abgelegenen Ort außerhalb der Stadt, wo es niemanden hinverschlägt. Warum nicht zu den Terrin-Kohlengruben?, schlägt Djilali vor, ja, das ist nicht dumm, dort geht man kein Risiko ein.
Wenn du nicht auspackst, stecken wir dir das Ding in den Arsch, kapierst du das, kapierst du? Fernand hätte nie geglaubt, dass Folter das ist, dieFrage, die berühmte, die nur eines zur Antwort will, das Immergleiche, das unverändert Selbe: die Namen der Brüder. Dass es so schrecklich sein würde. Nein, das ist das falsche Wort. Das Alphabet ist schamhaft. Vor dem Grauen streichen sechsundzwanzig kleine Buchstaben die Segel. Er spürt den Lauf einer Waffe an seinem Bauch. Pistole oder Revolver? Sie drückt sich ein oder zwei Zentimeter über dem Bauchnabel ins Fleisch. Ich durchlöcher dir den Wanst, wenn du nicht auspackst, hast du verstanden oder brauchst du’s auf Arabisch?
Jean hat Jacqueline und Djilali aufgefordert, zurück nach Hause zu gehen, diesmal vorsichtig, besser nicht zu lange zusammenbleiben. Die Nacht mischt Ruß, Kohle, ausgeschienene Sonne in die Stadt, der Muezzin ruft die Gläubigen in der Rue de Compiègne zum Gebet, , Jean zündet sich mit seinem Gasfeuerzeug eine Zigarette an, er fährt weiter geradeaus, kommt zur Rampe Frédéric Chasseriau, auf dem Gehsteig Jungen auf Eselrücken, es wird gelacht und gelacht, Chasseriau … wer war das noch mal?