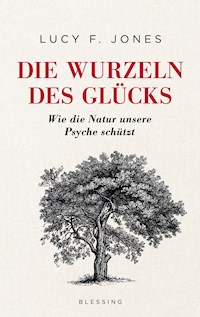
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Natur versetzt uns in Staunen. Sie inspiriert, spendet Erholung, nimmt uns Stress. Was der Mensch immer schon tief in sich spürt, wird heute auch von faszinierender Forschung belegt.
Vom norwegischen Spitzbergen über die Urwälder Polens bis Kalifornien hat Jones eine neue Welt der Wissenschaft bereist, in der erforscht wird, wie die Natur unsere Psyche schützt - warum Dreck essen wirklich gesund ist, weshalb der Anblick natürlicher Formen unser Glücksgefühl beeinflusst und wie wir unsere Innenwelt friedlicher und erfüllter machen, indem wir mehr draußen sind.
- Gegen "Erlebnisarmut" und "ökologische Trauer": warum Naturschutz auch Selbstschutz bedeutet
- Wilde Wissenschaft: Wie wir in der Natur unsere psychische Gesundheit verbessern, Kraft schöpfen und Glück finden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
DASGESCHENKDERNATUR
Die Natur versetzt uns in Staunen. Sie inspiriert uns, stärkt uns und lässt uns zur Ruhe kommen. Das spüren wir tief in unserem Inneren – und es ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt.
Vom eisigen Spitzbergen über die Urwälder Polens bis an die Küste Kaliforniens – in einer faszinierenden Spurensuche zeigt Lucy F. Jones, wie die Natur unsere Psyche schützt. Weshalb uns der Anblick natürlicher Formen das Herz öffnet. Was mit uns wirklich geschieht, wenn wir durch einen Wald gehen. Und wie wir uns und unsere Kinder glücklicher machen, indem wir einfach mehr draußen sind.
»Lucy Jones zeigt, warum unsere seelische Gesundheit unauflöslich mit der ökologischen Bewahrung unserer Welt verknüpft ist.« JOACHIMBAUER, Psychotherapeut und Autor von Fühlen, was die Welt fühlt
»Ein wunderbares Buch! Die Bande zwischen gesunder Psyche und der Natur sind offenbar viel stärker und weitreichender, als wir denken.« BILL McKIBBEN, Träger des Alternativen Nobelpreises
Zum Autor
Lucy Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur u.a. für die BBC, The Guardianund The Sunday Times. Ihr erstes Buch Foxes Unearthed(2016) über die Beziehung zwischen Mensch und Fuchs war für den Wainwright Prize nominiert und wurde mit dem Society of Authors› Roger Deakin Award ausgezeichnet, der für herausragendes Nature Writing vergeben wird. Jones lebt und arbeitet in Hampshire, Großbritannien.
LUCY F. JONES
DIEWURZELN
DESGLÜCKS
Wie die Natur unsere Psyche schützt
Aus dem Englischen
von Dietlind Falk
Blessing
Originaltitel: Losing Eden – Why Our Minds Need the Wild
Originalverlag: Allen Lane, Penguin Random House, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Lucy F. Jones
Copyright © 2021 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design/Margit Memminger
unter Verwendung eines Motivs von Ingk/Shutterstock.com
Herstellung: Gabriele Kutscha
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26440-6V001
www.blessing-verlag.de
Inhalt
Prolog
Teil i – Setzling
Einleitung – Der Samen im Boden
1 Alte Freunde
Teil ii – Wurzeln
2 Biophilie
3 Schlamm-tastisch und Pfütz-munter
Teil iii – Zweige
4 Physiologische Resonanz
5 Die Weisheit der Pflanzen
Teil iv – Stamm
6 Equigenese: Ökologische Gerechtigkeit
7 Ökologische Trauer
Teil v – Rinde
8 Die erste Primel des Jahres
9 Am Ende des Weges
Teil vi – Stumpf
10 Die Zukunft der Natur
Fazit Eine neue Dyade
Epilog
Dank
Anmerkungen
Prolog
Xena ging die Straße hinunter zum Haus ihrer Großmutter. Der Tag war brüllend heiß, doch sie hatte an Mütze, Atemschutzgerät und Sonnenbrille gedacht. So schnell sie konnte, ging sie das Pflaster entlang, dann durch den Tunnel und die überdachte Steintreppe hinauf, um der sengenden Sonne zu entkommen. Sie hörte den Hochgeschwindigkeitszug durchs Nachbarviertel dröhnen und überquerte die Straße, um einen Abstecher zur Pop-up-Grünfläche zu machen – aus Kunstrasen –, überlegte es sich jedoch anders: In letzter Zeit war es dort so heiß gewesen, dass die Sandalen ihrer Freundin auf dem Plastikgras geschmolzen waren. Xena wählte den längeren Weg. Selbst die Kunstbäume halfen heute nicht gegen die Hitze. In der Ferne wurden die Berge vom Qualm der Waldbrände beinahe völlig verhüllt, weiter als zwanzig Meter konnte sie kaum sehen. Alles war grau. Ein Bus fuhr vorbei, auf dem eine neue Telegartensendung beworben wurde, die 2102 anlaufen sollte. Man konnte sich per Hirnchip einloggen und virtuelle Samen pflanzen und gießen, um deren Wachstum zu beobachten. Sie würde ihrer Großmutter davon erzählen.
Granny konnte das Haus nicht mehr so häufig verlassen, sodass Xena sie meist besuchen kommen musste, doch das machte dem Mädchen nichts aus. Granny besaß eine Naturhologrammkonsole (NHK), die in ihrem Wohnzimmer stand, und nach einem Besuch fühlte Xena sich immer glücklich und weniger gestresst. Ihr Lieblingshologramm zeigte auf der einen Seite richtige Bäume, sie waren grünlich braun. In der Mitte gab es einen See, und manchmal sah sie, wie ein Fisch aus dem Wasser sprang. Das Wasser sah sauber aus, nicht wie die verdreckten, stinkenden Becken und Flüsse nahe Xenas Zuhause. Das Beste an der NHK waren die Geräusche – eine Art Musik, die Xena noch nie zuvor gehört hatte: Vogelzwitschern, quakende Frösche, ein Bellen. Sie hatte Vögel im Museum gesehen, und manchmal wurde Vogelgesang in der Schule durch die Lautsprecheranlage abgespielt, doch einen echten Vogel hatte sie noch nie gesehen. Granny vielleicht?
Xena klingelte an der Tür. Ihre Atmung verlangsamte sich, nur ein leises Rauschen war noch zu vernehmen, sie wischte sich Schweiß von der Stirn. Nach einer Minute öffnete Granny die Tür und ließ sie herein. Sie streichelte ihr über den Kopf, drückte ihre Hand und führte sie in die Wohnung.
Erleichtert sah Xena, dass die NHK noch funktionierte, also sprang sie aufs Sofa und machte es sich gemütlich.
»Ich habe etwas Neues für dich, mein Schatz«, sagte Granny.
Mithilfe ihres Chips wählte sie im Menü das »H«, und das Hologramm erschien. Zunächst war es vernebelt, sodass man kaum etwas erkennen konnte, doch als sich der Nebel lichtete, sah Xena einige sehr hohe Bäume, von denen etliche andere Pflanzen hingen. Dann fiel ihr etwas Kleines, Grellgrünes auf. Es sprang plötzlich in die Luft und verschwand.
»Granny, was war das?«
»Oh, das war … ein Laubfrosch. Das ist ein tropischer Regenwald.«
»Tropischer Regenwald«, wiederholte Xena langsam.
Drei Vögel – zumindest meinte sie, es wären Vögel – flogen durch die Szene. Sie hatten lange, orangefarbene Nasen und schwarz-weiße Körper. Xena konnte nicht glauben, dass sie sich mit ihren langen Nasen in der Luft halten konnten. Sie folgte ihnen mit dem Blick und blieb bei einer winzigen Kreatur mit großen gelben Augen hängen, die auf einem Ast hockte.
»Was ist das denn, Granny?«, quiekte sie.
»Eine Eule, mein Schatz, vielleicht ein Eulenjunges.«
»Das ist bisher das beste NHK-Programm, Granny«, sagte sie.
»Ich wünschte, du hättest all das in echt sehen können.«
»Vögel in echt, so jeden Tag?«
»Ja, und ganz viele andere Tiere.«
»Die rumgelaufen sind? Nicht im Zoo?«
»Manchmal. Und Insekten. Hast du schon einmal von Schmetterlingen gehört?«
»Ja, in der Schule.«
»In England gab es viele, viele Schmetterlinge. Man konnte im Sommer im Garten oder im Park sitzen und ganz unterschiedliche Arten von Schmetterlingen beobachten.«
»Wie war das früher, Granny?«
»Oh, es war …«
Granny verstummte. Xena sah zu ihr hinüber. Erstaunt sah sie Tränen in Grannys Augen.
»Granny!«
Ihre Großmutter räusperte sich.
»War es genau so, nur in echt?« Sie deutete auf das Hologramm.
»Nun, ja, wenn man wirklich im Regenwald war«, sagte Granny. »In England, in meinem Garten, gab es kleine Tiere, die man Hummeln nannte, die sahen so aus wie winzige Bären, nur waren sie gelb-schwarz gestreift. In den wärmeren Monaten konnte man die Insekten auf ihrer Suche nach Nektar summen hören. Mein Lieblingsschmetterling hatte schwarze Streifen auf seinen orangefarbenen Flügeln, sodass er ein wenig wie ein fliegender Tiger aussah. Es gab Bäume, die hießen Eichen, die wurden Hunderte Jahre alt. Jeden Tag sah mein Garten anders aus.«
»Konnte man die Bäume anfassen, Granny?«
»Oh ja. Man konnte die Blätter und die Pflanzen und die Blumen anfassen.«
»Wie haben sie sich angefühlt?«
»Weich, würde ich sagen, aber jede hat sich anders angefühlt. Löwenzahn galt als Unkraut, doch im Frühsommer wurden daraus perfekte kleine Kugeln, und wenn man daraufpustete, wirbelten ihre kleinen Samen wie Fallschirme in die Luft.«
»Wie Zauberei?«
»Ja, auf eine Art. Wir nannten sie Pusteblumen. Und es duftete so gut. Jede Blume roch anders. Ich mochte am liebsten den Duft von Rosen, und von Glockenblumen, und Pinien … Oh, und hast du mal was von Kastanien gehört?«
»Nein, was war das?«
»Im Frühling – das war die Jahreszeit, wenn alles zu blühen begann –, dann bekam auch der Kastanienbaum Blüten, die nannte man Kerzen, wie Softeis sahen sie aus. Später wuchsen dann große mit Stacheln übersäte Kugeln. Wenn sie vom Baum fielen, konnte man sie vorsichtig öffnen, und darin waren dann die Kastanien. Sie waren glänzend braun und kündigten den Herbst an – das war auch eine von den Jahreszeiten –, dann würden die Blätter bald bunt werden, von grün zu rot oder orange oder gelb.«
»Das soll wohl ein Witz sein, Granny!«
Die Großmutter schüttelte den Kopf.
»Und das konnte man jeden Tag sehen, wenn man Lust hatte?«
»Ja, mein Herz.«
»Und wie war das?«
»Es war … wunderbar.«
»Warum ist die Natur nicht mehr da, Granny?«
Granny seufzte. »Weil wir sie nicht genug geliebt haben«, sagte sie. »Und weil wir vergessen haben, dass wir in ihr Frieden finden.«
Teil I
Setzling
Einleitung
Der Samen im Boden
Seht ihr nicht wie jedes Buschwerk, selbst die Spatzen, die Ameisen, die Spinnen und die Bienen, alle geschäftig sind und in all ihren Formen zusammenarbeiten, um das Universum zu schmücken?
Marcus Aurelius, Meditationen
Jedes segelnde Blatt ist mir Segen.
Emily Brontë, ›Fall, Leaves, Fall‹
Es liegt in der Natur des Menschen, den Lärm der staubigen Welt und seine engen Behausungen zu verabscheuen; die nebelverhangenen Berge dagegen, die Heimat verwunschener Seelen, sucht seine Natur von sich aus, und findet sie doch selten.
Guo xi, 11. Jahrhundert
Eines Nachmittags im Spätsommer saß ich in meinem Garten am Rand eines Wildblumenbeets. Meine kleine Tochter betastete die vertrockneten Blüten und suchte in der Erde nach Regenwürmern. Im ganzen Garten hingen nun sirupfarbene Spinnen in ihren Netzen, deren gemusterte Hinterteile in der Sonne wie Juwelen glänzten. Obwohl es noch August war, schien es in Südengland bereits, als wäre der Herbst gekommen. Äpfel und Pflaumen fielen von den Bäumen, der Boden war marmeladenrutschig und voller Wespen, die Blätter verfärbten sich schon. Ich erklärte gerade, wo nachts der Igel aus seinem Versteck kam, um nach Käfern und Raupen zu suchen, da sah ich meine Tochter an und bekam ein ungutes Gefühl.
In sämtlichen Zeitungen las man von Dürren, Fluten, Wetterextremen und Hitzewellen, die manchmal die Prognosen der Wissenschaftler noch übertrafen. Was kam auf sie und ihre Generation zu? Das Klimachaos wuchs. Die Eiskappen schmolzen schneller als gedacht. Die Welt schien in Flammen zu stehen. Hier in England schienen die Jahreszeiten durcheinanderzugeraten – Herbst im August, Winter im März. Jeden Tag hörte man von einer weiteren vom Aussterben bedrohten Spezies. Mauersegler1, Schwalben2, Igel3, sie alle waren vom Aussterben bedroht. Würde es noch Primärwälder4 geben, und alte Eichen5, auf die sie staunend klettern könnte? Wie viele Vogelarten würden das traurige Schicksal von Spix-Ara, Weißwangen-Kleidervogel, Pernambuco-Zwergkauz und Dunkelkopf-Blattspäher6 teilen und noch in diesem Jahrhundert aussterben? Würde sie bei der starken Lichtverschmutzung, die 80 Prozent des Nachthimmels über Europa und den USA betraf, jemals die Milchstraße sehen? Und wie würde sich diese von Wissenschaftlern als »biologische Auslöschung«7 bezeichnete Krise auf ihren Geist und ihre Seele auswirken, falls sie überhaupt überleben würde?
Etwa zu dieser Zeit las ich auch von einem deprimierenden Konzept, das der US-amerikanische Autor, Ökologe und Schmetterlingsforscher Robert Pyle mit »extinction of experience« beschrieb: einem zunehmenden Mangel an Naturerfahrungen.8 Je weniger sich Kinder für die Natur begeistern, argumentierte er, desto weniger werden sich wiederum ihre eigenen Kinder der Natur verbunden fühlen. »Dieser Verlustkreislauf emotionaler Bindung beginnt mit dem Aussterben von uns bekannten Spezies, Ereignissen und Aromen in unserer unmittelbaren Umgebung; dieser Verlust führt wiederum zu Unwissenheit über die Artenvielfalt, also zu Entfremdung, Apathie und Gleichgültigkeit, was wiederum zu weiterem Aussterben führt.«9
Dieses Muster zeigte sich in meiner eigenen Familie. Meine Großmutter war ein wandelndes Lexikon, was die Natur und ihre Funktionsweise betraf. Meine Eltern kannten sich mit Vögeln, Blumen und Pflanzen aus, sie kannten ihre Namen, ihre Zyklen und Verhaltensweisen. Ich wusste ein wenig, vielleicht fünf bis zehn Prozent von dem, was sie wussten, und ich interessierte mich schon mehr für Flora und Fauna als die meisten meiner Freunde. Folglich würde die Verbindung meiner Tochter zur Natur noch schwächer ausfallen als meine eigene. Würde sie überhaupt noch Tierarten kennen und benennen können? Oder wäre ihr all das derart fremd, dass eine Beziehung zur Natur für sie wenig bis gar keinen Wert mehr hätte? Wie Pyle schrieb: »Was geht das Aussterben des Kondors ein Kind an, das noch nicht einmal weiß, was ein Zaunkönig ist?« Nie waren wir so entfremdet von der Natur. In den letzten 80 Jahren ist die Hälfte der britischen Primärwälder verschwunden.10 Im 20. Jahrhundert sind 97 Prozent der Tieflandweiden und 90 Prozent der Niederwälder in England und Wales verlorengegangen, und mit ihnen die Tier- und Pflanzenwelten, die dort beheimatet waren. In Europa ist mittlerweile jede zehnte Spezies vom Aussterben bedroht.11 Weltweit sind allein in den letzten 50 Jahren die Bestände von Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Fischen um 60 Prozent zurückgegangen.12
Mit der Landschaft hat sich auch unser Verhalten verändert. Kurz gesagt: Wir bleiben drinnen. Wir sitzen in Großraumbüros, Autos und Hochhäusern und verbringen gerade einmal 1-5 Prozent unserer Zeit im Freien.13 Wir haben uns daran gewöhnt, jenseits der Zyklen unserer Umwelt zu überleben. Unser Bedürfnis und unser Wunsch danach, mit der Natur in Kontakt zu kommen – ebenso wie die Möglichkeit dazu –, haben dramatisch abgenommen.
2005 prägte der einflussreiche amerikanische Autor Richard Louv den Begriff der »Naturdefizit-Störung« für die negativen Auswirkungen mangelnder Berührungspunkte mit der Natur auf die allgemeine Gesundheit des Menschen. »Er beschreibt den Preis, den der Mensch angesichts seiner mangelnden Verbindung zur Natur zahlt: eine Unterentwicklung der Sinne, Konzentrationsschwierigkeiten und die Zunahme von körperlichen und geistigen Krankheitsbildern«,14 schrieb Louv. Dieses Gefühl der Abspaltung bahnt sich seither seinen Weg in unseren Sprachgebrauch. Im selben Jahrzehnt fand der australische Philosoph Glenn Albrecht den Begriff »psychoterratisch«, um damit sowohl irdische (terra) als auch den Geist (Psyche) betreffende Emotionen, Gefühle und Zustände zu beschreiben.15 Albrecht war frustriert davon, wie wenig Konzepte in der englischen Sprache zur Verfügung standen, um die Beziehung zwischen Menschen, der von ihnen erschaffenen Umwelt, der natürlichen Umwelt und ihrer psychischen Verfassung zu beschreiben. Psychoterratische Krankheiten sind beispielsweise auf die Erde bezogene, psychische Gesundheitsleiden wie Ökosystem-Angst oder Globale Furcht. Mit »Trostalgie« bezeichnet er ein Gefühl der Nostalgie und Ohnmacht angesichts der Zerstörung eines Ortes, der früher einmal Trost gespendet hat. Ein weiterer neuer Begriff, die »Arteneinsamkeit«, soll ein Gefühl kollektiver Trauer und Angst angesichts unserer Abkapselung von anderen Spezies ausdrücken. Die Naturautorin Robin Wall Kimmerer beschreibt sie als »eine tiefe, namenlose Traurigkeit, die von unserer Entfremdung vom Rest der Schöpfung herrührt, von einer zerbrochenen Beziehung«.16
Wenn man bedenkt, wie wir unsere Moore und Wälder behandeln, die Meere und Flüsse, ebenso die Wildtiere, die dort leben, könnte man meinen, die industrialisierte Gesellschaft sähe in der Natur nicht viel mehr als einen hübschen Hintergrund: einen Luxus, einen Bonus, reine Deko – »Grünen Mist«, wie der britische Ex-Premierminister David Cameron die Umweltpolitik Berichten zufolge nannte – und nicht das grundlegende System, das uns alle am Leben hält.17
Zweifelsohne wurden meine Tochter und ihre Generation in eine Zeit extremer Entfremdung hineingeboren, in der wir das Klima rasend schnell zerstören und uns psychologisch vom Rest der lebenden Welt zurückziehen. Dabei sind auch sie mit der Natur durch Geschichten und Sprache verbunden, die weit in die Vergangenheit zurückreichen.
Schon immer haben sich Menschen Aspekten ihrer natürlichen Umgebung zugewandt, um die eigene Existenz zu interpretieren und zu verstehen – ganz besonders Tieren, Landschaften, Wetterphänomenen und biologischen Prozessen. Dies zeigt sich nicht nur in einfachen geflügelten Worten – »den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen«, »der frühe Vogel fängt den Wurm«, »bodenständig sein« –, sondern auch in einer Vielzahl kosmischer Symbole für Erneuerung, Regeneration und Beharrlichkeit: Die Natur hilft uns dabei, die Welt, in der wir uns wiederfinden, zu verstehen und ihr Bedeutung abzugewinnen. Selbstverständlich bestehen unsere frühesten Schöpfungsmythen und Kosmologien aus zahlreichen gemeinsamen Naturmotiven – Fluten, Schlangen, Eier und animistische Annahmen –, denn unsere Urahnen waren mit ihrer Umwelt noch wesentlich stärker verbunden. Doch trotz unserer Entfremdung beziehen wir uns noch immer auf die Natur. Sogar im Internet: »Web« (»Netz«), »Stream« (»Strom/Fluss«), »Bug« (Käfer). Linguistisch und mental sind wir stark mit der Natur verwoben; wir haben unsere Sprache, unsere Kultur und unser Bewusstsein – die wichtigsten Aspekte der menschlichen Psyche, aus denen unsere Wünsche und Vorlieben entspringen – in unmittelbarer Nähe zu der Umwelt erschaffen, in der wir seit Jahrtausenden leben. Der Schriftsteller und Naturforscher Richard Mabey findet dafür treffende Worte: »Die Affinität unserer Vorstellungskraft zur natürlichen Welt zeugt von einer essenziellen, ökologischen Verbindung, die für uns ebenso wichtig ist wie unser materielles Bedürfnis nach Luft und Wasser und der Fotosynthese von Pflanzen.«18
Unsere ästhetische Präferenz für Flora und Fauna lässt sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag verfolgen. Urbane Gemeinschaften im Byzantinischen Reich der Antike, in Persien und dem mittelalterlichen China wurden mit Ziergärten angelegt; in Pompeji wurden Fresken mit Naturszenerien gestaltet; die Zisterzienser pflanzten schon ab dem 12. Jahrhundert Blumen und Bäume aufgrund ihrer Schönheit. Auch haben wir die Natur in unsere Behausungen mitgebracht, von den Tierbildern der Höhlenmalerei über Holzschnitte von Blumen, Bergen, Stürmen und Wellen in China und Japan bis zu der europäischen Tradition, jeden Winter einen immergrünen Baum im Haus aufzustellen. Dieser Tage sind die beliebtesten Desktop-Hintergründe Bilder von Kirschblüten, Herbstblättern und türkisfarbenen Meeren; gerade Millenials statten ihre Wohnungen und Häuser immer öfter mit Topfpflanzen aus,19 und Pantone wählte 2017 die Farbe Spring Green (»Frühlingsgrün«) zur Farbe des Jahres.20 (Die Firma wählt die Farbe des Jahres anhand ihrer Lesart von »Stimmung und Einstellung« der globalen Kultur aus. Die Wahl fiel auf Grün, da diese Farbe »unsere Versuche symbolisiert, eine neue Verbindung zur Natur zu finden«.)
Warum also ziehen uns diese Elemente an?
*
Jenseits von Philosophie oder Ästhetik ist unser Bedürfnis nach Natur sehr viel dringlicher und grundlegender – unser Wohlergehen hängt davon ab. Der Gedanke, dass gute Gesundheit von unserer Verbindung zu oder dem Erfahren einer schönen natürlichen Umgebung abhängt, ist fest in unserer langen Historie verankert, und unsere Vorfahren haben ausführlich darüber diskutiert und geschrieben. In dem antiken sumerischen Mythos von Enki wird Dilmun,21 der paradiesische Garten, der angeblich als Vorlage für den Garten Eden gedient hat, als ein Ort beschrieben, wo »die Menschen von Krankheit unberührt« lebten. Auch in der frühen Literatur des Sanskrit wird diese emotionale Verbindung hergestellt: »Niemand ist glücklicher auf der Welt als diejenigen, die frei auf einen weiten Horizont blicken«, sagte Damodara (Krishna).22 In seinen Bucolica (oder Hirtengedichten) beschrieb Vergil dem an gebrochenem Herzen sterbenden Gallus das mythische Arkadien – mit kühlen Bächen, Zephyren, Lorbeer und Tamarisken – als eine heilende, wohltuende Landschaft.
Seit Jahrhunderten handeln Menschen nach der intuitiven Maxime, dass wir für unsere emotionale Stabilität den Einklang mit der Natur brauchen, für unsere Nerven und unsere Psyche, und unsere Bemühungen reichen von der Schaffung öffentlicher Parks bis hin zum Urban Gardening. Und auch die moderne Wissenschaft hat dies mittlerweile erkannt.
Dass wir die Natur als heilende Kraft brauchen, zeigte sich besonders stark und akut, als der Westen zunehmend industrialisiert wurde und unsere Beziehung zur Natur um uns herum verkümmerte. Als die Menschen vom Land in die Stadt zogen und von der Natur getrennt wurden, mussten sie sie aktiv aufsuchen. In der vorindustrialisierten westlichen Welt wurde die Wildnis häufig als grausam, abstoßend und hässlich erachtet; als der italienische Dichter Petrarca 1336 den Mont Ventoux bestieg, rügte er sich selbst für seine »Bewunderung weltlicher Dinge« und floh verärgert vom Gipfel.23
Doch mit dem 18. Jahrhundert entwickelte sich ein neuer Blick auf Naturlandschaften, und mit Aufkommen der Romantik in Kunst und Poesie sowie Transzendentalisten wie Henry Thoreau und Ralph Waldo Emerson brach bezüglich Ort und Landschaft eine neue Epoche emotionaler Sensibilität an. Der Aufstieg des Mittelstands brachte eine gesteigerte Reiselust mit sich, die Menschen quer durch ganz Großbritannien führte, um die Szenerie zu bewundern, wie es bereits Wordsworth auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung auf den rauen Hügeln des Lake District getan hatte. Nun wurden Berge besichtigt, die zuvor als Pickel, Warzen oder Beulen auf Gottes Erdboden betrachtet wurden – so abstoßend, dass während manch einer Zugfahrt die Vorhänge zugezogen wurden, um das Auge zu verschonen. Einer dieser Berge wurde »Divels-Arse« (»Teufelsarsch«) geschimpft. Die Natur wurde in ganz Europa zum ernsthaften Sujet von Malern und Komponisten, Dichtern und Philosophen. Wie der kalifornische Akademiker und zeitgenössische Naturhistoriker Roderick Nash erklärt, nahm diese Bewunderung der Wildnis in den Städten seinen Anfang, sodass »der zivilisatorische Fortschritt ausgerechnet diese Wildnis bedroht, nach der sich die Menschen durch ihn sehnen«.24
Mit Abschluss der Industrialisierung wurden naturbelassene Orte erstmals zur Behandlung von Menschen mit emotionalen und psychischen Beschwerden genutzt. Im ruralen England wurde 1796 von der Gemeinschaft der Quäker das York Retreat gegründet. Patienten aus den sogenannten Irrenanstalten wurden zu Spaziergängen zwischen den Blumen im Garten ermutigt, auch sollten sie Zeit mit Tieren wie Hühnern oder Vögeln verbringen. Der Praxiskodex für Irrenanstalten in Großbritannien von 1827 schrieb fest, ihre Innenhöfe sollten luftig sein und »den Blick über die Außenmauer erlauben«.25 Die Kirkbride-Institutionen, die Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts in den USA entstanden, mussten mindestens 100 Morgen Land einschließen, auf denen vorschriftsmäßig ein »fruchtbarer« grüner Lebensraum entstehen musste, der »das Leben in seinen aktiven Formen« wiedergab.
Auch Florence Nightingale berichtete 1859, dass sich die Kraft der Natur positiv auf die Genesung ihrer Patienten auswirkte. In ihren Anmerkungen zur Krankenpflege beschrieb sie ihre Beobachtungen dazu, welchen Effekt der Anblick der Natur auf die Kranken ausübte. »Das schlimmste Leid eines Fieberpatienten (in einer Hütte) konnte ich ausmachen (und im Fieber liegend an mir selbst feststellen) als darin begründet, nicht aus dem Fenster sehen zu können, sondern einzig auf die Knoten im Holz. Nie werde ich die Verzückung der Fieberpatienten angesichts eines bunten Blumenstraußes vergessen«, schrieb sie. »Ich erinnere mich (in meinem eigenen Fall) an einen kleinen Strauß Wildblumen, der mir geschickt wurde, und dass meine Genesung ab jenem Moment schneller voranschritt.«26 Sie bemerkte: »Wie wenig wir auch von dem wissen, wie sich Form, Farbe und Licht auf uns auswirken, so wissen wir doch mit Sicherheit, dass sie körperliche Auswirkungen auf uns haben. Den Patienten unterschiedlichste Formen und Farben zu zeigen, ist ein tatsächliches Heilmittel.«
Heute gibt es breit gefächerte »Naturtherapien«, und immer mehr Studien zeigen, wie und warum Naturverbundenheit gut für unsere geistige Gesundheit ist. Vielleicht wird uns dies derzeit umso klarer, da wir mehr denn je Gefahr laufen, die Natur, wie wir sie kennen, zu verlieren, und mit ihr auch einen Teil von uns selbst.
Mancher vertritt das Argument, die »extinction of experience« sei von Bedeutung, da sie zu einer weit verbreiteten Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit gegenüber dem Verlust unserer natürlichen Umwelt geführt hat und noch immer führt, sodass es umso schwieriger wird, gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Andere betonen den weltweiten Anstieg von Myopie, also Kurzsichtigkeit bei jungen Menschen, wobei fehlende Aktivität an der frischen Luft als Faktor genannt wird.27 Wieder anderen bereitet der »pandemische« Vitamin-D-Mangel Sorgen, der häufiger bei Kindern auftritt, die vier oder mehr Stunden am Tag vor dem Computer verbringen. Dies hat ebenso zu vermehrten Fällen von Rachitis oder Knochenerweichung geführt, einem Symptom dieses Mangels.28 Kinder sind heutzutage mit einer Fettleibigkeitsepidemie konfrontiert, die sich dadurch verschlimmert, dass sie zu Hause sitzen und zu wenig draußen spielen. Manche Wissenschaftler warnen davor, dass sich die westliche Welt bezüglich der geistigen Gesundheit der Menschen in einer Krise befindet29 und dass die steigende Zahl an »deaths of despair«, also Todesopfern »aus Verzweiflung« – durch Alkohol (Leberzirrhose), Drogensucht (Überdosis) und Depressionen (Suizid) – dazu führt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA sinkt.30 Immer mehr Menschen sterben aus psychischen, sozialen und existenziellen Gründen. In den USA hat die Selbstmordrate seit 1999 um 25 Prozent zugenommen.31 Experten warnen auch aufgrund der steigenden Zahl an Suiziden unter britischen Teenagern vor einer Krise der psychischen Gesundheit.32
Ich saß also in der späten Augustsonne, sah meiner Tochter dabei zu, wie sie vorsichtig die Blätter und Köpfe der letzten Gänseblümchen des Jahres untersuchte, am letzten süßen Klee in unserem kleinen Wildblumenbeet roch, und sorgte mich darum, dass unsere Entfremdung von der Natur zu einer Art psychischen Krise führen könnte – oder bereits geführt hatte. Oder zumindest dazu, dass ein für die psychische Gesundheit des Menschen lebenswichtiges Element nun fehlte. Doch ich wollte nicht nur Trübsal blasen. Stattdessen nahm ich mir vor zu untersuchen, wie und wodurch unsere Beziehung zur Natur – oder der Verlust dieser Beziehung – die geistige Gesundheit eines Menschen in jedem Lebensalter beeinflussen kann.
*
Ich muss gestehen, dass die Frage für mich auch von persönlichem Interesse war, nachdem mir die Natur aus meinem dunkelsten Moment herausgeholfen hatte. Und auch ich hatte mich ihr nicht immer verbunden gefühlt: Während meiner Jugend im Themsetal der späten Neunziger und frühen 2000er galt die Natur nicht gerade als »cool«. Ich interessierte mich mehr für Radiohead, meine Schlaghosen, an denen ich herumnähte, und die Beat-Poeten, die ich las, als für die wilde Natur, die mein Kinderherz hatte höher schlagen lassen. Nun verbrachte ich kaum noch freiwillig Zeit in der Natur, wenn es nicht darum ging, hinter einem Busch oder einem Baum zu rauchen.
Ich verbrachte meine Zeit eher mit Alkohol. Mit vierzehn entdeckte ich, dass ich mich beim Trinken wohl in meiner Haut fühlte. Wie in meinem ganz persönlichen Adlerhorst. Von Anfang an gefiel mir dieser transformative Effekt, der mich aus meinem Kopfkino zerrte: Gluck, gluck, klick: Aaaaaah. Der Alkohol brachte den inneren Monolog zum Schweigen, der mich sonst mit spitzer Zunge niedermachte. Am Anfang war das Trinken einfach ein großer Spaß, auch wenn ich mich am nächsten Tag häufig etwas merkwürdig fühlte und mich schämte. Ich schien es im Gegensatz zu meinen Freunden zu übertreiben. Ich trank schneller als andere – und mehr, und länger. Ich kippte Schnäpse, damit der Rausch schneller eintrat. Ich fing an zu trinken, wenn ich allein war. Häufig musste ich brechen, doch das brachte mich nie dazu, es für den Abend gut sein zu lassen.
Als Jugendliche hatte ich auch zum ersten Mal psychische Probleme. Mit etwa siebzehn ging etwas mit mir durch. Die Ferien standen vor der Tür, und jeden Tag und jeden Abend hatte ich etwas Tolles vor. Auf den Londoner Straßen roch es nach Schweiß, Abgasen und Zigarettenqualm. Und dann, ganz plötzlich, war alles nur noch grau. Nichts entfachte mehr Freude oder Glücksgefühle in mir. Das Essen schmeckte nach nichts. Aufzustehen war wahnsinnig anstrengend. Sprechen laugte mich aus, also schlief ich stattdessen. Ich wollte nicht bei Bewusstsein sein. Es war Furcht einflößend, sich so taub und leblos zu fühlen, ohne zu wissen, was mit mir passierte. Natürlich war ich schon mal traurig gewesen und hatte schlechte Tage gehabt, doch kein einziges positives Gefühl mehr zu empfinden, war verstörend. Ich sagte Verabredungen ab. Um diesem stumpfen Schmerz entgegenzutreten – es fühlte sich an, als wäre mein Akku leer –, widmete ich mich mit neuer Entschlossenheit dem Trinken.
Zu Beginn hatte sich der Alkohol wie ein Nest angefühlt, ein sicherer Ort, eine warme Decke, unter der ich so leben und reden konnte, wie ich wollte, ohne mich ständig selbst infrage zu stellen. Anfangs war er wie ein Zaubertrank, der mir dabei half, mit anderen in Kontakt zu treten und offen zu sprechen, mich weniger schüchtern zu fühlen. Er war das stabile Gerüst meiner Jugend. Mir war nicht klar, dass ich dabei war, mich zu verlieren. Mir war nicht klar, dass die Sucht – ganz besonders, wenn auch noch Koks ins Spiel kam – letztendlich nicht zu Verbundenheit, sondern zu Einsamkeit, Obsession und Isolation führte.
Niemals hätte ich gedacht, dass ich zehn Jahre später die Mittagspausen im Büro dazu nutzen würde, auf dem Boden einer der Kabinen auf dem WC ein Nickerchen zu machen. Ich habe mich in Embryonalstellung zusammengerollt, und die Holztür fühlt sich beruhigend an, beige, nur das harsche Licht schmerzt in meinen Augen. Der Boden ist hart und kalt wie Marmor, er beruhigt meine heiße, wütende, pochende Schläfe. Die Ader versucht, sich ihren Weg aus der Haut zu bahnen. Ich atme tief ein, damit ich mich nicht noch einmal übergeben muss, und versuche zu schlafen. Der Wecker klingelt und schlummert, mehrfach. Flüchtige Stimmen meiner Kollegen auf dem WC kommen und gehen – Haben sie meinen Wecker gehört? Wissen sie, dass ich hier liege, um meinen heftigen Kater auszuschlafen? Fuck, ich werde … ich warte, bis es still wird, wasche mir das Gesicht, reibe mir mit zittrigen Händen die blutunterlaufenen Augen, stecke mir ein Kaugummi in den Mund, atme tief durch und gehe wieder an den Schreibtisch. Am Ende muss ich einsehen, dass sich diese Szene regelmäßig wiederholt, dass ich zwar die abgeschlossene Kabine hinter mir lassen kann, aber nicht dieses Muster – dass die Party langsam vorbei ist, dass mein Boot absäuft. Ich will entkommen, doch ich sitze in der Falle: Aus dem vormals sicheren Nest ist ein Spinnennetz geworden.
*
Für meinen Weg aus der Sucht waren vier Faktoren entscheidend. Drei davon lagen auf der Hand: psychiatrische Betreuung und Medikamentierung, eine Psychotherapie sowie die Unterstützung von Freunden, meiner Familie und anderen Suchtkranken. Warum mir der vierte so sehr half, darauf konnte ich mir zunächst keinen Reim machen, und so entstand die Idee zu diesem Buch.
Ich wusste, dass ich Alkohol und Drogen aufgeben musste: Für ein High brauchte ich immer mehr, das Runterkommen hingegen wurde immer gefährlicher und selbstzerstörerischer. Meine geistige und körperliche Verfassung schien sich kontinuierlich zu verschlechtern, trotzdem kam ich alleine nicht vom Alkohol- und Drogenkonsum los. Nachdem ich es monatelang versucht hatte, fand ich also ein begleitetes Entzugsprogramm und zählte von da an die Tage ohne Alkohol oder Drogen. Das erste Jahr fühlte sich an, als liefe ich ohne meinen Schutzpanzer herum. Alles war intensiver und scharf gestochen. Plötzlich war ich wieder eine verletzliche Teenagerin, denn seit der frühesten Jugend hatte ich meine Emotionen in feuchtfröhlichen Eskapaden ertränkt. Das wirkliche Problem war psychologischer Natur. Ich musste lernen, neue Gefühle geduldig zu bewältigen. Was ein nüchternes Leben betraf, war meine größte Angst, mich nie wieder wohlzufühlen. Doch nach dieser wackligen Phase ging es schließlich bergauf mit mir.
Zur Unterstützung traf ich mich mit anderen Suchtkranken, häufig in Räumlichkeiten von Kirchen. Kirchen haben häufig Gärten, und in Gärten findet man häufig Blumen. Mir fielen die Farben auf, die rosafarbenen und gelben Blätter an einem nahegelegenen Busch. Das belebte mich. Ich hob die Hand und berührte die zarten Blätter. Mir gefiel die Kombination aus Rosa und Gelb, wie ein Battenberg-Kuchen. Ich entdeckte das Spazierengehen – angezogen von Bäumen, Vögeln, Blumen und Pflanzen auf eine dringliche Art, die ich zuvor nur in Bezug auf Drogen, Musik oder Menschen erlebt hatte.
Jeden Tag spazierte ich durch die Walthamstow Marshes, eine weite Grünfläche neben dem Kanal, um die Turmfalken zu beobachten, den zerzausten alten Reiher und den goldgelben Rainfarn, die mir ein Gefühl von Sicherheit gaben. Sie wurden zu meinem Entzug: Sie heilten meine Wunden und flickten mich wieder zusammen. Die Spaziergänge waren nicht nur erholsam – ich kehrte mit ruhigem Geist und guter Laune in meine Wohnung zurück –, sondern auch aufregend, da ich so viele Tiere und Farben zu Gesicht bekam. Jeden Tag sah der Himmel anders aus. Die Brise auf meiner Haut, der Geruch des Erdbodens, die Baumrinde unter meinen Fingern machten mich neugierig aufs Leben. Der akute Zustand einer Sucht lässt Dinge fremd wirken. Alles dreht sich zwanghaft ums eigene Selbst und die Droge, sodass man sich von anderen abschottet, selbst wenn man ständig Leute trifft. Die Ganzheit der Natur war zu viel für mein Schamgefühl gewesen. Meine Welt hatte sich rapide verkleinert, und ich war bei Tageslicht kaum vor die Tür gekommen: Am Ende führte meine vampirartige Existenz dazu, dass mir beinahe nichts mehr wichtig war.
Auf dem Weg der Besserung fand ich einen Teil von mir wieder, der sich abgeschaltet hatte, was sich auch in meinem Gefühl der Verbundenheit und Offenheit gegenüber den anderen Suchtkranken widerspiegelte, die ich in jenen frühen Jahren drei- bis viermal pro Woche traf. Ich spürte, wie sich die Glasglocke hob, die mich von anderen Menschen trennte. Ich fühlte eine neue Beziehung zu meinen Freunden und meiner Familie wachsen – ebenso wie zur Gesellschaft im Allgemeinen und der gesamten Umwelt. Auf meinen Spaziergängen war ich nie allein. In mir wuchs das Gefühl, zu einer weiter gefassten Familie von Spezies zu gehören, einer Gemeinschaft von Lebewesen, der Matrix der Schöpfung, von Spinne bis Flechte, von Kormoran bis Blesshuhn. Ich fühlte mich wie neugeboren. Die Natur hatte mich im Genick gepackt und eine Weile schützend mit sich herumgetragen.
Die Welt strahlte und kühlte mein Gemüt. Sie glättete Ränder und scharfe Kanten, streichelte mir übers Haar und hielt meine Hand. Ich war angefixt, eine Klette an ihrem Bein, wild auf ihre Opulenz und all ihre Wunder.
Manchmal gestaltete sich das Ganze wie eine heiße Affäre, mit Besessenheit, Liebestaumel und purem Glück. Manchmal wandte ich mich einfach an die Landschaft, den Fluss, den Bach, um meine Seele zu nähren. Ich ging satt und zufrieden nach Hause, auf eine Art, wie es mir Alkohol und Kokain nie ermöglicht hatten. Mich auf meine Umgebung zu konzentrieren, dimmte die Stimmen in meinem Kopf. Ich verwandelte mich in die schlagenden Flügel der Gänsescharen, das Zirpen einer Grille oder eine ins Wasser platschende Wühlmaus.
Ich war seit etwa einem Jahr trocken, als der Birnbaum vor meinem Schlafzimmerfenster in Hackney, East London, für sechs Monate von einem dicken hässlichen Baugerüst verdeckt wurde. Der Baum war wunderschön – im Frühling erstrahlte er in einem außerirdisch schönen Hellgrün wie Kryptonit. Dann platzten die Knospen an den Ästen zu weißer Blüte auf, kurzlebig wie die Perseiden. Der Stamm sog Wasser und Pflanzensaft durch sein Mark und trug es hinauf zu den Gefäßen und Kapillaren bis in die Blätter. Im Sommer wurde sein Grün noch tiefer, dann schwoll er vor Birnen an, blähte sie auf, bis sie prall und klebrig zu Boden fielen – durch ihr eigenes Gewicht und das Werk hungriger Insekten. Dann vertrockneten seine Blätter, wurden braun und fielen lautlos wie Taucher zu Boden, während der Baum für den Winter ausdörrte, eine reglose harte Gottesanbeterin. Unsichtbare elektrische Nachrichten und Signale liefen im Zickzack hinter seiner Rinde in seine Wurzeln und von den Wurzeln zurück durch die Rinde bis in die Äste, unter der Erde surrten die Mykorrhizen. Wenn die Spätwintertage ihren Biss verloren und die Welt sich reckte und gähnte, hielt ich jeden Tag Ausschau nach seinem tapp, tapp, knarz, nach neuen Knöpfchen, die schon bald aufbrechen und von Neuem austreiben würden.
Diese Wohnung war ein Neuanfang für mich, ein cleaner Ort ohne jedwede Erinnerung an durchzechte Nächte, die sich bis in Furcht einflößende Morgenstunden erstreckten, an den mentalen Horror des Ausnüchterns und das unausweichlich folgende verkaterte Runterkommen, und der Baum animierte mich zum Durchhalten. Er füllte das Fenster aus, neben dem ich schlief und vor dem ich manchmal arbeitete, und ich liebte es, sein wechselndes Gewand und seine Regungen zu beobachten. Sieh, wie ich wachse und mich bewege und weitermache. Sieh, wie die Dinge sich wandeln. In seiner Routine fand ich eine Art emotionale Stabilität, an die ich auch meine Hoffnung knüpfte. Manchmal lag ich am Samstagnachmittag im Bett und sah ihm wie hypnotisiert bei seinen sanften Regungen zu, wie das Sonnenlicht auf seinen Blättern tanzte. Danach fühlte ich mich ruhig und entspannt. Ich liebte den Baum und das Gefühl, das er mir gab. Häufig sah ich Blaumeisen mit herrlichem Gefieder, einmal sogar einen Specht, auch wenn die Vögel nur die Statisten waren. Unsere war eine von vier Wohnungen in einer Anliegerstraße, etwa zehn Minuten vom nächsten Park entfernt. Nur die Mieter der Erdgeschosswohnung hatten einen Außenbereich – ein kleines Asphaltviereck –, doch wir konnten aus dem Küchenfenster aufs Dach ihrer Wohnung klettern, von wo aus man auf eine Wohnanlage und eine Pappelreihe sah, es ließ sich herrlich lesen, mit Freunden plaudern oder den Bäumen lauschen. Im Vergleich zu meiner vorherigen Wohnung – an einem vielbefahrenen Kreisverkehr und über einer Eisenwarenhandlung gelegen – fühlte sie sich sehr viel naturnäher an, ganz besonders durch den Birnbaum direkt nebenan. Unsere Wahl war nicht aus diesem Grund auf die Wohnung gefallen – meine einzige Bedingung war eine Badewanne gewesen –, doch der Umstand war eine nette Überraschung. Und wurde schließlich zu etwas, das ich brauchte.
Wie sehr, das wurde mir erst klar, als nach etwa sechs Monaten das Gerüst für die Renovierungsarbeiten an der Wohnung über uns montiert wurde und den Blick auf den Birnbaum versperrte. Was dann geschah, verdeutlichte mir das Ausmaß meiner psychologischen Abhängigkeit von der Natur um mich herum. Binnen weniger Tage wuchs meine Anspannung. Ich versuchte, einen Blick durch die Metallstäbe zu werfen, um sein lebendiges Grün zu sehen, um nachzuschauen, wie es ihm ging, als wäre er das Wasser, das meinen Durst stillen könnte, oder ein geliebter Mensch, von dem ich nun getrennt war. Es frustrierte mich, nur so wenig von ihm sehen zu können, ich wurde reizbar und übellaunig. Zu Hause fühlte ich mich eingesperrt. Ich schickte den Nachbarn passiv-aggressive SMS, um zu fragen, wie lange das Gerüst noch bleiben würde, dann keifte ich meinen damaligen Freund an.
Natürlich wäre es extrem merkwürdig gewesen, hätten meine Nachbarn mich vorgewarnt, dass der Birnbaum nun für einige Zeit verdeckt würde. Hätte der Vermieter sich entschieden, ihn zu fällen, er hätte uns wohl vor eventueller Lärm- oder Staubbelästigung gewarnt, aber sicher nicht vor eventuellen Schäden, die unsere psychische Gesundheit nehmen würde.
Ich kam einfach nicht darüber hinweg. Die gesamten sechs Monate lang, in denen der Baum verdeckt war, fühlte ich mich neben der Spur. Gleichzeitig wusste ich nicht, wie mir geschah. Meine wütenden heißen Tränen waren mir peinlich, genau wie das Gefühl der zugeschnürten Kehle, das mich abends manchmal überfiel. Meine Emotionen bereiteten mir Kopfzerbrechen. Konnte ein Baum – beziehungsweise ein fehlender Baum – wirklich einen so starken Einfluss auf meine Psyche haben? Was um Himmels willen passierte mit mir?
Einfach gesagt verblüffte mich diese Verbindung. Kein Arzt hatte mir »Natur« verschrieben oder mir angeraten, Zeit im Freien zu verbringen. Ich war mehr oder weniger darüber gestolpert. Doch ich stellte zusehends fest, dass ich die Natur brauchte und ähnlich von ihr Gebrauch machte wie vom Alkohol, der mich früher benebelt hatte. Großes Plus: Von der Natur bekommt man keinen Kater. Dass es angenehm war, am Meer oder im Wald spazieren zu gehen, dass Menschen sich dadurch ruhig und entspannt fühlen, hatte ich schon gewusst. Ich tat es selbst manchmal, wenn es mir nicht gut ging. Was ich nicht wusste, war, dass die Essenz all dessen – die Geometrie, die Aromen, die Klänge, Farben, Texturen – die Kraft besaß, ein Leben zu verändern. Ich konnte noch nicht sehen, dass mir eine Beziehung zur Natur helfen konnte, wenn es mir mental nicht gut ging.
Was hatte es mit diesem Effekt auf sich, und warum hatte ich so lange nichts davon gewusst? Als ich schließlich tiefer grub als das, was der amerikanische Landschaftsarchitekt Frederick Law Olmsted (der Designer des New Yorker Central Parks) als »Szenerie« bezeichnete, die durch unbewusste Prozesse beruhigend und »ausspannend« auf die stressgebeutelten Sinne wirkte, entdeckte ich nach und nach eine Fülle wissenschaftlicher Beweise sowie Geschichten und Anekdoten, die erklärten, was mit Körper und Geist während dieser einfachen seelischen Erholung passierte.33
Getrieben von meiner persönlichen Erfahrung und ermutigt durch die Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ich als Journalistin führte, bekam ich mehr und mehr Sicherheit, dass es sich hierbei um ein wichtiges neues Forschungsgebiet handelte, und so begab ich mich auf die Suche nach den Mechanismen für die Art und Weise, wie der Kontakt mit der Natur den menschlichen Geist beeinflussen konnte.





























