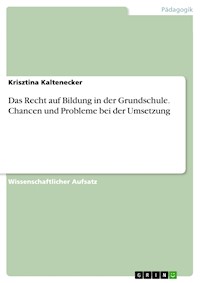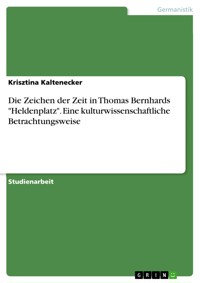
Die Zeichen der Zeit in Thomas Bernhards "Heldenplatz". Eine kulturwissenschaftliche Betrachtungsweise E-Book
Krisztina Kaltenecker
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,00 (mit Auszeichnung), Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Deutsches Seminar), Veranstaltung: Seminar Thomas Bernhard, Sprache: Deutsch, Abstract: Thomas Bernhards Bühnenstück „Heldenplatz“ entstand im Auftrag von Claus Peymann als Beitrag zum 100-jährigen Bestehen des Wiener Burgtheaters 1988. Die primäre Intention des Auftraggebers war, anlässlich des 50. Jahrestags der Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland das österreichische Theaterpublikum an die eigene ruhmlose Vergangenheit zu erinnern. Diesem Wunsch entsprechend zeigte Thomas Bernhard in „Heldenplatz“ die komplexen Konsequenzen der lange Zeit beschwiegenen nationalsozialistischen Verstrickung Österreichs exemplarisch anhand einer Wiener Familiengeschichte auf. Aus der Sicht einer jüdischen Bürgerfamilie beantwortete er aktuelle Fragen zu der Selbst- und Fremdwahrnehmung, u.a. was Wien (bzw. Österreich), wer ein Österreicher und wer ein Jude in Wien (bzw. Österreich) Ende der 1980er Jahre sei. Zugleich stellte er aus demselben Blickwinkel und in Zusammenhang mit der Identitätsproblematik dar, inwiefern der sogenannten Opfergeneration sowie deren Kindern die (Re-)Integration in ihrem Vaterland, bzw. dem Vaterland die Integration der jüdischen (Re-)Migranten misslang: 1. Auf die Ignoranz und Ausgrenzung seitens der Aufnahmegesellschaft reagiert die Familie Schuster lediglich sporadisch und nur mit längst überholten politischen Mitteln des einstigen Österreich-Ungarn. Anstatt pro-aktiv am öffentlichen und politischen Leben teilzunehmen, ziehen sie sich immer mehr ins Privatleben zurück und trösten sich mit der Entwicklung eines Spiels für die Familie und deren jüdischen Freundeskreis. Das antifaschistische Widerstandsspiel "Zeichen der Zeit" wird zum Ventil, um die alltägliche politische Erfahrung der Solidaritäts- und Empathieverweigerung seitens der Wiener untereinander abzureagieren. 2. Der psychisch bereits angeschlagene Josef Schuster lässt es zu, dass bei ihm aus dem harmlosen Widerstansspiel eine Besessenheit, gar eine Manie entsteht, und dass das allmählich zum Selbstläufer gewordene Lebensspiel "Zeichen der Zeit" die Kontrolle übernimmt. Dabei wird die nationalsozialistische Vergangenheit Österreichs hypostasiert, das heißt für Professor Schuster stets unüberwindbar präsent. 3. Die totale Heimat- und Rastlosigkeit der Schusters wird durch doppelbödige Ehespiele unabänderlich besiegelt. Sie machen ihre historisch-politisch und psychisch bedingten Wahrnehmungsverluste irreversibel, und ihre persönliche Situation völlig ausweglos...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Copyright (c) 2016 GRIN Verlag, Open Publishing GmbH
Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com hochladen und weltweit publizieren
Krisztina Kaltenecker
Die Zeichen der Zeit in Thomas Bernhards „Heldenplatz“.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die österreichische Erinnerungskultur während des Kalten Krieges
2.1 Das große Beschweigen
2.2 Die kollektive Opferidentität als nationale Deckerinnerung
3. Der Heldenplatz als Schauplatz und Gedächtnisort
4. Die Utopie Wien
5. Der zweite historische Schock für die Familie Schuster
6. Das Spiel „Zeichen der Zeit“
7. Das Buch „Zeichen der Zeit“
8. Verhängnisvolle Ehespiele
9. Professor Schuster, der „Wandernde Jude“
10. Die Zeichen der Zeit in Thomas Bernhards „Heldenplatz“. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Primärliteratur
2. Sekundärliteratur
1. Einleitung[1]
Thomas Bernhards Bühnenstück „Heldenplatz“ entstand im Auftrag von Claus Peymann als Beitrag zum 100-jährigen Bestehen des Wiener Burgtheaters 1988. Die primäre Intention des Auftraggebers war, anlässlich des 50. Jahrestags der Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland das österreichische Theaterpublikum an die eigene ruhmlose Vergangenheit zu erinnern. Diesem Wunsch entsprechend zeigte Thomas Bernhard in „Heldenplatz“ die komplexen Konsequenzen der lange Zeit beschwiegenen nationalsozialistischen Verstrickung Österreichs exemplarisch anhand einer Wiener Familiengeschichte auf. Aus der Sicht einer jüdischen Großbürgerfamilie beantwortete er aktuelle Fragen zu der Selbst- und Fremdwahrnehmung, u.a. was Wien (bzw. Österreich), wer ein Österreicher und wer ein Jude in Wien (bzw. Österreich) Ende der 1980er Jahre sei.[2] Zugleich stellte er aus demselben Blickwinkel und in Zusammenhang mit der Identitätsproblematik dar, inwiefern der sogenannten Opfergeneration sowie deren Kindern die (Re-)Integration in ihrem Vaterland, bzw. dem Vaterland die Integration der jüdischen (Re-)Migranten gelang.
Das Bühnenstück sorgte aufgrund einer heftigen öffentlich-medialen Diskussion noch vor seiner Uraufführung am 4. November 1988 im Wiener Burgtheater für einen der größten Skandale der österreichischen Theatergeschichte.[3] Wie viele Politiker protestierte auch der parteilose Bundespräsident Kurt Waldheim gegen „Heldenplatz“ noch vor der Premiere vehement: „Ich halte dieses Stück für eine grobe Beleidigung des österreichischen Volkes und lehne es daher ab“.[4]
Bei dem ehemaligen KZ-Häftling, ungarischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertész hingegen löste „Heldenplatz“ eine Art Aha-Erlebnis aus: „Die Dialoge in Heldenplatz habe ich so von Juden in Budapest gehört.“ Diesen schlagartigen Moment des Wiedererkennens erklärte er sich damit, dass Thomas Bernhard sich „mit den Juden identifiziert“ habe.[5]