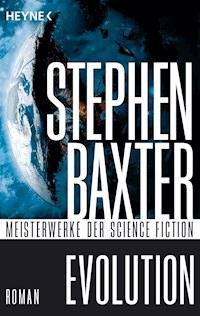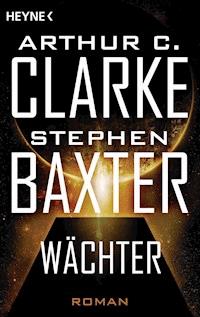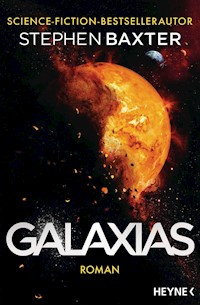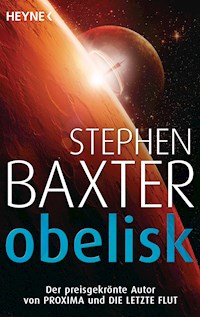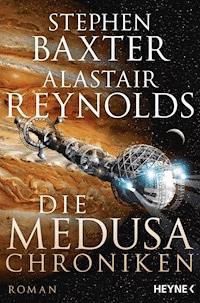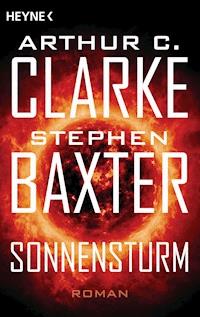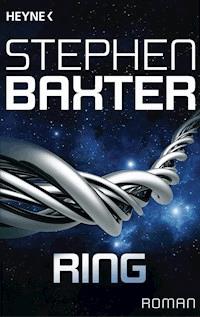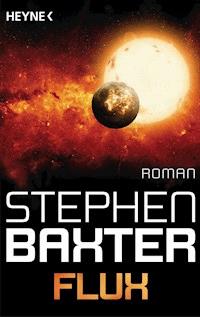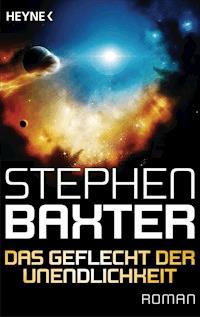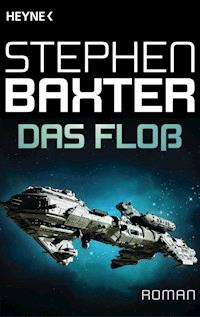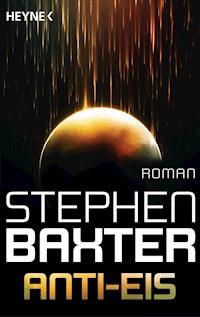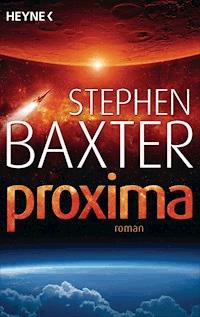2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wie weit reicht die Zeit-Verschwörung?
Cambridge, 1940: Der junge Ben Kamen, ein Student Kurt Gödels, schläft neben seiner Rechenmaschine ein und setzt damit eine gewaltige Zeit-Verschwörung in Gang. Denn er ist ein Weber, der mit seinen Träumen die Vergangenheit verändern kann. Als Ben bewusst wird, dass er deswegen beeinflusst wird, nimmt er Kontakt mit der Historikerin Mary Wooler auf, um festzustellen, ob Zeitmanipulationen erfolgt sind. Die beiden geraten in die Wirren des Zweiten Weltkriegs, als deutsche Besatzungstruppen an der südenglischen Küste landen und Marys Sohn in Kriegsgefangenschaft gerät. Und auch die Nazis haben von den Fähigkeiten des Juden Kamen gehört …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
DAS BUCH
Cambridge, im Jahre 1940: Als der junge Ben Kamen, ein österreichischer Jude, neben seiner Rechenmaschine einschläft, ist es nicht die Müdigkeit eines eifrigen Studenten, sondern der Beginn einer gewaltigen »Zeitverschwörung«. Denn Ben, ein Student Kurt Gödels, ist der Weber, der mithilfe eines selbst konstruierten Differentialanalysators den Teppich der Zeit durch seine Träume verändern kann. Als er jedoch erkennt, dass er von falschen Freunden benutzt wird, um zu deren Vorteil in das Zeitgefüge einzugreifen, nimmt er Kontakt mit der Historikerin Mary Wooler auf, einer Spezialistin für britische Frühgeschichte. Auf der Suche nach möglichen erfolgten Zeitmanipulationen geraten die beiden in die Wirren des Krieges: Deutsche Besatzungstruppen landen an der südenglischen Küste und nehmen das Land ein in dem Bestreben, ein Reich im Norden zu begründen. Marys Sohn gerät in Kriegsgefangenschaft, und auch Ben wird von den Nazis enttarnt. Seine Freunde befürchten das Schlimmste – die Besatzer aber wissen um Bens besondere Gabe und setzen ihn unter Drogen, um zu ihren Gunsten die Geschichte zu verändern. Ein Albtraum nimmt Gestalt an: das Reich Albion, Heimstatt der Arier...
DER AUTOR
Der Engländer Stephen Baxter, geboren 1957, zählt zu den weltweit bedeutendsten Science-Fiction-Autoren. Aufgewachsen in Liverpool, studierte er Mathematik und Astronomie und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Baxter lebt und arbeitet in Buckinghamshire. Neben der Reihe der Zeitverschwörung sind im Wilhelm Heyne Verlag erschienen: Evolution, Der Orden, Sternenkinder und Transzendenz.
Inhaltsverzeichnis
DER ZEITTEPPICH
1492 n. Chr.
»… wie von mir dargestellt; bei dem die langen Kettfäden die Geschichte der ganzen Welt sind und die von einer Webkante zur anderen verlaufenden Schussfäden Verzerrungen dieser Geschichte infolge der Ablenkungsmanöver eines unbekannten Webers, sei er nun Mensch, Gott oder Teufel …«
Bruder Geoffrey Cotesford von York
DIE PROPHEZEIUNG DES NECTOVELIN
4 V. CHR.
(Freie Übersetzung aus dem Lateinischen unter Beibehaltung des Akrostichons)
Ach Kind! Verwoben in den Wandteppich der Zeit, und dennoch frei geboren,
Cum fortia sing ich dir von dem, was ist und was sein wird, und
Obendrein von allen Menschen, Göttern, und von drei mächt’gen Kaisern.
Nebst einem Mann, germanisch ist sein Name und seine Augen sind aus Glas,
Schreiten einher haushohe Pferde mit säbelgleichen Zähnen.
Turbulente Himmel verkünden die Ankunft von Roms großem Sohn;
Auch wird man ihn als kleinen Griechen kennen.
Und während Gott als Kind geboren wird,
Rammt römische Gewalt der Insel Hals in eine steingewordne Schlinge.
Erhoben in Brigantien, wird später er in Rom gepriesen,
Paladin eines Sklavengottes, am Ende selbst ein Gott.
Eingebunden in das Reich, bleibt von der Kirche toter Marmor nur.
Ruf ins Gedächtnis dir die Wahrheiten, die wir für selbstverständlich halten –
Ich sage dir, dass alle Menschen gleich und frei erschaffen sind, mit
Rechten, unveräußerlich, vom Schöpfer ihnen zugeeignet;
Etwa dem Recht auf Leben, Freiheit und aufs Glücksbestreben.
O in die Zeit verwobnes Kind, versuch die Wurzel auszureißen!
DAS MENOLOGIUM DER SELIGEN ISOLDE
418 N. CHR.
(Freie Übersetzung aus dem Altenglischen unter Beibehaltung des Akrostichons)
PROLOG
EPILOG
DAS TESTAMENT DER EADGYTH VON YORK
(Freie Übersetzung aus dem Altenglischen)
(1070 N. CHR. OFFENBARTE ZEILEN) Am Ende der Zeit Wird er kommen Zum Schweif des Pfaus: Die Spinnenbrut, der Christusträger Der Täuberich. Und der Täuberich wird ostwärts fliegen, Mit starken Schwingen, festem Herzen und klarem Verstand. Gottes Maschinen werden unseren Ozean verbrennen Und die Gewürzländer in Flammen setzen. All dies habe ich miterlebt Und meine Mütter auch. Schickt den Täuberich nach Westen! Oh, schickt ihn nach Westen!
(1481 N. CHR. GEFUNDENE ZEILEN) Der Drache erhebt sich von seinem östlichen Thron, Wandert nach Westen. Die gefiederte Schlange, seuchengestählt, Fliegt übers Ozeanmeer, Fliegt nach Osten. Schlange und Drache, ein Zweikampf auf Leben und Tod Und die Schlange ergötzt sich an heiligem Fleisch. All dies habe ich miterlebt Und meine Mütter auch. Schickt den Täuberich nach Westen! Oh, schickt ihn nach Westen!
PROLOG
APRIL 1940
I
Der Junge schlief neben der Rechenmaschine.
Rory betrat das Zimmer. Der Schläfer, Ben Kamen, lag zusammengesunken über seinem Schreibtisch, umgeben von dicken, aufgeschlagenen Jahresbänden von Physikzeitschriften und Kanzleipapier, das mit seiner krakeligen deutschen Handschrift bedeckt war.
In dem mit den Bestandteilen des Analysators vollgestopften Zimmer hing der scharfe Ozongeruch von Elektrizität in der Luft, ein Geruch, der Rory an den Wind von der Irischen See erinnerte. Aber er befand sich hier am MIT in Cambridge, Massachusetts, einer Oase riesiger Betongebäude. Er war wirklich sehr weit von Irland entfernt. Niemand wusste, dass er hier war und was er hier tat. Sein Herz klopfte heftig, aber er war bei klarem Verstand und schien jedes Detail des unordentlichen, hell erleuchteten Raumes wahrzunehmen.
Er wandte sich von Ben ab und der Batterie elektromechanischer Gerätschaften zu, die den Raum beherrschte. Der Differentialanalysator war eine Denkmaschine. Es gab Arbeitsflächen, die Zeichentischen ähnelten, und Reihen von Zahn- und anderen Rädern, Stangen und Hebeln. Im Rotieren und Ineinandergreifen dieser Räder modellierte die rasselnde Maschine die Welt. Früher am Tag hatte Rory sie mit den Daten gefüttert, die sie brauchte; sorgfältig hatte er Kurven auf die Eingabetische gezeichnet, hatte die Übersetzungen von Hand berechnet und kalibriert. Nun riss er einen Ausdruck der Resultate ab. Die Gödel-Lösungen waren fertig.
Und auch Ben Kamen war bereit. Im Schlaf sah er sehr jung aus, jünger als seine fünfundzwanzig Jahre. Nichts an ihm ließ erkennen, dass er ein österreichischer Jude war. In einer Hand hielt er noch immer seinen Füllfederhalter; die andere lag unter seiner linken Wange. Sein kleines Gesicht war blass.
Rory ließ den Blick über die Assemblage schweifen: die brütende Maschine, den Jungen. Dies war der Webstuhl, wie er und Ben ihn inzwischen nannten, eine Maschine aus elektromechanischen Elementen und menschlichem Fleisch, mit der – das glaubten sie, und darauf deuteten ihre Theorien hin – man das Webmuster des Zeitteppichs verändern konnte. Und doch gehörte nichts davon ihm, Rory. Weder der Vannevar-Bush-Analysator, den sie vom MIT zur Verfügung gestellt bekommen hatten – als Studenten des Institute of Advanced Studies in Princeton waren sie unter dem Vorwand hierher nach Cambridge gekommen, mit dem Analysator komplizierte relativistische Modelle durchrechnen zu wollen –, noch der träumende Junge selbst und noch weniger das, was sich in dessen Kopf befand. Rory O’Malley besaß nur eines: den Willen, diese Komponenten zusammenzubringen und den Webstuhl sein Werk tun zu lassen.
Rory strich Ben eine schwarze Locke aus der Stirn. Er trug seine Haare zu lang, dachte er. Ben rührte sich nicht, was Rory nicht überraschte. Das Schlafmittel, das er ihm in seinen Mitternachtskaffee getan hatte, war stark genug gewesen. Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei den Internationalen Brigaden in Spanien mochte er Ben, den armen, tiefgründigen, gefühlsbetonten Ben. Aber er brauchte ihn auch, oder zumindest die eigentümlichen Fähigkeiten, die in diesem seinem Kopf eingeschlossen waren. Rory sah keinen großen Widerspruch in dieser Mischung aus Manipulation und Zuneigung. Es ging ihm schließlich um nichts Geringeres als um eine Reinigung der Geschichte, darum, das größte Verbrechen aller Zeiten rückgängig zu machen. Was war dagegen schon ein kleiner Trick?
Er holte einen Fetzen Papier aus der Tasche seines Sakkos. Darauf stand ein sechzehnzeiliges englisches Gedicht, mehr schlecht als recht ins Lateinische übersetzt. Er überflog es ein letztes Mal. Dies war das zentrale Element seines Projekts, ein historischer Auftrag, befrachtet mit so viel Bedeutungsgehalt und Zielorientierung, wie er nur hineinzustopfen vermochte. Jetzt würden diese Worte in den Kosmos hinausgeschickt werden und knisternd durch Gödels geschlossene zeitartige Kurven sausen wie die Punkte und Striche des Morsealphabets durch eine Telegrafenleitung – von der Zukunft in die Vergangenheit, wo ein anderes träumendes Gehirn sie empfangen würde. Er musste Ben nur vorlesen, vorlesen wie einem Kind: die vom Analysator berechneten Gödel-Trajektorien, die holprigen Verse. Das genügte. Und alles würde sich ändern.
Ben bewegte sich und murmelte etwas. Rory fragte sich, wo in den vielen Dimensionen von Raum und Zeit sein Animus jetzt wohl gerade umherschweifte.
Rory begann zu lesen. »Ach Kind! Verwoben in den Wandteppich der Zeit, und dennoch frei geboren / Cum fortia sing ich dir von dem, was ist und was sein wird …«
Der Junge schlief neben der Rechenmaschine.
Und dann …
II
Julia Fiveash verführte Ben Kamen. Nein, sie verschlang ihn geradezu.
Drei Tage nach ihrer Ankunft in Princeton verleibte sie ihn sich ein. Er hätte sie nicht aufhalten können, selbst wenn er es versucht hätte. Er war nicht mehr unschuldig, weder was Männer noch was Frauen betraf, aber nachdem sie ihn auf den Teppich seines Zimmers gestoßen und mit ihren langen englischen Gliedmaßen umschlungen hatte, kam es ihm so vor, als wäre er es bis zu diesem Moment gewesen.
Das zweite Mal liebten sie sich im Arbeitszimmer seines Mentors, Kurt Gödel. Und Ben fing an, sich Gedanken über Julias Motive zu machen.
Er lag auf Gödels Sofa, den Schritt züchtig mit seinem Jackett bedeckt. Julia stolzierte in unverfrorener Nacktheit in Gödels Zimmer umher, blätterte in den Papieren auf seinem Schreibtisch und strich mit ihren zarten Fingerspitzen über die Bücher auf den Borden. Viele der Bücher lagen noch in ihren Kisten, denn Gödel war noch nicht lange hier; er hatte sein geliebtes Wien nicht verlassen wollen und bis zur letztmöglichen Minute gezögert, als die Nazis bereits angefangen hatten, Europa wie einen riesigen Teppich aufzurollen.
Julias goldenes Haar glänzte in einem staubigen Sonnenstrahl. Sie war hochgewachsen, mit langen, muskulösen Armen und Beinen, flachem Bauch und kleinen Brüsten; sie ging wie ein Tier, selbstsicher und im perfekten Gleichgewicht. Ihr Körper war das Produkt eines privilegierten englischen Lebens, dachte Ben, eines Lebens auf Pferderücken und Tennisplätzen, in dem ihre Sexualität von einem gesunden Engländer nach dem anderen ausgeformt worden war. Sie hatte Ben ebenso leicht erobert wie die Engländer einen großen Teil des Planeten.
Er sehnte sich nach einer Zigarette, wusste jedoch, dass er sich in Gödels Zimmer keine anzünden durfte.
Schließlich nahm er seinen Mut zusammen und ging zum Angriff über. »Was tun wir hier eigentlich, Julia? Was willst du?«
Julia lachte, ein kehliger Laut. Sie war achtundzwanzig, drei Jahre älter als er; ihre Stimmte verriet ihr Alter. »Das ist aber keine sehr nette Frage. Was glaubst du denn, was ich will?«
»Weiß ich noch nicht. Hat was mit Gödel zu tun. Du hast mich benutzt, um hier reinzukommen, stimmt’s? In dieses Arbeitszimmer.«
»Kannst du’s mir verdenken? Kurt Gödel ist der größte Logiker der Welt. Man sagt, er begründe eine neue Mathematik. Oder demontiere die alte. So was in der Art, hab ich recht?«
»Du bist Historikerin. An der Princeton University, nicht hier am Institut für Mathe und Physik. Weshalb interessierst du dich für Gödel?«
»Du bist immer so was von misstrauisch. Aber das hat dich nicht dazu gebracht, mich abzuweisen. Er ist so ein ulkiger kleiner Mann, nicht wahr? Ein schäbiger Zwerg mit hoher Stirn und dicker Brille, der in seinem Wintermantel durch die Gegend huscht wie ein Kaninchen.«
»Er ist bekannt für seine Liebschaften mit seinen Studentinnen. Trotz seines nicht sonderlich ansprechenden Äußeren. Ich meine, er ist ja gerade mal erst in den Dreißigern. Damals in Wien …«
»Als ich Gödel das erste Mal gesehen habe, ging er mit Einstein spazieren. Einstein ist ja nun nicht zu übersehen, oder? Und stell dir vor, er war in Pantoffeln unterwegs, mitten auf der Straße! Weißt du, ob er mit Gödel befreundet ist?«
»Sie haben sich 1933 kennengelernt, glaube ich. Freunde? Ich weiß nicht. Einstein ist wohl das exotischste europäische Tier hier in diesem amerikanischen Zoo. Aber selbst Einstein musste vor Hitler fliehen.«
»Ach, Hitler! Ich habe ihm schon mal gegenübergestanden, weißt du.«
»Wem?«
»Hitler. Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Dass ich ihn kennengelernt habe, würde ich allerdings nicht gerade behaupten; ich bezweifle, dass er sich überhaupt an mich erinnert. Ich war Austauschstudentin, weil ich mit eigenen Augen sehen wollte, was die Deutschen taten, statt die übliche Schauerpropaganda zu schlucken. Das Land lag ja wirtschaftlich am Boden; es ist wirklich erstaunlich, wie sehr es sich binnen weniger Jahre verwandelt hat. Man hat uns sehr freundlich aufgenommen. Hitler ist eine höchst eindrucksvolle Erscheinung; er hat so eine Art, durch einen hindurchzuschauen. Goebbels dagegen hat mich in den Hintern gezwickt.«
Ben lachte.
»Und jetzt seid ihr alle hierhergewuselt, nicht? Seid vor dem Ungeheuer weggelaufen, bis nach Amerika.« Sie rümpfte die Nase. »Dass so ein winziger, verstaubter Raum einen Geist von Weltrang beherbergt! Gödel hätte nach Oxford gehen sollen. Einstein auch. Wäre besser gewesen als das hier. Ich meine, hier gibt’s Kreuzgänge aus Ziegelstein! Bertrand Russell sagt, Princeton sei Oxford so ähnlich, wie es ein Nachbau von Affen nur sein könne.« Sie lachte bezaubernd.
»Vielleicht fühlen sich Einstein und Gödel hier sicherer als in einem England, wo es Leute wie dich gibt.«
»Eigentlich bist du nicht sehr nett zu mir, was? Jedenfalls wäre Gödel im Reich nicht in Gefahr. Er ist ja nicht mal Jude.« Sie nahm ein paar Bücher von den Borden und blätterte in deren abgegriffenen Seiten.
Ben las seine auf dem Fußboden verstreuten Kleidungsstücke auf und begann sich anzuziehen. »Du hast deinen Spaß gehabt. Vielleicht solltest du allmählich damit rausrücken, was du von mir willst.«
»Tja, es sind da so einige Gerüchte im Umlauf«, sagte sie aalglatt. »Über dich und deinen Professor. Schau dir diese Titel an. Sein und Zeit von Martin Heidegger. An Experiment With Time von John William Dunne. Texte zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Edmund Husserl. Du hast schon in Wien mit Gödel zusammengearbeitet, und jetzt, wo er hier am IAS ist, macht ihr damit weiter, stimmt’s? Aber ihr arbeitet nicht an entlegenen Bereichen der mathematischen Logik.« Sie warf einen Blick auf eine von Gödel eigenhändig hingekritzelte Bleistiftnotiz auf dem Vorsatzblatt von Husserls Werk. »Mit meinem Deutsch hapert’s noch ein bisschen … ›Die Unterscheidung zwischen physischer Zeit und dem inneren Zeitbewusstsein. ‹ Ist das richtig?« Als sie in den Büchern blätterte, breitete sich ein Geruch von Staub und abgestandenem Tabak aus – der Geruch von Wien. »Ah. Die Zeitmaschine von H. G. Wells. Dachte ich mir doch, dass ich das hier finden würde!«
Er fühlte sich in die Enge und in die Defensive gedrängt, ein Gefühl, das er noch aus Wien kannte, wo ihn die »Anti-Relativitäts-Clubs« und andere antisemitische Gruppen aufs Korn genommen hatten. »Wie hast du das alles rausgefunden? Hast mit der halben Fakultät geschlafen, wie?«
Sie lächelte ihn an, nackt und vollkommen gelassen. »Und ich weiß auch, woran du noch gearbeitet hast. An etwas, worüber nicht mal Gödel Bescheid weiß. Es hat mit der Relativität zu tun und mit diesem schmalzigen Zeug von innerer Zeit und Bewusstsein … Es geht über bloße Theorie hinaus. Und du hast nicht allein daran gearbeitet. Ich rede von Rory O’Malley.«
»Was weißt du von Rory?«
»Ich hab so das Gefühl, dass ich mehr über deinen irischen Freund weiß als du.« Sie strich ihm mit einem trägen Finger über den nackten Arm; er erschauerte unwillkürlich und knöpfte sich das Hemd zu. »Komm schon, Ben. Raus mit der Sprache. Es geht das Gerücht …«
»Ja?«
»Dass du mit deinem irischen Freund eine Zeitmaschine gebaut hast.«
Er zögerte. »Es hat nicht das Geringste mit Wells’ Hirngespinst zu tun. Und wir haben nur mit Ideen – Konzepten – rumgespielt, das ist alles. Wir haben einige Berechnungen durchgeführt …«
»Das ist alles? Bist du sicher?«
»Natürlich bin ich sicher! Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht nötig ist, weil …«
»Rory O’Malley ist nicht gerade die Verschwiegenheit in Person. So viel weißt du doch bestimmt über ihn. Er hat was anderes gesagt.«
Als Ben klar wurde, was ihre Worte bedeuteten, krampfte sich sein Magen zusammen. War das möglich? Aber wie, ohne sein Wissen? O Rory, was hast du getan?
Julia sah seine Angst und lachte ihn aus. »Ich finde, du solltest Rory anrufen. Wir haben einiges zu bereden.«
III
»Ich habe Physik studiert«, sagte Rory langsam. »Ich war ein intelligentes Kind. Die Relativität hat mich fasziniert. Es gab bestimmt nicht viele andere fünfzehnjährige Schüler in Dublin, die ein Exemplar von Einsteins 1905 publizierten Abhandlungen besaßen – und noch weniger, die sie in der Sprache lesen konnten, in der sie ursprünglich abgefasst worden waren, in Deutsch.
Aber ich fühlte mich auch zur Geschichte hingezogen. Warum betont man bei einem Mann wie Einstein immer so, dass er Jude ist? Und überhaupt, warum lag die christliche Kirche – ich war irisch-katholisch – immer in einem solch schrecklichen Konflikt mit den Juden? Also begann ich, Geschichte zu studieren. Religion. Philosophie …« Er sprach unsicher und zupfte dabei an seinen Fingern.
Rory war ein dunkler Typ, noch dunkler als Ben. Er scherzte, das irische Blut seiner Familie sei von dunkelhäutigen Spaniern verunreinigt worden, die aus den Wracks der Armada an Land gespült worden seien. Der kleine Fleck Narbengewebe an seinem Hals war ein Überbleibsel der Nationalistenkugel, die ihn in Spanien um ein Haar getötet hätte. Rory war ein stämmiger, bulliger Mann, ein Ire, der sich in Amerika durchgeschlagen und in Spanien dem Tod ins Auge geblickt hatte. Dennoch wirkte er eingeschüchtert, als er nun vor Julia saß. Sie war in ihrem üblichen Stil gekleidet – ein beinahe männliches Kostüm mit Jackett und Hose, dazu eine hemdartige Bluse und eine lose gebundene Krawatte –, und Zigarettenrauch umrahmte ihr makelloses Gesicht.
Die drei saßen in Rorys Wohnung im baumbestandenen Herzen von Princeton. Das Wohnzimmer war klein, aber hell, und die langen Schiebefenster waren geöffnet, um die grüne Luft eines amerikanischen Frühlingstags hereinzulassen. Sie hockten auf verschlissenen, schmutzigen Möbelstücken inmitten unordentlicher Stapel von Büchern über Physik und Geschichte, über die Wurzeln des Christentums und die philosophischen Implikationen von Einsteins Relativität. Es war ein staubiges Zimmer, in dem ein chaotisches Durcheinander herrschte, aber es spiegelte Rory O’Malley wider, dachte Ben, als wäre es eine Projektion seines Geistes.
Es hatte ein paar Wochen gedauert, bis Julia diese Zusammenkunft anberaumt hatte. Sie benötige etwas Zeit, um einige Aspekte von Rorys »Bericht« zu überprüfen, hatte sie dunkel angedeutet, und nun war sie mit einer schmalen Aktentasche angerückt, in der sich vermutlich die Früchte dieser Recherchen befanden. Ben ertappte sich dabei, dass er die Aktentasche mit bangem Blick betrachtete.
Auch war ihm gar nicht wohl dabei zumute, wie Rory auf Julias inquisitorische Fragen hin freimütig Auskunft über sich gab – und über ihn gleich mit.
»Du musst nicht mit ihr reden, wenn du nicht willst, Rory«, sagte er scharf. »Ich meine, wer ist sie schon?«
Rory sah ihn niedergeschlagen an. »Weißt du’s denn nicht?«
Julia lächelte bloß.
»Ich will dir sagen, wer sie ist«, erklärte Rory. »Sie ist eine verdammte SS-Offizierin, das ist sie. Sie hat weitaus mehr getan, als Hitler die Hand zu schütteln.«
Ben starrte sie entsetzt an.
Julia nahm eine neue Zigarette aus dem silbernen Etui, das sie bei sich trug. »Ach, nun schau nicht so schockiert drein, Benjamin. Ich entschuldige mich dafür, dass ich’s dir nicht gesagt habe. Aber du hättest wohl kaum mit mir geschlafen, wenn du’s gewusst hättest, oder? Machen wir weiter. Ihr habt euch in Spanien kennengelernt, während des Bürgerkrieges.«
Rory war sichtlich unwohl zumute. Er antwortete mit stockender Stimme.
Schon mit zweiundzwanzig Jahren war er aus seiner Geburtsstadt Dublin nach New York gegangen, vorgeblich um zu studieren. Doch er hatte sich rasch einen Namen als Kolumnist gemacht, weil er ein energischer Idealist war, der kein Blatt vor den Mund nahm. Dann war er nach Spanien gegangen, um an einem Buch über die siebenhundertjährige Geschichte von Koexistenz und Konflikt zwischen Christentum und Islam auf der Iberischen Halbinsel zu arbeiten.
»Ich war in Sevilla, als die ganze Sache losging. Der Bürgerkrieg. Die Stadt ist Francos Nationalisten binnen Tagen in die Hände gefallen. Nach der Einnahme der Städte war das Blutvergießen noch schlimmer, weil die Nationalisten Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben. Also bin ich nach Norden geflohen, in die republikanischen Gebiete.«
»Und dort seid ihr euch begegnet?«, wandte sich Julia an Ben.
»Ich hatte in Deutschland schon genug von den Faschisten gesehen«, sagte Ben widerstrebend. »Ich bin nach Spanien gegangen, um in den Internationalen Brigaden zu kämpfen. Hinterher bin ich nicht mehr nach Österreich zurückgekehrt. Die Amerikaner in meiner Brigade haben mir geholfen. Zu guter Letzt ist es ihnen gelungen, mir ein Visum für die Staaten und einen Studienplatz hier in Princeton zu besorgen, wo ich mein Studium fortsetzen konnte.«
»Die Spanier haben mich noch nie sonderlich beeindruckt«, sagte Julia forsch. »Sie hatten all diesen Reichtum, ein Weltreich, das Gold der Inkas und der Azteken. Und binnen eines Jahrhunderts nach Kolumbus haben sie alles für dynastische Kriege verschleudert. Und dann ihr Bürgerkrieg – welch sinnloser Konflikt!«
»Dreihundertfünfzigtausend Menschen sind gestorben«, erwiderte Rory zornig. »Viele davon durch deutsche und italienische Bomben und Kugeln.«
»Man hat neue Formen der Kriegsführung erprobt. Ein imperialer Staat wurde zu einem Testgelände für die Waffen überlegener Mächte. So viel zu Spanien!«
»Du bist verdammt kalt, Julia«, fuhr Ben auf.
Julia lachte. »Nein. Nur realistisch. Habt ihr miteinander geschlafen?«
Sie antworteten gleichzeitig. »Nein«, sagte Rory, und Ben, wehmütiger: »Nur ein einziges Mal.«
»Und bei eurem Bettgeflüster in Spanien habt ihr dann wohl angefangen, von Zeitmaschinen zu träumen.«
»Es war eine Bündelung von Interessen«, meinte Ben.
»Bei meinem Geschichtsstudium habe ich irgendwann eine ungeheure Unzufriedenheit verspürt«, sagte Rory. »Es hätte nicht so sein müssen! All das Leid, das Blutvergießen – insbesondere wenn es von Religionen und von Friedensaposteln ausgelöst worden war. Ich habe mich gefragt, ob das alles sein musste – und mir sehnlichst gewünscht, es wäre nicht so gewesen.« Er warf Ben einen Blick zu. »Dann hat Ben von Gödel gesprochen, diesem exzentrischen Mathematikergenie, das mit Einsteins Gleichungen herumjongliert und sich vorgestellt hat, dank sogenannter ›geschlossener zeitartiger Kurven‹ wäre es vielleicht möglich, die Vergangenheit zu beeinflussen …«
»Und dazu noch meine Träume«, sagte Ben.
Julia musterte ihn. »Was für Träume?«
»Ich hatte schon immer intensive Träume. Oft sind sie wie Erinnerungen an Stippvisiten bei Geschehnissen der Vergangenheit – und der Zukunft. Ein- oder zweimal …«
»Sprich weiter.«
»Einmal hat er von der Kugel geträumt, die mich beinahe umgebracht hätte«, warf Rory ein und berührte seinen Hals.
»Du hast präkognitive Fähigkeiten«, sagte Julia zu Ben.
»Das würde John William Dunne wohl auch sagen. Er würde vielleicht davon sprechen, dass mein Animus frei in einer multidimensionalen Raumzeit schwebt.«
»Glaubst du das auch?«
»Nein.« Er seufzte. »Ich bin einer der rationalsten Menschen, denen du wahrscheinlich jemals begegnen wirst, Julia. Ich glaube nicht mal an Gott. Und doch sind andere davon überzeugt, dass ich solche Kräfte besitze. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals?«
»Aufgrund solcher Hinweise auf präkognitive Fähigkeiten und auf der Basis von Gödels Spekulationen über Reisen in die Vergangenheit habt ihr also angefangen, eine Zeitmaschine zu entwickeln«, sagte Julia.
»Keine Maschine«, sagte Rory. »Obwohl wir ihr einen maschinenähnlichen Namen gegeben haben.«
»Der Webstuhl.«
»Ja. Aber eigentlich ist es eine Methode.«
»Eine Methode, die Vergangenheit zu beeinflussen. Sie zu verändern. Richtig? Und nach eurem Aufenthalt in Spanien seid ihr an dieses Institut gekommen, wo ihr daran gearbeitet habt, eure ›Methode‹ zu realisieren. Ihr habt euch sogar Zeit auf einer Rechenmaschine in Massachusetts erschlichen. Und du, Rory, hast angefangen darüber nachzudenken, welche Veränderung genau vorgenommen werden sollte, wenn du die Geschichte ändern könntest, die du so unbefriedigend findest.«
Rory schwieg. Ben starrte ihn an.
»Na, komm schon. Wenn du’s ihm nicht sagst, kann ich’s gern für dich tun – und das werde ich auch.« Sie klopfte auf ihre Aktentasche.
»Na schön«, platzte Rory heraus. »Es war Nicäa.«
Ben war verwirrt. »Nicäa?«
Julia lächelte. »Du bist ganz offenkundig nicht so vertraut mit der Geschichte des Christentums wie dein kleiner Freund hier, Ben. Nicäa, im Jahre 325 des Herrn. Wo Kaiser Konstantin sein großes Kirchenkonzil einberufen hat.«
»Konstantin!«, fauchte Rory. »Es war alles seine Schuld!«
IV
»Ah, die Römer«, sagte Julia. »Sie waren zweifellos Arier. Hitler hat genug gute Wissenschaftler, die das beweisen können … Vor Konstantin war Jesus ein Sklavengott«, erklärte sie spöttisch. »Konstantin hat das Christentum zur römischen Staatsreligion erhoben und damit die Zukunft der Kirche gesichert.«
»Nur indem er sie in ein Spiegelbild Roms verwandelt hat! Und ebendiese römische Autokratie und Intoleranz waren die Wurzel all des Bösen, das seither im Namen Jesu Christi geschehen ist.«
»Und darum hast du einen kühnen Plan ausgeheckt, nicht wahr? Den Plan, mit Hilfe eures Webstuhls der Zeit ein paar Fäden der Historie aufzutrennen.«
»Davon hast du mir kein Wort gesagt«, wandte sich Ben vorwurfsvoll an Rory.
»Natürlich nicht«, sagte Rory kläglich. Er vermied es nach wie vor, Ben in die Augen zu schauen. »Du hättest mich ja daran gehindert.«
»Er hat sich eine Botschaft ausgedacht, die er in die Vergangenheit schicken wollte«, sagte Julia fröhlich. »So etwas wie eine retrospektive Prophezeiung, ja? Die wolltest du in die Zeit von Kaiser Claudius und seiner Invasion in Britannien senden, so viel ich weiß. Sie sollte Informationen über die Zukunft enthalten – und ein paar Albernheiten über Demokratie …«
»Die Ära der Republik war Roms beste Zeit«, erwiderte Rory trotzig. »Sie hat Amerika noch Jahrhunderte später inspiriert. Ich wollte ihnen Hoffnung schenken.«
»Wem?«, fragte Ben.
»Du weißt doch, wie es funktioniert, Ben. Wir können keine bestimmte Person in der Vergangenheit anvisieren. Wir können nur senden. Und hoffen, dass es Leute gibt, die genauso aufnahmefähig sind wie du – natürliche Empfänger, die auf Informationen aus der Zukunft warten.«
»Das prophetische Zeug war als eine Art Lockmittel gedacht, stimmt’s, Rory?«, meinte Julia. »Du hast es in die Zeit vor Claudius zurückgeschickt, in das Jahr von Christi Geburt, um die Aufmerksamkeit der frühen Christen zu erregen. Du wolltest dir dein Opfer in der Vergangenheit mit ein wenig Vorwissen angeln, das ihm Macht oder Reichtum verschaffen konnte, zum Beispiel über den Bau des Hadrianswalls. Und du hast gehofft, es würde diese Macht deinen Intentionen gemäß nutzen: um deinen eigentlichen Befehl auszuführen.«
»Und der wäre?«, fragte Ben.
Julia grinste. »Kaiser Konstantin zu töten!«
Ben merkte, dass er am Rand der Panik war. »Rory – wir haben doch über die Gefahren gesprochen –, woher nimmst du das Recht, solche Entscheidungen zu treffen?«
»Woher nehmen wir das Recht, eine solche Gabe nicht zu nutzen?«
Bens Gedanken rasten. »Aber das ist doch bloß ein Hirngespinst. Nur Gerede. Konstantin ist vor Nicäa nicht umgebracht worden, oder? Und die Kirche ist nicht in einen Zustand der Unschuld zurückversetzt worden. Der Papst sitzt noch immer in Rom.«
»Rorys Plan ist fehlgeschlagen«, sagte Julia.
»Tja, das kann ich nicht leugnen«, meinte Rory.
»Aber er hat es versucht, Ben.«
»Das ist unmöglich.«
»Nein.« Sie lächelte. »Ich habe einen Beweis dafür.«
Rorys Augen wurden schmal. »Was meinst du damit ?«
»Die Partei hat eine ziemlich gute Forschungseinrichtung. Sie hießt ›Ahnenerbe‹ und ist Himmler unterstellt. Einige recht innovative Forschungsarbeiten über die Ursprünge der Rassen. Ich habe ihnen geschrieben …« Sie öffnete ihre Aktentasche und holte ein zerfleddertes Buch heraus: eine Geschichte Roms.
Es war Julias Nazi-Wissenschaftlern nicht gelungen, Rorys Testament in vollem Umfang aufzuspüren. Einige Elemente waren jedoch in ein autobiografisches Werk von Kaiser Claudius aufgenommen worden. Auch dieses Werk war verloren gegangen, aber andere historische Werke bezogen sich darauf, und aus den Verweisstellen hatten sich mit ein wenig Sorgfalt und ein paar Vermutungen einige von Rorys Zeilen rekonstruieren lassen. Julia schlug das Buch bei einer markierten Seite auf und reichte es Ben. Ungläubig las er den verblichenen Text auf dem alten, vergilbten Papier:
Ruf ins Gedächtnis dir die Wahrheiten, die wir für selbstverständlich halten –
Ich sage dir, dass alle Menschen gleich und frei erschaffen sind, mit
Rechten, unveräußerlich, vom Schöpfer ihnen zugeeignet;
Etwa dem Recht auf Leben, Freiheit und aufs Glücksbestreben.
O in die Zeit verwobnes Kind, versuch die Wurzel auszureißen!
»Bei allem, was heilig ist«, sagte Ben. Sein Herz klopfte heftig.
Julia lächelte. »Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. So herrlich plump!«
»Offenbar hab ich’s wirklich geschafft«, sagte Rory mit großen Augen. »Das sind meine eigenen Worte, wie ich sie 1940 zusammengebastelt habe – durch die Jahrhunderte in die Vergangenheit übertragen und nun in diesem zerlesenen alten Geschichtsbuch festgehalten. Dieses Beweisstück habe ich noch nie gesehen. Ja, mein Plan ist fehlgeschlagen – Konstantin ist am Leben geblieben –, aber der Webstuhl funktioniert .« Er lachte, doch es klang schrill.
»Das hättest du gar nicht gekonnt«, sagte Ben schwach. »Ich bin ein unverzichtbarer Bestandteil des Webstuhls – meine angebliche Präkognition …«
»Er hat dich betäubt«, sagte Julia schlicht. »Dich betäubt und im Schlaf benutzt. Hättest du sein Vorhaben verhindert?«
»Natürlich.«
»Warum? Weil du Konstantin so toll findest?«
»Nein.« Er sah Rory mit wachsendem Entsetzen an. »Weil ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass der Webstuhl, falls er jemals benutzt wird, eine ungeheure Gefahr darstellt. Der Webstuhl ist eine Waffe – er erschafft die Geschichte nicht, er zerstört sie!«
»Aber er funktioniert«, meint Rory mit ausdrucksloser Stimme.
»Ja«, sagte Julia. »Hitler verabscheut das Christentum, wisst ihr. Er sagt, logisch zu Ende gedacht, bedeute es die systematische Kultivierung menschlichen Versagens. Ich denke, deine Versuche, die christliche Religion zu destabilisieren, werden seine Zustimmung finden.«
»Was soll das denn heißen?«, bellte Rory.
»Ich glaube wirklich, das Ahnenerbe ist der geeignete Ort, um dieses Projekt fortzuführen, meinst du nicht? Mit der richtigen Finanzierung und ein paar guten Forschern statt einem halbgebildeten irischen Halunken und einem verwirrten jüdischen Träumer, mit einer besseren Rechenmaschine als diesem antiquierten Gerät am MIT …«
»Du willst den Nazis eine Zeitmaschine geben?« Ben fühlte sich schwach. »Oh, das ist ein guter Plan.«
»Du hast also vor, Hitler zu unterstützen?«, fragte Rory.
Julia zuckte die Achseln. »Was kümmert’s dich? Irland ist in diesem Krieg neutral.«
»Aber dein eigenes Land nicht.« Rory stand auf. »Ihr englischen Aristokraten seid doch alle gleich. Ihr und euer verfluchtes Empire. Jetzt heißt es, lieber Hitler als eine Labour-Regierung, hm? Also, eins sag ich dir, diese Mörderbande kriegt meine Arbeit nicht in die Finger.« Er hob eine Faust und trat auf sie zu.
Es ging alles ganz schnell. Von irgendwoher brachte Julia eine Schusswaffe zum Vorschein. Ben hatte noch Zeit, um zu registrieren, wie klein sie war, wie hervorragend gearbeitet, wie teuer sie aussah. Sie hob die hübsche, versilberte Pistole und schoss Rory ins Herz. Rory machte ein überraschtes Gesicht und schaute auf das blutige Loch in seiner Brust hinunter. Dann erschauerte er; seine Knie gaben nach, und er brach zusammen.
»Wie bedauerlich«, sagte Julia. »Da haben wir eine ganz schöne Schweinerei in dieser Wohnung angerichtet, was? Ich brauche ihn nicht. Zweifellos steht alles hier in diesen Büchern und Papieren. Aber dich brauche ich natürlich.« Sie drehte sich zu Ben um und lächelte. »Dich und deine Träume.«
»Du willst mich deinem Ahnenerbe ausliefern. Den Deutschen.«
»Sie sind schon hier. Überall um das Gebäude herum.«
»In Nazideutschland werden sie dich lieben«, sagte er.
»O ja, das werden sie. Sie tun’s jetzt schon! Also, kommst du nun ohne Widerstand mit oder …«
Er hielt immer noch das schwere Geschichtsbuch in der Hand. So hart er konnte, knallte er es ihr gegen die Schläfe. Seine Bewegung kam aus dem Nichts, ohne die geringste Vorwarnung. Julia ging noch schneller zu Boden als Rory, und die Waffe fiel ihr aus der Hand.
Ben schaute auf das Durcheinander. Julia, lang hingestreckt über Rorys Beinen, die silberne Pistole auf dem Boden. Er sollte alle Spuren ihrer Arbeit vernichten. Die Waffe nehmen. Julia töten.
Er wusste, dass er es nicht konnte. In seinem Kopf war nur der Gedanke an Flucht, sonst nichts. Er wollte weglaufen, so weit er konnte, weg aus Princeton, aus Amerika – vielleicht bis nach England, wo er zumindest sicher sein konnte, nicht auf Nazis zu treffen.
Aber zunächst musste er diesen Tag überstehen, ohne geschnappt zu werden. Er ging zur Tür und hielt Ausschau nach Julias deutschen Helfershelfern.
ERSTER TEIL
INVASOR MAI-SEPTEMBER 1940
I
31. Mai – 1. Juni 1940
Am Freitag, dem 31. Mai, hörte Mary Wooler in den Abendnachrichten der BBC von der verzweifelten Evakuierung aus Frankreich. Es war das erste Mal, dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Die Operation lief bereits seit fünf Tagen.
Sie verbrachte eine schlaflose Nacht, in der sie fast ständig mit dem Kriegsministerium telefonierte und herauszufinden versuchte, was aus ihrem Sohn geworden war. Es klang, als würden alle Bemühungen scheitern, die British Expeditionary Force, das Expeditionskorps, von Dünkirchen aus zu evakuieren. Es war chaotisch, eine sich anbahnende Katastrophe. Trotzdem erklärte man ihr, dass Elemente von Garys Division nach Hastings an der Südküste gebracht werden sollten, sofern sie überhaupt zurückkämen. Also musste sie dorthin.
Am Samstagmorgen brach sie mit ihrem Leihwagen, einem Austin Seven mit weiß lackierten Stoßstangen und Plastikblendschirmen über den Scheinwerfern, von ihrer Mietwohnung in London zur Küste auf.
Die Fahrt hätte eigentlich ganz einfach sein sollen. Sie wollte ungefähr in südsüdöstlicher Richtung fahren, durch Croydon, Sevenoaks und Tunbridge Wells, und dann das ländliche Sussex durchqueren, bis sie über einen kleinen Ort namens Battle, wo die Engländer einst den Normannen gegenübergestanden hatten, nach Hastings gelangte. So sah zumindest ihr Plan aus.
Aber sie wusste nie, wo, zum Teufel, sie sich gerade befand. Unterwegs sah sie Trupps von Arbeitern, die Wegweiser entfernten und Metallplatten mit Dorfnamen abschraubten. Keine Namen! Als Journalistin und Historikerin hatte sie sich ihren Lebensunterhalt stets mit Wörtern verdient, und sie fand es seltsam, dass die Engländer ihr Land schützen wollten, indem sie ihm seine Wörter raubten, jene Bedeutungsschicht, die der Landschaft ihren menschlichen Kontext verlieh: Wörter, die ein Mischmasch aus normannischem Französisch, Altnordisch, Altenglisch und sogar ein bisschen Latein waren, Relikte anderer tumultuarischer Zeiten, Wörter wie Kugellöcher. Nun, vielleicht würde es General Guderian und seine Panzer verwirren, aber auf jeden Fall verwirrte es Mary.
Dennoch, die Sonne war ein Leitstern am klaren Himmel. Mary orientierte sich an ihr und fuhr einfach weiter nach Süden. Es war schließlich kein so großes Land, und irgendwann musste sie an die Küste gelangen.
Mittlerweile war dieser erste Junitag außerordentlich schön, einer jener frühen Sommertage, die England einem so leichthändig servierte. Über einem zerknautschten grünen Teppich aus Feldern und Hecken stiegen die Vögel wie Spitfires in die Luft. Es ergab keinen Sinn, dachte Mary. Wie konnte all dies zugleich mit den Schrecknissen des Krieges in Europa existieren, die sich nur ein paar Dutzend Meilen entfernt entfalteten? Entweder war der Krieg nicht real, oder der Sommertag war es nicht; sie passten nicht ins selbe Universum.
Sobald sie die letzten Binnenstädte hinter sich gelassen hatte und sich der Küste näherte, traten die Zeichen des Krieges deutlicher zutage. An den Kreuzungen standen MG-Unterstände, einige so neu, dass man den noch feuchten Beton glänzen sah. Sie war jedes Mal nervös, wenn sie eine Brücke überquerte, denn die Home Guard – Veteranen des Weltkriegs 14/18 und Jugendliche, die noch nicht alt genug waren für den Kriegsdienst – verminte die Brücken, und wer wusste schon, ob sie mit hochexplosiven Sprengstoffen umgehen konnten oder nicht.
Als sie dann nah genug war, um von höher gelegenem Gelände aus einen Blick aufs Meer zu erhaschen, wurde der Verkehr lebhafter. Die meisten Fahrzeuge fuhren in die Gegenrichtung, landeinwärts, ein steter Strom von Privatwagen, ganze Familien mit Mutter, Vater, Kindern, Hund und dem Wellensittich in seinem Käfig, und auf den Dachgepäckträgern türmten sich Koffer und sogar Möbelstücke. Trotz der offiziellen Anordnungen, »an Ort und Stelle zu bleiben«, wie Mary den neuen Premierminister Winston Churchill auf BBC hatte sagen hören, entleerten sich ganze Städte nordwärts, weil die Menschen sich in Sicherheit zu bringen versuchten. Unter den fliehenden Engländern waren auch Flüchtlinge, die von viel weiter her kommen mussten, Busse und Lastwagen voller Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Leute und vereinzelt auch Männer in waffenfähigem Alter. Dicht gedrängt, schmutzig und erschöpft starrten sie auf die funkelnde englische Landschaft hinaus, während sie vorbeifuhren.
An einer Kreuzung gab es einen Stau. Ein Armeelaster hatte einen Reifen verloren, und ein paar Soldaten mühten sich ab, einen neuen aufzuziehen. Die Soldaten hatten sich in der Hitze der Sommersonne bis auf ihre Khakihemden ausgezogen, und während sie mit den schweren Rädern kämpften, schwatzten und lachten sie miteinander, und Zigaretten baumelten von ihren Lippen. Der Verkehr musste sich langsam vorbeischieben; die vollgeladenen Busse und Lastwagen holperten übers Bankett.
Mary stand auf einmal einem Bus gegenüber, der seinem Schild zufolge nach Bexhill und Boreham Street fuhr. Sie schaute einem kleinen Jungen in die Augen, der auf dem Schoß einer Frau saß, vermutlich seine Mutter. Er war vielleicht acht oder neun Jahre alt. Sein Haar war verstrubbelt, der Schmutz in seinem Gesicht von getrockneten Tränen gestreift. Er schien einen Schulblazer zu tragen, aber die Farbe war seltsam – leuchtendes Orange, nicht wie in England üblich. Er sagte etwas, aber sie konnte es ihm nicht von den Lippen ablesen. Womöglich sprach er ja Französisch, Holländisch oder Wallonisch – vielleicht sogar Deutsch.
»Willkommen in England«, formte sie mit den Lippen.
II
Schließlich erreichte sie eine Küstenstadt. Aber welche?
Sie folgte einem Bahngleis bis zu einem kleinen Bahnhof. Keine Namensschilder. Dort stand ein Zug bereit, der offenkundig für Soldaten reserviert war; jemand hatte WILLKOMMEN DAHEIM BEF an einen Waggon geschrieben. Es war durchaus sinnvoll, die zurückgekehrten Soldaten so schnell wie möglich ins Landesinnere zu bringen, weg von den Gefahren der Küste. Aber es waren keine Soldaten da, die weggebracht werden konnten; der Zug stand nutzlos herum.
Sie gelangte zu einer Straße, die am Meer entlangführte, bog links ab und folgte der Küste. Zu ihrer Rechten lag die See, stahlgrau und ruhig, mit schimmernden Glanzlichtern, übersät von Booten. Es herrschte Ebbe, und sie sah einen steinigen, mit Stacheldrahtknäueln und großen Betonquadern bedeckten Kiesstrand. Diese Küstenbefestigungen waren nur die äußere Kruste eines ganzen Landes, das sich in eine Festung verwandelte; die Küstenlinie wurde auf einer Länge von vielen hundert Kilometern verstärkt, und ausgeklügelte Abwehrsysteme erstreckten sich bis tief ins Landesinnere hinein. So weit sie sehen konnte, ging der Strand immer weiter; vor ihr, im Osten, krümmte er sich sanft in eine Bucht. In Hastings gab es einen Hafen, aber hier nicht; sie war also nicht in Hastings.
Sie wusste nicht recht, was sie tun sollte. Sie war ohne Pause von London bis hierher gefahren. Ihre Knochen waren steif, sie hatte Durst, und da sie wenig geschlafen hatte, war sie zum Umfallen müde.
Sie stellte den Wagen an der Strandseite der Straße ab und stieg aus. Es war gegen Mittag. Das Sonnenlicht, die salzige Meeresluft wirkten auf sie wie ein starker Gin. Auf der Küstenstraße herrschte reger Verkehr, und sie sah eine Vielzahl der Uniformen, die sie bereits aus London gewohnt war – das Khaki der Army, das Dunkelblau der Navy, das hellere Schieferblau der Air Force, und Frauen in den Uniformen des Auxiliary Territorial Service, des Heimatschutzdienstes, oder der Wrens, des weiblichen Marinedienstes.
Sie ging ein Stück am Strand entlang. Verbotsschilder untersagten Zivilisten, den Strand zu betreten, und warnten, dass der Kies vermint sei. Und wenn sie an diesem strahlenden Sommertag aufs Meer hinausschaute, konnte sie tatsächlich den Krieg in Europa sehen, das Aufblitzen herabstoßender Flugzeuge, und sie hörte auch fernen Geschützdonner. Weit weg stieg eine Rauchwolke turmhoch empor. Sie ertappte sich dabei, wie sie sich im Geist Notizen für ihren nächsten Artikel machte. Seit dem Tag der Kriegserklärung im vergangenen September hatte sie sich kaum aus London herausgewagt. Sie versuchte sich vorzustellen, wie sich diese Szene in ihrer Heimat abspielte, an einer auf ähnliche Weise befestigten Atlantikküste.
Die Evakuierung ging indessen weiter voran. Im tieferen Wasser glitten Schiffe der Navy dahin, blaugraue Silhouetten, während kleinere Schiffe pausenlos zwischen England und Frankreich hin und her fuhren, Trawler, Drifter, Garnelen- und Krabbenfänger, Fischkutter, ein paar Rettungsboote sowie viele Jachten und kleine Motorboote. Große, mit dem Namenszug »Pickfords« geschmückte Lastkähne, deren eigentliche Aufgabe darin bestand, Fracht an der Küste entlang zu befördern, wälzten sich schwerfällig dahin. Ein Teil des Strandes war geräumt worden, damit die Boote landen konnten; man hatte den Stacheldraht zerschnitten und weggezogen und die Panzersperren beiseite geschoben. Mary sah, dass Trupps mit Tragbahren auf dem Kies warteten, und der WVS, der Women’s Voluntary Service, hatte Tische mit Union-Jack-Fähnchen und Schildern aufgestellt, auf denen WILLKOMMEN DAHEIM, JUNGS stand. Tee kochte in riesigen Teemaschinen, und Sandwiches stapelten sich auf Platten. Aber niemand trank den Tee, niemand aß die Sandwiches.
Dies war Operation Dynamo, die Evakuierung aus Frankreich. Die BBC hatte das Thema die ganze Nacht hochgespielt, die kleinen Schiffe Englands, die nach Frankreich fuhren, um der Navy zu helfen, eine besiegte Armee heimzuholen. Erschreckenderweise kamen die kleinen Schiffe jedoch leer zurück.
»Sie können hier nicht parken, Madam.« Mary drehte sich um. Ein ziemlich junger Mann mit einer schweren schwarzen Jacke und einem Tellerhelm, der wie ein Überbleibsel aus dem Weltkrieg 14/18 aussah. Er trug ein Gewehr, einen Segeltuchbeutel mit einer Gasmaske über der Schulter und eine Armbinde, in die »ARP« eingestickt war. Air Raid Precautions, der Luftschutz, noch eine der neuen Freiwilligentruppen Großbritanniens. »Wir versuchen, die Strände und den Weg in die Stadt freizuhalten.«
»Ja, das sehe ich. Tut mir leid. Hören Sie …«
»Und Sie sollten Ihre Gasmaske dabeihaben.«
»Die liegt im Wagen.«
»Laut Vorschrift muss man sie immer bei sich tragen.« Er sprach ein neutrales Englisch, wie sie fand, und klang recht gebildet. Nun musterte er sie eingehender, mit misstrauischer Miene. »Darf ich fragen, was Sie hier machen? Sie scheinen sich verfahren zu haben.«
»Ich möchte nach Hastings. Mein Sohn kommt mit der BEF nach Hause, das hoffe ich wenigstens.«
»Und Sie wissen nicht, wo Hastings ist?«
Sie versuchte sich zu beherrschen. »Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Hören Sie, wenn Sie mir einfach den Weg nach Hastings zeigen könnten …«
»Woher kommen Sie? Aus Kanada? Ich weiß, dass es kanadische Einheiten bei der BEF gibt.«
»Nein, ich bin Amerikanerin. Den Fehler macht man leicht.«
Seine Augen wurden schmal, und er trat auf sie zu. Er hinkte ein wenig; vielleicht hatte ihn das vor der Einberufung bewahrt. »Nicht nötig, so einen Ton anzuschlagen, Madam. Sie sind in Bexhill.« Er zeigte nach Osten, die Küstenstraße entlang. »Hastings ist ein paar Kilometer in dieser Richtung. Fahren Sie einfach durch Saint Leonard, dann können Sie’s gar nicht verfehlen.«
»Danke.« Sie eilte zu ihrem Wagen zurück.
Im Rückspiegel sah sie, wie er dort stand und ihr nachschaute. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass sie sich an der belagerten Küste eines Landes befand, in dem man den starken Verdacht hegte, dass der Feind nicht erst kam, sondern vielleicht schon da war, in der einen oder anderen Verkleidung. Er zurrte seinen Helm fest und setzte seinen Patrouillengang am Strand fort.
Auf der Küstenstraße, die schnurstracks nach Osten führte, waren zahlreiche Lastwagen, Busse und andere Transportfahrzeuge sowie – beunruhigenderweise – Krankenwagen unterwegs.
Sie kam in eine andere Stadt und sah einen Pier, um dessen mächtigen Unterbau sich Boote drängten. Man hatte den Pier vom Land getrennt, damit er nicht von deutschen Invasoren benutzt werden konnte. Sie fuhr weiter, bis die Straße am Fuß eines steil aufragenden Hügels aus Schichtgestein vorbeiführte, auf dem sich die Ruinen einer Burg ausbreiteten. Dies war eine Seestadt mit Hotels und einem Konzertpavillon. An diesem Sommersamstag sah Mary jedoch keine Kinder auf den Straßen. Zweifellos alle ins Landesinnere evakuiert, wegen der Invasionshysterie. Trotzdem war es unheimlich. Und vor ihr tat sich ein äußerst seltsamer Anblick auf, ein Schwarm riesiger silberner Fische, die an straff gespannten Seilen in der Luft schwebten. Es waren Sperrballons; offenbar rechnete man mit Luftangriffen.
Bald sah sie eine Hafenmauer ins Meer ragen. Den Hafen selbst konnte sie jedoch nicht erreichen, weil die Küstenstraße gesperrt war. Überall wimmelte es von Uniformen. Erneut wusste sie nicht, was sie tun sollte; also bog sie landeinwärts ab und hielt Ausschau nach Auskunftsstellen und Polizisten.
Sie passierte einen freien Platz, der offenbar in ein medizinisches Triagezentrum für Flüchtlinge umfunktioniert worden war; freundliche Krankenschwestern und andere Freiwillige kümmerten sich um verwirrt dreinschauende Zivilisten. Ein Arzt im weißen Kittel saß bei einer Frau und versuchte sanft, ihr etwas wegzunehmen. Im Vorbeifahren sah Mary, dass es ein Arm war, der abgetrennte Arm eines Kindes, geschwärzt und verbrannt. Der Anblick verwirrte Mary. Sie war doch eigentlich Journalistin, zumindest zurzeit. Aber wie konnte sie über so etwas schreiben?
Vor einem unbebauten Stück Land geriet sie in einen weiteren Stau. Dies war der Ankerplatz für einen der Sperrballons. Das stahlgraue Monster, eine knapp zwanzig Meter lange, mit Wasserstoff gefüllte Hülle, stand ziemlich tief über den Dächern; man ließ es gerade aufsteigen. Es war durch dicke Stahlseile mit dem Erdboden verbunden, und ein Arbeitstrupp mühte sich ab, die auf massive Winden gewickelten Seile kontrolliert abzuspulen. Es waren zumeist Frauen in den Uniformen des ATS und der Wrens, die sich schwitzend abrackerten, außerdem ein paar WAAFs, Mitglieder der Women’s Auxiliary Air Force, des weiblichen Luftwaffenhilfskorps. Ein Offizier stand daneben und zählte unablässig, um dem Trupp an den Winden einen Rhythmus vorzugeben. Mary schaute zu, fasziniert vom Anblick des Miniaturzeppelins, der von den Straßen dieser Stadt am Meer emporstieg.
Vor ihren Augen verlor eine der WAAF-Frauen ihre Mütze, und leuchtend rotes Haar fiel offen herab. Mary glaubte zu wissen, wer die Frau war. Sie stellte den Wagen hastig ab, ohne auf die Rufe eines anderen ARP-Warts zu achten, stieg aus und lief los. »Hilda! Hilda Tanner!«
Die junge WAAF-Frau drehte sich um. Mary lief winkend auf sie zu. Die Frau sprach ein paar Worte mit dem Offizier, und er entließ sie mit einer energischen Kopfbewegung aus dem Trupp. Hilda hob ihre Mütze auf, stopfte das rote Haar darunter und eilte auf Mary zu.
Eine Woge der Erleichterung spülte über Mary hinweg. Es war nicht Gary, aber sie war ihm schon einen Schritt näher. »Hilda? Sie kennen mich nicht. Wir sind uns noch nie begegnet. Ich kenne Sie nur von den Fotos …«
Als Hilda ihren Akzent hörte, erriet sie offenkundig, wer Mary war. »Sie sind Garys Mutter.«
»Er hat von Ihnen erzählt, und wie er Sie hier kennen gelernt hat – ich saß in London fest, wissen Sie – und dann kam die Einschiffung …« Unerklärlicherweise verschwamm ihr alles vor den Augen.
Das Mädchen fasste sie an den Armen. »Na, na, immer mit der Ruhe. Kommen Sie mit und setzen Sie sich.« Sie führte Mary zu einer Bank; ein paar der Latten fehlten – vielleicht waren sie zu Feuerholz verarbeitet worden –, aber man konnte sich noch darauf niederlassen. Als Mary dort im grellen Sonnenschein saß, spürte sie, wie ihr die letzten Kräfte schwanden.
Hilda war so hübsch, wie die Fotos hatten vermuten lassen, aber mit einem langen, recht ernsten Gesicht, einer kräftigen Nase und einem entschlossenen Zug um den Mund. Sie schien kein Make-up zu tragen; dieses leuchtend rote Haar, das unter der Mütze hervorquoll, war das Farbigste an ihr. »Was machen Sie hier, Mrs. Wooler?«
»Mary. Nennen Sie mich Mary, um Himmels willen.«
»Es ist wegen Gary, nicht?« Ihre Stimme hob sich. »Ist ihm was zugestoßen? Ich habe nichts mehr von ihm gehört, seit …«
»Es gibt keine schlechten Nachrichten – nicht, dass ich wüsste.« Sie erzählte ihr, was sie im Kriegsministerium erfahren hatte.
»Und darum sind Sie hergekommen.«
»Ja. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll.«
»Dann haben Sie Glück, dass Sie mich gefunden haben«, sagte Hilda mit fester Stimme. »Wir fragen meinen Vater.«
»Ihren Vater?«
»Sie werden schon sehen.« Hilda nahm Marys Hand, stand auf und führte sie von der Strandpromenade weg und in die Stadt hinein. Unterwegs warf sie jedoch einen Blick zu dem Arbeitstrupp hinüber, der sich noch mit dem Ballon abmühte.
»Sind Sie sicher, dass Sie weg können ?«, fragte Mary.
»Ach, die kommen auch ohne mich klar. Ist aber gar nicht so einfach. Wenn der Wind umschlägt, kracht einem ein Sack voller Wasserstoff mitten in der Stadt runter. Eine Kippe, und rabamm! Natürlich könnten wir WAAFs es auch allein schaffen, aber das würden die Männer nie zugeben.« Sie drehte die offene Hand und zeigte ihr Striemen, die wie Seilbrand aussahen. »Man nennt uns ›Amazonen‹, wissen Sie. In der Zeitung.« Sie lachte völlig unbekümmert.
»Das ist wohl auch ein bisschen meine Schuld. Ich bin so eine Art Journalistin, eine Korrespondentin des Boston Traveller.«
Sie machte große Augen. »Wirklich? Gary hat gesagt, Sie seien Historikerin.«
»Von Beruf, ja. Ich … wir waren zufällig gerade hier, als der Krieg ausbrach. Da habe ich mich nach einer nützlicheren Tätigkeit umgesehen.«
»Genauso wie Gary.«
»Um die Wahrheit zu sagen, ich habe versucht, ihn davon abzuhalten, Soldat zu werden. Amerika ist schließlich nicht an diesem Krieg beteiligt.«
»Wünschten Sie jetzt, Sie hätten sich mehr Mühe gegeben?«
»Nein.« Mary überlegte. »Nein, ich bin stolz auf ihn. Er hat getan, was er für richtig hielt.«
Hilda nickte. »Schauen Sie, da ist mein Dad.«
Wie sich herausstellte, war ihr Vater Polizist, ein Constable in Uniform. An diesem Tag war er, die Gasmaske über der Schulter, beim Rathaus eingesetzt. Diverse Uniformierte eilten hinein und heraus; das Gebäude diente offenbar als eine Art Auskunftsstelle für die Evakuierungsoperation.
»Dad!« Hilda lief die letzten paar Schritte auf ihn zu und schmiegte sich, plötzlich ganz mädchenhaft, kurz in seine uniformierten Arme.
»Hallo, Liebes.« Der Vater nahm seinen schweren Bobby-Helm ab, und Mary sah ein kantiges Gesicht mit tiefen Falten und kurz geschnittene, mit Pomade geglättete, ergrauende Haare. Er musste Ende vierzig sein. Mary glaubte, etwas von seiner Tochter in ihm wiederzuerkennen; er musste einmal ein gut aussehender Mann gewesen sein. »Was ist denn los? Hast du deinen Spielzeugballon verloren?«
»Es ist wegen Gary. Er ist wieder da, Dad …«
»Vielleicht«, warf Mary ein.
Der Vater musterte sie, überrascht von ihrem Akzent. »Und Sie sind?«
Hilda stellte sie rasch vor.
Der Vater schüttelte ihr die Hand; sein Griff war warm, fest und sicher. »Nennen Sie mich George.«
»Mary.«
»Ich habe wenig genug von Ihrem Sohn gesehen, bevor er eingeschifft worden ist. Aber er ist weggegangen, um für eine gute Sache zu kämpfen. Und jetzt ist er wieder da, sagen Sie?«
»Möglicherweise. Ich weiß eigentlich nur, dass Teile seiner Division zurückgebracht worden sein sollen. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ihn finden könnte.«
George Tanner rieb sich das Kinn. »Die Evakuierung ist schon seit sechs Tagen im Gange. Überall in der Stadt sind zusammengeschossene Soldaten – ich möchte Sie nicht erschrecken, Mary –, wenn auch viel zu wenige. Da drüben ist es nicht gut gelaufen. Hören Sie, ich habe meine eigenen Kontakte. Warten Sie hier. Ich springe rasch mal rein.« Er klemmte sich den Helm unter den Arm und verschwand im Rathaus.
Jetzt, wo ihr Vater fort war, fragte Hilda besorgt: »Alles in Ordnung mit Ihnen? Möchten Sie eine Tasse Tee?«
»Später vielleicht«, sagte Mary. »Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe, Hilda. Ohne Sie hätte ich nicht gewusst, was ich tun sollte.«
»Irgendwer hätte Ihnen schon geholfen. So sind die Leute nun mal. Außerdem haben wir noch gar nichts getan.« Sie blickte zur Rathaustür. »Nun mach schon, Dad.«
George kam aus dem Gebäude geeilt und zurrte hastig seinen Helm auf dem Kopf fest. Er hielt einen Zettel in der Hand. »Wir müssen zum Krankenhaus. Dort entlang.« Er zeigte in die Richtung. »Ist nur ein guter halber Kilometer. Ich könnte einen Wagen besorgen, aber zu Fuß sind wir eher da.« Er betrachtete Mary unsicher. »Schaffen Sie das?«
»Ich bin zäher, als ich aussehe.«
Hilda ging mit schnellen Schritten voran.
»Sie haben ihn also gefunden«, sagte Mary vorsichtig.
»Ja, es gibt einen Eintrag im Register«, antwortete George mit der typischen Zurückhaltung eines Polizisten, wie es schien. »Die haben da drin alles voll im Griff, diese ATS-Ladys, wirklich erstaunlich. Jeder einzelne Soldat ist erfasst, überprüft, in eine Kartei aufgenommen und in ein Verzeichnis eingetragen. Wenn die Generäle in Frankreich nur auch so gute Arbeit geleistet hätten!«
In ihre Erleichterung, dass Gary hier war, dass er den Trichter der Evakuierung überwunden hatte, mischte sich ein Anflug von Furcht. »Aber er ist im Krankenhaus, sagen Sie.«
»Zu Beginn der Evakuierung haben sie alle Krankenhäuser geräumt, die bereit waren, die Verwundeten aufzunehmen. Sie haben auch ein paar Lazaratte in Schulen eingerichtet. Wie sich rausgestellt hat, sind aber viel weniger zurückgekommen als geplant. Ja, er ist im Krankenhaus, aber Sie dürfen da nichts hineinlesen«, sagte er behutsam. »Da heißt es: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es geht nicht um medizinische Notwendigkeiten.«
»Das werden wir bald genug erfahren«, sagte Hilda und beschleunigte ihre Schritte noch mehr.
»Hinterher kümmern wir uns um Sie«, sagte George. »Wir besorgen Ihnen eine Unterkunft. Sie können bei uns bleiben, wenn Sie möchten. Wir sind nur zu zweit, Hilda und ich. Meine Frau ist vor zwölf Jahren gestorben.«
»Das tut mir leid.«
»Ist schon lange her. Hören Sie, müssen Sie vielleicht jemanden anrufen? Wir haben kein eigenes Telefon, und die öffentlichen Leitungen sind gesperrt – na, das wissen Sie ja –, aber wenn Sie einen Anruf machen wollen, nehme ich Sie mit aufs Revier. Haben Sie einen Mann – Garys Vater?«
»Wir sind leider geschieden, George. Aber ja, irgendwann muss ich mit ihm sprechen. Kommt drauf an … Sie wissen schon.«
»Keine Sorge, wir helfen Ihnen.«
»Sie sind wirklich sehr nett.«
III
Am Eingang des Krankenhauses fuhr ein Krankenwagen nach dem anderen vor, und ein steter Strom von Gruppen mit Tragbahren ergoss sich ins Innere. Krankenschwestern huschten hektisch umher, und es schien auch ein Arzt da zu sein, der jeden Neuankömmling begrüßte. Grüne Armeedecken wurden über die Tragen gebreitet. Das Personal wirkte abgespannt, und die weißen Kittel der Ärzte waren beunruhigenderweise mit altem Blut befleckt.
An der Anmeldung gleich hinter dem Eingang tat eine etwa sechzig Jahre alte ATS-Freiwillige mit einem Helm stahlgrauer Haare ihr Bestes, alle nicht unbedingt notwendigen Besucher abzuwimmeln. Aber George, der Polizist, groß, schroff und Respekt einflößend, überwand diese Hürde mühelos. Weiter drinnen fanden sie einen Auskunftsschalter mit einer Wren, die ihnen sagen konnte, auf welcher Station Gary lag. Im Krankenhaus herrschte reger Betrieb, überall waren Soldaten mit schmutzigen Uniformen und Verbänden. Trotzdem standen viele Mitarbeiter und Freiwillige mit Armbändern in der Gegend herum, schauten mürrisch drein und hatten nichts zu tun.
Ein schrecklicher Geruch hing in der Luft, ein schwerer Eisengestank. George sah Marys Reaktion und fasste sie und Hilda am Arm. »Das ist getrocknetes Blut. Den kenne ich noch vom letzten Mal, vom ersten Krieg. Die Männer kommen mit alten – manchmal mehrere Tage alten – Verletzungen hierher. Den Geruch vergisst man nie. Aber man muss ihn einfach beiseite schieben und weitermachen. In Ordnung?«
Sie nickten beide und gingen weiter. Mary wusste, dass Gary in der Nähe war, irgendwo in diesem überfüllten, betriebsamen Gebäude, und darum kamen ihr diese letzten Augenblicke, dieser Gang durch die Flure mit ihren glänzenden Böden endlos vor, als dehne sich die Zeit.
Schließlich gelangten sie zur Station dreiundzwanzig. Zwei Bettreihen standen vor einem großen Schiebefenster, das man weit aufgerissen hatte, um das Licht und die Luft des Gartens hereinzulassen. In sämtlichen Betten lagen reglose, blessierte Körper. Mary konnte den Anblick ihrer Gesichter nicht ertragen. Sie marschierte weiter und schaute dabei auf die Namen auf den Krankenblättern, die an den eisernen Bettgestellen befestigt waren.
Und da stand sein Name, WOOLER, GARY P., mit seiner Dienstnummer beim britischen Militär. Er lag unter einer dicken weißen Decke auf dem Rücken, die Augen geschlossen. Ein magerer junger Mann mit dickem schwarzem Haar, der einen weißen Kittel trug, saß auf einem harten Stuhl an seinem Bett und beäugte die drei Besucher.
Gary schien zu schlafen. Sein Gesicht war sauber, obwohl Mary ein paar blaue Flecken sah, aber seine blonden Haare auf dem Kissen waren verfilzt und schmutzig. Neben ihm stand ein Tropf; ein durchsichtiger Schlauch schlängelte sich in eine Ader an seinem Arm, ein kleiner Verband verbarg die Nadel. Mary war ungeheuer erleichtert, dass er auf den ersten Blick ganz aussah: zwei Arme, zwei Beine, kein grässlicher, an seinen Körper geschnallter medizinischer Apparat.
Aber Hilda weinte mit gewaltigen, lautlos wogenden Schluchzern. Mary spürte, wie auch ihr die Tränen kamen. Sie begrub das Gesicht am Hals des Mädchens und roch die Stärke in ihrer Uniform.
Als sie sich voneinander lösten, wandte sich Mary an den jungen Mann auf dem Stuhl. »Pfleger?«, flüsterte sie. »Wann wacht er wieder auf? Können wir mit ihm reden?«
Der Mann stand auf. »Ich bin kein Pfleger. Nur ein Freiwilliger.« Er grinste und zeigte ihr ein Armband mit einem roten Kreuz. »Ich heiße Benjamin Kamen.«
Sowohl Hilda als auch George erstarrten, als sie seinen Akzent hörten. »Sie klingen wie ein Deutscher«, sagte Hilda erstaunt.
»Ich bin Österreicher«, sagte Kamen. »Genauer gesagt, ein österreichischer Jude. Ich bin nach England gekommen, um zu kämpfen, aber beim Militär haben sie mich nicht genommen. Plattfüße! Also mache ich stattdessen das hier.«
»Und warum sind Sie hier?«, fragte George. Seine Stimme klang immer noch misstrauisch.
»Weil ich diesen Akzent habe«, sagte Kamen schlicht. »Die Engländer fühlen sich unwohl, wenn sie ihn hören. Also versuche ich, bei den Interbrigadisten auszuhelfen. Die Hälfte von ihnen erkennt meinen Akzent gar nicht, und wenn doch, fühlen sie sich ohnehin wie Außenseiter. Und dann habe ich Gary kennen gelernt, als er hierher gebracht wurde – er hat von Ihnen gesprochen, Mrs. Wooler.« Er sah Mary an. »Ihr Name war mir bekannt. Ich habe immer Ihre Artikel im Traveller