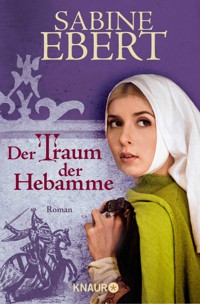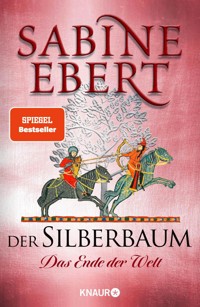9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große historische Roman der Bestseller-Autorin Sabine Ebert über eine junge Frau, die in bedrückender Zeit ihren Weg finden muss, und ein grandioses Sittengemälde aus der Zeit der Restauration. Ende 1815, Zeit der Restauration: Die junge Witwe Henriette wird nachts aus dem Schlaf gerissen und muss laut Polizeierlass binnen einer Stunde Preußen verlassen. Ihre Schilderungen des Kriegsleides und Herrscherversagens vor, während und nach der Völkerschlacht haben in allerhöchsten Kreisen Missfallen geweckt. Der Oheim Friedrich Gerlach, Verleger und Buchhändler im sächsischen Freiberg, nimmt sie auf. Doch rasch merkt sie, dass sich auch hier die Zeiten geändert haben: verschärfte Zensur, die Rückkehr zum Korsett und der gesellschaftliche Druck, sich wieder zu vermählen, setzen ihr zu. Mit der Rückkehr des wie sie traumatisierten Kriegsfreiwilligen Felix Zeidler trifft sie einen Freund und Vertrauten wieder. Doch erst nach einer drohenden Katastrophe wird ihr klar, dass er ihr mehr als nur ein Freund ist. Gemeinsam stellen sich Felix und Henriette gegen den aufziehenden Geist, in dem Bücherverbrennungen und Attentate als Heldentaten gefeiert werden. Ein großer historischer Roman, wie ihn nur eine Sabine Ebert schreiben kann - perfekt recherchiert, hochemotional und von erstaunlicher Aktualität. "Die zerbrochene Feder" knüpft lose an "1813 – Kriegsfeuer" und "1815 – Blutfrieden" an, konzentriert sich aber ganz auf die junge weibliche Hauptfigur. "Es ist mein persönlichstes Buch. Besonders das Thema Zensur hat mich beim Schreiben sehr bewegt. Obwohl der Roman vor 200 Jahren spielt, werden die Leser viele Bezüge zur jüngeren und jüngsten Vergangenheit erkennen." Sabine Ebert
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sabine Ebert
Die zerbrochene Feder
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Karte
Erster Teil
November 1815
Eine Gesellschaft im Hause Trepte
Böses Erwachen
Unterwegs
Wiedersehen
Beunruhigende Aussichten
Zurück in Freiberg
Der erste Eindruck
Neue Moden
Kundschaft
Drei Briefe aus Berlin
Ein Heiratsgesuch
Eine Abendgesellschaft im Hause Gerlach
Träume und Hoffnungen
Begegnungen in Dresden
Weihnachtszeit
Silvesterball
Zweiter Teil
Neujahrsüberraschungen
Alptraum
Maientanz
Frauen, die schreiben
Im Theater
Geheimnisvolle Angelegenheiten
Begegnungen in Erfurt
Wiedersehen in Gotha
Vergleiche
Sommerschnee
Schnelle Entscheidungen
Dritter Teil
Oktober 1817
Streit im Hause Gerlach
Am Fenster
Henriette schreibt
Unerwarteter Besuch
Reputation
Eine Warnung
Ruhelos
Der Eindringling
Rosa Elefanten
Aufatmen
Heinrich oder Hubert?
Vierter Teil
Februar 1819
Bluttat
Säuberungen
Bestürzende Geheimnisse
Die Intendantin
Verwirrspiel im Hoftheater
Epilog I
Epilog II
Nachwort
Danksagung
Dramatis Personae
Historische Persönlichkeiten sind mit * gekennzeichnet
Freiberg
Dresden
Leipzig
Erfurt
Gotha
Weimar
Berlin
Glossar
Stadtplan Freiberg
Erster Teil
Wie ein loses Blatt im Wind
November 1815
Ich weiß, was du planst«, wisperte die zierliche Carlotta ihrem Mann zu und stieß ihm energisch den Ellenbogen in die Rippen. »Sag bitte sofort, dass das nicht dein Ernst ist!«, zischte sie und starrte ihn mit gerunzelten Augenbrauen an.
Wilhelm Trepte, ein Rechtsgelehrter der Berliner Universität mit grauem Backenbart, hatte den Blick auf seine junge Schwiegertochter Henriette gerichtet, die gerade ihr Söhnchen – seinen Enkel – auf den Arm hob und an sich drückte, während Tränen in ihren Augen glitzerten.
Als Wilhelm nicht antwortete, riss ihn Carlotta mit einem erneuten Rippenstoß aus seinen Grübeleien.
Rasch zog er seine Frau in den Salon und nahm sie bei den Händen.
»Liebes, wir müssen etwas unternehmen, damit sie nicht länger in Trauer versinkt.«
Ihr Sohn Maximilian, Henriettes große Liebe, hatte wie seine beiden jüngeren Brüder sein Leben im Krieg gegen Napoleon verloren. Schwer verwundet war der preußische Premierleutnant aus Frankreich zurückgekehrt, durfte gerade noch die Geburt seines Sohnes erleben und starb nur Tage später während der Operation, bei der eine Kugel entfernt wurde, die nahe seinem Herzen steckte. Das war im Sommer des vergangenen Jahres geschehen.
»Sieh sie dir doch an!«, drängte Wilhelm seine Frau. »Sie wandert umher wie ein Geist, und wann hast du sie das letzte Mal lachen sehen? Oder auch nur lächeln? Jette muss sich wieder dem Leben zuwenden. Sie ist noch nicht einmal zwanzig! Und das Trauerjahr ist vorbei.«
»Hast du denn aufgehört, um unsere Söhne zu trauern?«, fragte Carlotta vorwurfsvoll, ohne eine Antwort zu erwarten. »Könntest du den Gedanken ertragen, dass sie mit unserem einzigen Enkel dieses Haus verlässt, um sich neu zu vermählen?«
Wilhelm Trepte seufzte leise und zog ein sauberes Schnupftuch aus der Weste, um seine Brille zu putzen – eine für ihn typische Geste, wenn er Zeit gewinnen wollte.
»Das fällt mir nicht weniger schwer als dir, Liebes«, gestand er schließlich. »Doch ist es nicht auch für das Kind das Beste, wieder einen Vater zu haben – und eine glückliche Mutter statt einer in Trauer versunkenen?«
»Sie findet Trost im Schreiben«, hielt Carlotta dagegen.
Als Sängerin wusste sie um die heilende Kraft der Kunst. Henriette besaß literarisches Talent, das hatte nicht nur ihr Oheim versichert, der im sächsischen Freiberg eine Buchhandlung mit angeschlossener Druckerei führte und Fachbücher sowie ein Wochenblatt herausgab. Der Inhaber der berühmten Nicolaischen Verlagsbuchhandlung, die im Nachbarhaus der Treptes in der Berliner Brüderstraße ihren Sitz hatte, wollte sogar ihre Manuskripte veröffentlichen.
»Kann sie ausgerechnet im Schreiben Trost finden?«, zweifelte der Jurist und ging zur Anrichte, um sich und seiner Frau ein Glas Likör einzuschenken. »Du solltest sie lieber dazu anhalten, ihr Klavierspiel zu verbessern.«
Er strich sich durchs Haar und sagte dann mit sorgenvoll gerunzelter Stirn: »Sie schreibt über ihre schrecklichen Erlebnisse in den Kriegsjahren, bei der Pflege von Verwundeten und Typhuskranken in überfüllten Lazaretten. Meinst du nicht, es wäre besser für sie, endlich loszulassen? Nach vorn zu schauen? Ins Leben zurückzukehren, statt bei den Toten zu verharren?«
Müde ließ er sich in einen Sessel sinken. Es war November; die früh hereinbrechende Dunkelheit lastete schwer auf ihren Gemütern.
»Sie will Zeugnis ablegen, als Mahnung«, beharrte Carlotta und setzte sich zu ihm auf die Sessellehne.
Dass ihr Mann jetzt schwieg, machte sie unruhig.
»Was geht gerade in dir vor?«, forschte sie, denn offensichtlich zögerte Wilhelm, seine Gedanken mit ihr zu teilen, was ungewöhnlich war. Sie vertrauten einander.
Doch der Rechtsgelehrte schien nur mit Mühe die passenden Worte zu finden.
»Genau das bereitet mir Sorge«, gestand er schließlich leise ein. »Solche Zeugnisse sind nicht mehr erwünscht. Erst recht nicht, wenn jemand so hart mit Königen ins Gericht geht, wie sie es tut. Es könnte Ärger erregen, im harmlosesten Fall Missbilligung. Wir müssen sie davon abbringen. Und deshalb sollten wir am Sonnabend eine Gesellschaft geben und ein paar junge Männer einladen. Vielleicht verliebt sie sich neu.«
Die zierliche Carlotta stand mit einem Ruck auf, stellte ihr Glas ab und stemmte die Hände in die Seiten.
»Wilhelm Trepte, ich kann nicht glauben, was ich da Ungeheuerliches von dir zu hören bekomme! Weißt du, welcher Tag heute ist? Ihr Hochzeitstag! Heute vor zwei Jahren hat sie unseren Jungen geheiratet. Sie konnten nur eine schlichte Feldhochzeit feiern, und während ihrer gesamten Ehe hatten die beiden kaum vier Wochen füreinander, bis er wieder in den Krieg ziehen musste. Und ausgerechnet heute kommst du auf die Idee, sie mit einem anderen zu verkuppeln? Henriette, die uns eine Tochter geworden ist, nachdem alle unsere Söhne tot sind?«
»Sei leise, Liebes!« Ihr Mann versuchte, das Temperament seiner italienischen Frau zu zügeln. »Was, wenn sie dich hört?«
»Mit diesem Argument gibst du selbst zu, wie schändlich und taktlos deine Gedanken sind!«, hielt sie ihm leidenschaftlich entgegen.
Wilhelm Trepte seufzte leise, nahm erneut seine Brille ab, hauchte die Gläser an, holte umständlich sein Tuch hervor und putzte sie, als seien sie nicht schon blank.
»Es bleibt dabei. Wir geben eine kleine Gesellschaft, und ich kümmere mich diesmal um die Gästeliste.«
Carlotta verdrehte die Augen. »Wie viele?«
»Ein halbes Dutzend. Nach dem Essen können wir im Salon noch in zwangloser Runde plaudern und ein wenig musizieren. Aber wir sollten es Henriette erst kurz vorher und ganz beiläufig sagen, damit sie …«
»… nicht Verdacht schöpft, dass du sie verkuppeln willst?«
»Damit sie dem Abend erst einmal keine große Bedeutung beimisst und sich nicht schon innerlich dagegen sperrt, bevor auch nur der erste Gast unser Haus betreten hat.«
»Dann sag du es ihr! Ich will mit diesem Komplott nichts zu tun haben!«, forderte Carlotta kategorisch.
Sie starrte ihren Mann so lange an, bis dieser zustimmte, dann ging sie Madame Bellefleur suchen, die Haushälterin, um mit ihr eine Speisenfolge für die Gesellschaft zusammenzustellen. An diesem Punkt, das wusste sie, konnte sie ihrem Mann seine Idee ohnehin nicht mehr ausreden. Sie fragte sich, ob Henriette wohl den Plan ihres Schwiegervaters erraten würde. Sie war klug und feinfühlig, doch so von Trauer erfüllt, dass sie das Vorhaben vielleicht erst durchschaute, wenn sie sich an der Tafel von ledigen Männern umringt sah. Obwohl …
Carlotta seufzte erneut. So viele junge Männer waren in den Kriegsjahren gefallen! Und als Witwe mit einem Kind, auch wenn sie noch keine zwanzig zählte, durfte Jette wohl eher mit dem Antrag eines älteren Herrn rechnen.
Zumindest sollte die Bewirtung der Gäste weniger Schwierigkeiten bereiten als unter der Herrschaft Napoleons, der den Handel mit England strikt verboten hatte. Die Kontinentalsperre war aufgehoben, und es gab endlich wieder Kaffee, Zucker, Vanille und andere begehrte Waren aus den britischen Kolonien.
Während Carlotta bereits mit der Köchin das Menü besprach und zustimmte, für diesen Tag noch eine Beiköchin zu engagieren, zog sich Wilhelm Trepte in die Bibliothek zurück und stellte eine Liste der Gäste zusammen, die er einladen wollte. Einen älteren Kollegen von der Universität mit seiner hochbetagten Mutter, damit Henriette nicht misstrauisch würde, und einige unvermählte Assessoren und Assistenten, denen er eine erfolgreiche Laufbahn zutraute.
Die Vorbereitung für die gesellige Zusammenkunft nahm im Haus der Treptes ihren Lauf, ohne dass Henriette davon erfuhr – so hatte es sich ihr Schwiegervater ausbedungen.
Erst einen Tag vor dem Ereignis hielt Wilhelm Trepte den Moment für gekommen, ihr davon zu erzählen. Er wartete in der Bibliothek auf sie, die sie gewöhnlich aufsuchte, wenn ihr Söhnchen eingeschlafen war.
Als er ihre leichten Schritte nahen hörte, hielt er mit dem Schreiben inne.
Henriette trat ein und verharrte kurz, als sie ihn erblickte. Das hellbraune Haar hatte sie zu einem einfachen Knoten hochgesteckt, und unter dem Arm trug sie zwei Bücher.
»Störe ich?«, fragte sie zaghaft, schon auf dem Sprung, gleich wieder zu gehen, falls es so war.
»Komm nur herein, meine Liebe, und such dir neuen Lesestoff aus!«, schlug Wilhelm mit einladender Geste vor.
»Max ist gerade erst eingeschlafen«, erzählte die zarte junge Frau, während sie die Bücher wieder an ihrem Platz einsortierte. Dann suchte sie die hohen Regalreihen nach weiterer Lektüre ab.
»Wir werden morgen eine zwanglose kleine Gesellschaft geben«, erklärte er beiläufig und beobachtete sie genau. »Nicht ganz die übliche Runde, sondern hauptsächlich Kollegen von der Universität und Männer, mit denen ich geschäftlich in Verbindung stehe. Die meisten von ihnen wirst du noch nicht kennen. Aber es ist wichtig für mich, dass wir sie hier bei uns empfangen.«
Henriette verzog keine Miene, sondern wartete, dass er weitersprach. Sie schien keinen Verdacht zu schöpfen. Die Treptes führten ein gastliches Haus. Wilhelm war an der Universität geschätzt und Carlotta als talentierte Sängerin beliebt.
Also wagte er sich ein Stück weiter vor.
»Ich würde dich gern einmal wieder in dem hellblauen Kleid mit der fliederfarbenen Spitze sehen, das du trugst, als wir den großen Iffland in seiner letzten Theatervorstellung erlebten.«
Verwundert sah sie ihn an. Bis eben hätte sie nie vermutet, dass sich ihr Schwiegervater Gedanken darüber machte, was sie anzog. Ihr selbst war es ziemlich gleichgültig, seit Maximilian gestorben war. Sie war nur müde, so furchtbar müde, und wenn nicht ihr kleiner Sohn und die Verpflichtungen gegenüber den Schwiegereltern wären, würde sie vollends im Dunkel umhertreiben.
Nun sollte sie also auf einem häuslichen Fest brillieren. Nach nichts stand ihr der Sinn weniger. Doch da diese Zusammenkunft Maximilians Vater wichtig zu sein schien, würde sie natürlich seinem Wunsch nachkommen.
»Und steck ein paar Blüten ins Haar, Liebes. Ich wünsche mir sehr, dass du dich endlich wieder ein wenig herausputzen lässt. Du bist noch jung und solltest das Leben genießen.«
Während der Gelehrte fürchtete, Henriette könnte seine Absicht erraten, stieg in ihr ein ganz anderer, beunruhigender Verdacht auf.
»Falle ich euch zur Last?«, fragte sie, biss sich auf die Lippe und musterte ihn beklommen.
Die Treptes hatten sie vor zwei Jahren aufgenommen, ohne sie zu kennen, nachdem ihr ältester Sohn sie überraschend in Frankfurt geheiratet hatte. Und seit Maximilians Tod war nun schon über ein Jahr vergangen.
Bestürzt legte Wilhelm Trepte die Feder hin, ging auf sie zu und nahm ihre Hände. »Das darfst du nie denken!«, versicherte er ihr. »Du warst uns vom ersten Tag an willkommen, das weißt du doch. Ich möchte dich nur wieder lächeln sehen.«
Wortlos nickte sie, während ihre Kehle wie zugeschnürt war.
Dieses Kleid, von dem er sprach – ein Hochzeitsgeschenk von Oheim und Tante aus Freiberg –, hatte sie seit Maximilians Tod nicht mehr getragen. Sie musste erst einmal mit Änni, dem Hausmädchen, nachsehen, ob es noch passte und ob vielleicht etwas daran ausgebessert werden musste.
Bevor sie ging, gab ihr Wilhelm Trepte mit auf den Weg: »Vielleicht übst du bis dahin noch ein wenig auf dem Klavier? Carlotta möchte morgen etwas singen, und du könntest sie begleiten.«
Insgeheim gratulierte er sich dazu, dem Ganzen einen so beiläufigen Anstrich gegeben zu haben.
Wieder nickte Henriette mit erstarrter Miene. Natürlich durfte sie ihren Schwiegereltern diesen Wunsch nicht abschlagen. Doch das Klavier musste warten. Erst einmal hatte sie für morgen etwas anderes vor, etwas Wichtiges. Das Einzige außer ihrem Kind, was sie aus der Apathie riss, die sie seit dem Tod ihrer großen Liebe lähmte.
»Seien Sie willkommen!«
Überschwänglich stemmte sich Monsieur Parthey, der Inhaber von Berlins berühmtester Verlagsbuchhandlung, aus dem Stuhl hinter seinem Schreibtisch und ging mit ausgebreiteten Armen auf Henriette zu. »Kommen Sie in den Salon, meine Liebe, ich werde Sie doch nicht im Komptoir empfangen! Wie geht es meinem Patensohn?«
»Gut, Monsieur«, berichtete Henriette, und dies war einer der wenigen Momente, in denen sie lächelte. »Er läuft schon munter drauflos und will schneller sein, als ihn seine Beinchen tragen. Und er redet den ganzen Tag, wobei oft sehr lustige Wortschöpfungen herauskommen.«
Mit einem Arm wies ihr der siebzigjährige Daniel Friedrich Parthey den Weg zum Salon und orderte beim Hausmädchen Mokka für sich und seine Besucherin.
Der Mokka wurde in zwei goldgeränderten kobaltblauen Tassen aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin serviert. Dazu trug das Mädchen eine Kristallschale voller Mürbeplätzchen auf dem Tablett herein.
Nach einem Moment andächtigen Schweigens, in dem Monsieur Parthey genüsslich den Kaffeeduft einsog, nahm Henriette allen Mut zusammen, um die Frage auszusprechen, die ihr auf der Seele lag.
»Haben Sie etwas darüber gehört, wann mein Buch erscheinen darf? Sind die Seiten schon vom Zensor zurück?«
Umständlich löffelte der Verleger Zucker in seinen Mokka und schien ganz auf diese Tätigkeit konzentriert.
»Nein, sie befinden sich noch dort«, antwortete er nach bedeutungsschwerem Schweigen. »Und zu meinem Leidwesen kann ich die Prüfprozedur nicht beschleunigen, obwohl sie ungewöhnlich lange dauert.«
»Müssen wir uns deshalb sorgen?« Beunruhigt beugte sich Henriette ein wenig vor. »Vielleicht liegt es nur daran, dass einer der Zensoren erkrankt ist. Bei diesem nasskalten Novemberwetter wäre das kein Wunder.«
Der weißhaarige Verleger war nun auffallend intensiv damit beschäftigt, den Mokka mit seinem silbernen Löffelchen umzurühren; er schien wie gebannt von dem dunklen Strudel und dem leisen Klirren.
Da er aber spürte, dass sich seine junge Besucherin ohne klare Antwort nicht zufriedengeben würde, riss er schließlich den Blick widerstrebend von dem Gebräu los und sah sie an.
»Wenn etwas lange beim Zensor liegt, ist das nie ein gutes Zeichen, meine junge Freundin«, eröffnete er und seufzte. »Ihr Werk ist ungewöhnlich, aufrüttelnd und bewegend. Sehr einfühlsam geschrieben, trotzdem schlicht und klar.«
Ungewohnte Verlegenheit zeichnete sich nun auf seinem Gesicht ab.
»Genau das ist das Problem, wie sich nun herausstellt. Sie schreiben vom Krieg, von Ihren erschütternden Erlebnissen in den Lazaretten vor, während und nach der Leipziger Völkerschlacht. Ich halte Sie für ein großes Talent und möchte Sie fördern. Und ich gebe zu, Sie haben mich alten Mann zutiefst berührt. Ich war, nein: Ich bin sicher, Sie würden jeden Leser bewegen.«
»Würden?«, fragte Henriette mit hochgezogenen Augenbrauen.
Parthey stellte seine Tasse auf dem Tischchen ab, das mit Intarsien aus Perlmutt verziert war, und lehnte sich in seinem Sessel zurück.
»Nun … Ich habe mir erlaubt, dezent beim Sekretär der Zensurbehörde nachzufragen. Und bekam in etwa zu hören, was ich schon befürchtete, nachdem die Genehmigung des Textes so lange ausblieb.«
Verlegenheit stand auf seinem Gesicht geschrieben.
Jette, die ahnte, worauf das Gespräch jetzt hinauslaufen würde, stellte ebenfalls ihre Tasse auf dem Tischchen ab, denn ihre Hände begannen zu zittern. Vor Entrüstung.
»Als Seine Majestät der König sein Volk zum Kampf gegen Napoleon aufrief, da erfasste eine patriotische Welle das Land, weit über Preußen hinaus«, holte Parthey weitschweifig aus. »Selbst aus Nachbarländern wie Sachsen oder Anhalt meldeten sich Freiwillige zur Armee. Damen verkauften ihren Goldschmuck, damit die Truppen bewaffnet werden konnten.«
Bei weitem nicht so viele, wie der preußische König gehofft hatte, dachte Henriette sarkastisch, hielt diese Bemerkung aber zurück.
»Nun ist der Sieg errungen, auf dem großen Kongress in Wien wurde Frieden geschaffen …«, fuhr der Verleger fort, und in Gedanken kommentierte Henriette sofort: auf Kosten Polens und Sachsens, das zur Hälfte als Beute an Preußen ging!
»Deshalb wünscht man sich in allerhöchsten Kreisen …« – Monsieur Partheys Blick wanderte bedeutungsvoll zu dem goldgerahmten Porträt Friedrich Wilhelms III. an der Wand – »… dass nun nicht mehr von solch schrecklichen Dingen die Rede ist, wie Sie sie beschreiben. Die Besetzung Preußens durch Napoleon und der Krieg sind vorbei. Jetzt sind Zuversicht und Unterhaltung erwünscht.«
Parthey räusperte sich sichtlich verlegen.
»Man hat mir bedeutet, eine junge Frau wie Sie sollte doch, wenn sie schon meint, schreiben zu müssen, etwas Nettes zu Papier bringen.«
Henriette hatte das unwirkliche Gefühl, dass sich ihr die Haare sträubten, obwohl sie fest zum Knoten aufgesteckt waren.
»Aha«, sagte sie nur und hielt mit Mühe alle Erwiderungen zurück, die ihr auf der Zunge lagen. Denn sie spürte genau, dass der Verleger das Entscheidende noch nicht gesagt hatte.
Damit rückte er nun heraus, zögernd und mit gesenkter Stimme.
»Zumal …« – unter seinen buschigen Augenbrauen sah er Henriette beschwörend an – »… Sie sich unverhohlen kritisch über den König von Preußen und den König von Sachsen äußern.«
»Friedrich Wilhelm von Preußen hatte dem Volk Reformen und eine Ständeverfassung versprochen«, erinnerte sie leidenschaftlich. »Davon ist plötzlich keine Rede mehr. Doch ich verstehe natürlich, dass es einem König den Schlaf raubt, wenn er sein Volk bewaffnet, und er jede Erinnerung daran tilgen will.«
Nun beugte sie sich ein wenig vor, strich mit den Fingern über die Perlmuttintarsien des Tisches, ohne es wahrzunehmen. »Eine Kritik am König von Sachsen sollte doch beim preußischen Regenten Beifall finden, nachdem beide Herrscher in den letzten Kriegsjahren auf gegnerischen Seiten standen, nicht wahr?«
Monsieur Parthey hüstelte, sein Blick wanderte erneut zu dem goldgerahmten Porträt des preußischen Königs. Solche Drucke hatte auch ihr Oheim in Freiberg verkauft – jedenfalls so lange, wie das preußische Heer im Land weilte, und später noch einmal, während Sachsen unter preußischer Verwaltung stand. Je nach politischer Lage hatte Friedrich Gerlach auch Porträts Napoleons oder des russischen Zaren im Angebot. Die des sächsischen Königs Friedrich August natürlich ständig.
»Ich erhielt einen Fingerzeig der Zensurbehörde, dass herabwürdigende Äußerungen über Angehörige von Königshäusern generell als unangemessen betrachtet werden«, bekannte der Verleger.
»Aha«, wiederholte Henriette kühl. »Soll ich also die betreffenden Abschnitte entfernen?«
Parthey schloss die Augen und wirkte tief in Gedanken versunken, ehe er weitersprach. Schließlich öffnete er die Lider und blickte Henriette ins Gesicht.
»Ich fürchte, das wird nicht genügen, meine Liebe«, sagte er besorgt. »Sie haben in allerhöchsten Kreisen Missfallen erregt. So leid es mir tut um Sie und Ihr Buch – darf ich Ihnen noch einen dringenden Rat geben: Sie sollten sich umgehend davon distanzieren und zum Zeichen guten Willens etwas Gefälliges schreiben. Etwas Nettes. Lauschige Naturbetrachtungen oder die romantische Liebesgeschichte eines patriotisch gesinnten Paares.«
Henriette schwieg kurz, ehe sie sich erhob.
»Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Monsieur Parthey«, sagte sie. »Und ich betrachte Sie nach wie vor als Freund. Doch Sie werden von mir nicht ernsthaft erwarten, dass ich über Schmetterlinge und Frühlingsdüfte schreibe – nach all dem, was ich gesehen und erlebt habe. Das, was ich Ihnen anvertraute, ist eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte über Nächstenliebe. Nur scheint meine Auffassung von Patriotismus nicht mehr zeitgemäß zu sein.«
Parthey erhob sich ebenfalls.
»Ziehen Sie es wenigstens in Betracht!«, beschwor er sie leise.
Besorgt sah er ihr nach, als sie sich in den Mantel helfen ließ und zur Tür ging.
Eine Gesellschaft im Hause Trepte
Schneidend kalter Wind trieb Henriette winzige Eiskörner ins Gesicht, als sie aus dem Haus des Verlegers trat. Rasch drückte sie ihren Hut fester aufs Haar und band die Satinschleife enger, die ihn hielt.
Mit nur wenigen Schritten zur benachbarten Tür hätte sie Kälte, Wind und Hagel entkommen können. Aber sie fühlte sich jetzt nicht imstande, gleich wieder ins Haus ihrer Schwiegereltern zurückzukehren – mit ihrem Zorn, ihrer Enttäuschung und dem Wissen, dass Wilhelm und Carlotta sich große Sorgen machen würden, wenn sie erfuhren, was Monsieur Parthey berichtet hatte. Gefährdete sie vielleicht sogar die Stellung ihres Schwiegervaters an der Berliner Universität, wenn sie nicht klein beigab und den Zensoren zum Zeichen vermeintlicher Läuterung eine »nette Geschichte« lieferte?
Gedankenschwer ging sie bis zur nächsten Spreebrücke, klammerte sich mit beiden Händen am Geländer fest und reckte ihr Gesicht den feinen Graupeln entgegen, als könnte die Kälte auch den Aufruhr in ihrem Innern abkühlen. Der Wind zerrte an den Schößen ihres Mantels und an ihrem Hut, den sie nun doch lieber mit einer Hand festhielt.
Die Gegend um die Brücke war fast menschenleer, nur in einigem Abstand sah sie einen Schusterjungen mit tief ins Gesicht gezogener Mütze und einem Paar Stiefel, die über seiner Schulter hingen; er lieferte wohl für seinen Meister die fertige Ware aus. Auf der gegenüberliegenden Seite des Spreekanals watschelte eine in dicke Wolltücher gehüllte Frau mit einem Korb Kartoffeln. Zwei Möwen stritten laut kreischend um irgendetwas Essbares.
Im fauchenden Wind verharrend, haderte Henriette mit dem soeben Gehörten. Nicht nur, dass sie »etwas Nettes« schreiben sollte, womit gemeint war: völlig ohne Belang. Man hatte ihr auch ausrichten lassen, dass es gänzlich unangemessen sei, wenn sich Frauen – noch dazu junge – anmaßten, Bücher zu schreiben.
Nach dem Krieg und all den Entbehrungen und Verlusten würden die Menschen Vergnügen und Zerstreuung brauchen. Sicher, Hoffnung und endlich wieder einziehende Normalität brauchten sie auch, das war verständlich …
Doch wie konnte die Menschheit nach einer solchen Katastrophe weiterleben, nach einem Krieg, der mehr als einen ganzen Kontinent erfasst und Millionen Tote gekostet hatte, wenn jedermann so tat, als habe das alles nie stattgefunden?
Damit würde sie Maximilian verraten und all jene, die in diesen furchtbaren Jahren ihr Leben gelassen hatten. Nicht nur die Soldaten, sondern auch die zahllosen Zivilisten, die große Not litten, die ausgeplündert worden waren und ihre Häuser und ihre Habe verloren hatten, die hungerten und vom Typhus hinweggerafft wurden, den die erschöpften Heere mit sich brachten.
Rasch wurden Henriettes Finger klamm vor Kälte, an ihren Haaren und Wimpern setzten sich winzige Eiskristalle fest.
Doch ehe sie sich in die Wärme des Hauses flüchtete, musste sie ihren Gedankengang zu Ende bringen.
Und dazu gehörte der Entschluss, den Schwiegereltern vorerst nichts davon zu sagen, was Monsieur Parthey ihr gestanden hatte. Sie wollte nicht, dass sie sich sorgten. Vielleicht verlief diese unleidige Angelegenheit im Sande, weil die Zensoren eine junge Frau und Mutter nicht ernst nahmen und bald vergaßen? Sollte sie nicht besser doch schleunigst ihre literarischen Ambitionen aufgeben, stattdessen Klavier spielen und sticken, wie es die Treptes vorgeschlagen hatten? Um Unheil von ihren Schwiegereltern und auch dem Verleger fernzuhalten?
Henriette wandte den Blick von dem träge dahinfließenden Spreekanal, in dem die Überreste einer Holzkiste und ein angebissener Apfel schwammen, und lief zurück zum Haus der Treptes. Sie würde sich in ihr Zimmer zurückziehen und in Ruhe noch einmal über Monsieur Partheys Worte nachdenken.
Doch dazu sollte sie keine Gelegenheit finden.
Carlotta hielt schon am Fenster nach ihr Ausschau und bedeutete ihr mit energischem Winken, sich zu beeilen.
Sie empfing sie gleich an der Tür, zog sie herein und überschüttete sie mit Vorwürfen.
»Wo bleibst du denn, noch dazu bei diesem Wetter? Deine Hände sind ja eiskalt! Und dein Haar ist nass und zerzaust! Um Himmels willen, wie sollen wir dich präsentabel herrichten, bevor die Gäste kommen? In weniger als zwei Stunden treffen sie hier ein!«
Mit einer Spur von Verlegenheit wegen ihrer Unaufrichtigkeit murmelte sie noch: »Du weißt doch, wie wichtig diese Gesellschaft für Wilhelm ist …«
Sie schob Jette in deren Zimmer und rief nach Änni, damit die der jungen Frau in Mieder und Kleid half und die Brennschere erhitzte. Um den Haarschmuck würde sich Carlotta selbst kümmern, die bereits umgekleidet und fast fertig frisiert war.
Henriettes bestes Kleid, zartblau mit fliederfarbenen Spitzen, war sorgfältig gebügelt über das Bett drapiert. Lange weiße Handschuhe, Strümpfe und ihr Silberschmuck mit Amethysten – ein Geschenk von Oheim und Tante in Freiberg, der Familienschmuck der Gerlachs – lagen auf dem Frisiertisch bereit.
Teilnahmslos und schweigend ließ Henriette Carlottas und Ännis Wortschwall über sich ergehen, während ihr das Dienstmädchen die Haare trockenrieb, sie in das Mieder schnürte und ihr in das Festkleid half. Es war aussichtslos, jetzt über ihr Gespräch mit Monsieur Parthey nachdenken zu wollen, während die zwei Frauen geschäftig und höchst gesprächig um sie herumschwirrten.
Henriette schien es, als würde sie in eine andere Welt gezogen, weg von den dramatischen Ereignissen, über die sie geschrieben hatte, und stattdessen angefüllt mit Banalitäten: ob die Brennschere heiß genug war, um Locken zu drehen, wo die Haarnadeln lagen, ob die seidenen Blüten fest genug im Haar saßen …
Sollte sich ihr Leben künftig nur darum drehen?
Nachdem sie draußen so durchgefroren war, wirkten die Wärme des Zimmers und das unablässige Geplapper der beiden Frauen einschläfernd auf sie, zumal sie ohnehin seit Maximilians Tod von andauernder Müdigkeit erfüllt war. Ihre Gedanken verloren sich im Nichts, während verlockende Düfte durch das Haus zogen, von Gebratenem und Gebackenem.
»Nun lass dich anschauen, Liebes!«, meinte Carlotta schließlich, zog sie hoch, drehte sie an den Schultern zu sich und musterte mit leicht zusammengekniffenen Augen das Ergebnis ihrer Mühen.
»So wird es gehen«, meinte sie zufrieden, zupfte da und dort noch an einer Locke und fuhr zusammen, als unten am Hauseingang die Glocke schellte.
»Sie kommen! Warte im Salon, dort werden wir dich den Gästen vorstellen.«
Henriette nickte und stellte sich gedanklich auf ein paar Stunden höflicher Konversation mit vermutlich grauhaarigen Kollegen ihres Schwiegervaters ein. Doch ihm zuliebe würde sie sich von ihrer besten Seite zeigen. Aufmerksam und Interesse vortäuschend, auch wenn in ihrem Inneren alles erstorben war.
Zwei Stunden später, während die Treptes und ihre Gäste das Dessert löffelten, ein köstliches Zitronenparfait, fragte sich Henriette längst, was sie hier sollte. Sie wünschte sich fort von dieser zunehmend lärmenden Runde, an einen stillen Ort. Vorzugsweise in ihr Bett, wo sie sich zwischen Kissen und Decken verkriechen und nichts sehen und nichts hören wollte.
Die Gäste ihres Schwiegervaters mochten wohl in der Rechtskunde hervorragend bewandert sein und erörterten schon seit der Vorspeise diverse juristische Neuerungen und Streitfälle. Doch taten sie sich schwer, einen Gegenstand allgemeinen Interesses zum Thema einer Konversation zu machen.
Carlotta warf ihrem Mann deshalb in unbeobachteten Momenten immer wieder vorwurfsvolle Blicke zu – weil sie sich genau so langweilte wie sie selbst, glaubte Henriette. Ihr wäre nie der Gedanke gekommen, die Schwiegermutter wollte damit die offenkundige Fehleinschätzung ihres Mannes rügen, was potenzielle Ehekandidaten für eine intelligente junge Witwe betraf.
Wilhelm funkelte in diesen Momenten zurück, um Carlotta an seine Argumente zu erinnern: Jeder dieser Männer hatte ein gutes Einkommen und eine gehobene Position im Staatsdienst in Aussicht, was Henriette Schutz und Sicherheit bieten würde.
Als Gäste waren ein wortgewaltiger älterer Anwalt mit seiner hochbetagten Mutter erschienen, eine Matrone mit schrillem Kichern und hochaufgetürmten grauen Locken, auf denen eine Spitzenschleife prangte, sowie vier junge Männer, denen ihr Schwiegervater wohl eine verheißungsvolle Laufbahn an der Universität voraussagte.
In Freiberg, das wusste Henriette aus den Erzählungen ihrer dort lebenden Verwandten, war es auch üblich, dass Gelehrte der Königlich-Sächsischen Bergakademie ihre Studenten und Assistenten zu Tisch luden, um den fachlichen Austausch und den Gemeinschaftssinn zu fördern.
Wenn diese Gesellschaft ihren Schwiegereltern so wichtig war, sollte sie sich wohl zusammenreißen und den Konventionen Genüge tun.
Also saß sie seit zwei Stunden an diesem Tisch, nickte immer wieder mal nach links oder rechts, als verfolge sie das Gespräch, zeigte dann und wann das freundlichste Lächeln, das sie aufbieten konnte, und warf gelegentlich ein »Ach, wirklich?« oder »Was Sie nicht sagen!« in die Runde, um Interesse vorzutäuschen, während sie in Wahrheit immer apathischer wurde und ihr Gesicht zur Maske erstarrte.
Anfangs hatten die Männer sie mit teils routinierten, teils unbeholfenen Komplimenten über ihr Aussehen, ihr Kleid und ihren Haarschmuck überhäuft. Doch seit sie bei Tisch saßen, war nur noch von Dingen die Rede, die an Henriette vorbeirauschten.
»Können die jungen Burschen denn über gar nichts anderes reden als über die Juristerei?«, beschwerte sich schließlich die alte Madame Stieglitz, nachdem sie ihr Dessertschälchen bis auf den kleinsten Rest ausgekratzt hatte. »Wo wir doch die charmante Gastgeberin und ihre bildhübsche Schwiegertochter am Tisch haben, die sich vermutlich über all eurer Paragraphenreiterei tödlich langweilen!«
Vorwurfsvoll sah sie in die Runde.
»Madame, ich denke, ich spreche im Namen meiner Kollegen, wenn ich mich schuldig bekenne«, räumte der junge Mann mit den vorstehenden Zähnen namens Isidor ein, der rechts von Henriette saß und sich ihr nun zuwandte.
»Verzeihen Sie mir, teure Henriette; wir sind Ihnen und unserer verehrten Gastgeberin mehr Aufmerksamkeit schuldig. Wie schrieb schließlich schon Schiller? Ehret die Frauen! Sie stricken und weben himmlische Rosen ins irdische Leben.«
Henriette starrte ihn irritiert an, sah dann zu Carlotta, deren Mundwinkel zuckten, als wollte sie gleich in schallendes Gelächter ausbrechen, und riss sich zusammen, um ebenfalls nicht loszuprusten.
Betont liebenswürdig neigte sie den Kopf ihrem Tischnachbarn etwas entgegen und korrigierte sanft: »Sie flechten und weben … Schiller hat dabei gewiss keine Handarbeitskränzchen vor Augen gehabt. Er meinte das sinnbildlich.«
Isidor stutzte.
»Sinnbildlich? Sind Sie da sicher?«
Carlotta griff nach der Serviette – vorgeblich, um sich den Mund abzutupfen, in Wahrheit aber, um ihr Lachen zu verbergen.
»Ich bin mir vollkommen sicher«, beteuerte Henriette und dachte bei sich: Das halte ich keine Minute länger aus.
Wilhelm Trepte schien ihre Gedanken zu erraten und beschloss, dieser peinlichen Szene und der zunehmenden Langeweile bei Tisch ein Ende zu bereiten, ehe die Frauen seiner Familie den Gast noch lauthals auslachten.
Schwungvoll legte er seine Serviette beiseite und schlug vor: »Begeben wir uns doch hinüber in den Salon, um dort den Kaffee zu nehmen. Vielleicht könnten wir auch ein wenig musizieren.«
Erleichtert ließen sich die Damen von den Stühlen helfen und gingen ins Nachbarzimmer; Henriette und Carlotta nebeneinander und verständnisinnige Blicke tauschend.
»Ich habe Noten mitgebracht, Auszüge aus den neuesten Kompositionen Beethovens, sie sind gerade erst erschienen«, eröffnete ein weiterer junger Mann im Salon, blass und bisher nicht sehr beredt. Er holte ein paar zusammengerollte Blätter hervor und hielt sie Henriette auffordernd entgegen. »Es sind Variationen für vier Hände. Vielleicht könnten wir gemeinsam …?«
»Oh, da fragen Sie bitte Madame Trepte! Ich bin bei weitem nicht so gut auf dem Piano, dass ich a prima vista spielen könnte, schon gar nicht Beethoven«, wehrte Henriette ab.
Es stimmte; ihr Spiel hatte sich zwar während des Aufenthalts bei den Treptes verbessert, weil Carlotta sie zum Üben anhielt. Aber sie selbst betrachtete sich immer noch als eine höchst bescheidene musikalische Amateurin. Worte waren ihr Metier, nicht Noten.
Außerdem wollte sie nicht spielen, um sich vorführen zu lassen wie ein Paradepferd. Es würden ohnehin nur wehmütige Melodien dabei herauskommen. Doch sie würde gern Carlotta zuhören, schon um dem banalen Geschwätz zu entfliehen.
Nach dem musikalischen Beitrag schlug die fast unerträglich gut gelaunte Madame Stieglitz vor, Scherenschnitte von allen Anwesenden anzufertigen. Wie sich herausstellte, besaß die alte Dame dafür wirklich Geschick, und ihr erstes aus schwarzem Papier geschnittenes Porträt – Carlotta im Profil – rief ehrlich gemeinte Komplimente hervor.
Es wurde beschlossen, dass sich alle Anwesenden nacheinander mit der Schere porträtieren lassen sollten – die Gelegenheit für Henriette, sich ein paar Schritte Richtung Kamin zurückzuziehen, während die anderen die aufgekratzte Madame Stieglitz umringten, um zuzusehen, wie nun das Profil des jungen Pianospielers mit gekonnt feinen Schnitten Kontur annahm, und dabei mit Lob nicht geizten.
Jette starrte zum Fenster, auch wenn in der Dunkelheit draußen nichts zu erkennen war, und fühlte sich gedankenleer.
Wenn sie dieser Gesellschaft nur endlich entfliehen könnte! Sie war müde, unendlich müde und der aufgesetzten Munterkeit einer solchen Runde überdrüssig.
So bemerkte sie erst gar nicht, dass sich einer der jungen Männer in ihre Richtung bewegte, Mokkatasse und Unterteller geschickt balancierend.
»Ist Ihnen kalt?«, erkundigte er sich fürsorglich und deutete auf das Kaminfeuer. »Da Sie sich entgehen lassen, wie Madame Stieglitz uns allen wahlweise römische Profile oder Knollennasen verpasst?«
»Ein wenig«, sagte sie und fürchtete schon, nun erneut unbeholfene Komplimente für ihr schönes, aber aus dünnem Musselin gefertigtes Kleid zu hören.
Stattdessen fragte der junge Mann – Ludwig, erinnerte sie sich, mit dunkelbraunem Haar und langen Koteletten, wie sie die Mode vorschrieb – besorgt: »Soll ich Ihnen ein wärmendes Tuch bringen?«
Schon sah er sich um und deutete auf die cremefarbene Stola, die Henriette vor dem Mahl getragen hatte und die auf einem Sessel lag.
»Ich danke Ihnen, das wird nicht nötig sein. Es geht schon wieder«, wehrte sie freundlich ab. Mit einem Fransentuch am Kamin zu stehen, war nicht ratsam. Die züngelnden Flammen konnten leicht danach greifen.
»Dann hole ich Ihnen noch einen Kaffee«, insistierte er, stellte sein eigenes Getränk auf dem Kaminsims ab, ging zur Anrichte und brachte ihr eine Tasse, aus der es noch dampfte.
Während er damit auf sie zuschritt, rekapitulierte sie rasch, was sie noch von ihm wusste; von ihr würde jetzt höfliche Konversation mit dem jungen Mann erwartet. Er hatte ihr bei Tisch gegenübergesessen und nur wenig gesagt. Wenn sie sich recht entsann, sollte er eine höhere Beamtenlaufbahn einschlagen.
Sie dankte ihm für den frischen Mokka, sog den Duft ein und nippte daran.
»Sie müssen während des Krieges in einem der preußischen Freikorps gedient haben, wenn Sie nun hierzulande im Staatsdienst eingestellt werden sollen«, sagte sie dann, ohne zu bedenken, dass er es vielleicht als taktlos empfinden mochte, wenn sie die Rede auf den Krieg brachte. Hatte ihr nicht erst am Morgen Monsieur Parthey eingeschärft, die Menschen wollten nichts mehr vom Krieg hören, sondern sich amüsieren?
Deshalb fügte sie rasch und ehrlich bedrückt hinzu: »Verzeihen Sie, ich will Sie nicht mit Fragen bedrängen, die als unangemessen erachtet werden könnten.«
Ludwig nahm noch einen Schluck aus seiner Tasse und stellte sie wieder auf dem Kaminsims ab.
»Keineswegs«, versicherte er lächelnd. »Ja, ich war als Freiwilliger in der preußischen Armee. Doch wenn Sie nun glauben, dass ich zu den Helden des berühmten Lützowschen Freikorps zählte« – an dieser Stelle spielte ein winziges, fast sarkastisch wirkendes Lächeln um seine Lippen –, »muss ich Sie leider enttäuschen. Ich gehörte einem weniger bekannten, aber sehr erfolgreichen Kommando an. Ich hatte die Ehre, unter dem Befehl des Rittmeisters von Colomb zu dienen.«
Henriette hielt mitten in der Bewegung inne, starrte ihn verblüfft an und war auf einmal hellwach, so wach wie seit langem nicht.
»Tatsächlich? Ein guter Freund von mir gehörte ebenfalls diesem Korps an. Vielleicht kennen Sie ihn?«
»Wie lautet sein Name?«, fragte Ludwig lebhaft.
»Felix Zeidler, ein Bergstudent aus Freiberg. Wir hatten zusammen in Freiberg preußische Verwundete gepflegt, bevor er sich als Freiwilliger meldete. Aber eigentlich stammt er aus Köthen-Anhalt.«
»Volontärjäger Zeidler?«, rief ihr Gegenüber überrascht und lächelte breit. »Mit krausem Haar und einer Brille? Und einem hervorragenden Gespür für Pferde?«
»Sie kennen ihn?«, fragte Henriette erfreut.
»Natürlich. Ein guter Mann. Er hatte uns gewarnt, als uns der Feind von drei Seiten entgegenrückte, obwohl er verwundet war und sich kaum noch im Sattel halten konnte. Dass wir damals nicht niedergemacht wurden wie die Lützower ein paar Tage zuvor nahe Leipzig, ist auch sein Verdienst.«
»Davon wusste ich gar nichts«, staunte Henriette. »Er hegte Zweifel, ob er wohl für das militärische Leben geeignet sei. Aber er wuchs auf dem elterlichen Gestüt auf, daher sein gutes Gespür für Pferde.«
»Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Während des Waffenstillstands verloren wir uns aus den Augen. Zeidler musste seine Verwundung auskurieren, er hatte zwei Finger der rechten Hand verloren.«
»Er beendete sein Studium in Freiberg und ging zum Korps Yorck, als die große Schlacht bei Leipzig begann.«
»Oh, das Korps Yorck … Die hatten im Norden Leipzigs schlimme Verluste zu beklagen, ein Drittel der Männer«, warf Ludwig bedrückt ein. »Ich hoffe, er ist durchgekommen.«
»Ja, das ist er. Er war bei Blüchers Rheinübergang dabei und bei den Kämpfen um Paris«, erzählte Henriette zunehmend lebhaft. »Inzwischen lebt er sogar hier in Berlin, soweit ich weiß. In seinem letzten Brief schrieb er mir, dass er in einer Einrichtung arbeiten will, in der kriegsverletzte und kriegsgeschädigte Pferde gepflegt werden.«
Ludwig lächelte. »Das klingt ganz nach ihm. Er litt mit den Tieren. Viele sind nicht nur körperlich verwundet worden, sondern einfach … verrückt geworden, wenn man das bei einem Pferd so sagen kann. Haben Sie ihn hier in Berlin getroffen?«
»Nein. Seit besagtem Brief habe ich nichts mehr von ihm gehört.«
An der Stelle verschwieg Henriette, weshalb Felix einer erneuten Begegnung mit ihr ausgewichen war, obwohl sie ihn als guten Freund betrachtete. Sie hatten gemeinsam viel durchlitten, aber es stand Ungesagtes zwischen ihnen. Und manches, bei dem sie Felix gern widersprechen würde.
»Kennen Sie seine Anschrift? Oder nein, machen Sie sich nicht die Mühe, danach zu suchen. Ich weiß, wo diese Anstalt für Pferde ist. Dort werde ich ihn schon finden«, meinte Ludwig voller Tatendrang.
Auf der anderen Seite des Salons nickte Wilhelm Trepte seiner Frau vielsagend zu.
»Siehst du, ich habe es doch gewusst! So lebhaft hat sie nicht mehr gewirkt, seit …«
Er verstummte. Carlotta würde wissen, was er meinte, und er wollte es nicht aussprechen, nicht an diese Wunde rühren.
»Ich hatte sehr gehofft, dass einer der jungen Männer sie ein wenig von ihrem Kummer ablenkt, und bin unendlich froh darüber. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass sich die beiden wiedersehen. Vielleicht in einer Abendgesellschaft, bei der auch getanzt wird?«
Carlotta seufzte leise und sah ihn schmerzerfüllt an.
»Ach, Wilhelm. Hörst du denn nicht, worüber sie so angeregt sprechen? Vom Krieg! Wollten wir sie nicht genau davon abbringen? Sie hat ihren Mann verloren. Wir haben unseren Sohn verloren. Alle unsere Söhne …«
Sie zog ein Taschentuch aus dem Ärmel und ging unter einem Vorwand rasch hinaus, damit niemand ihre Tränen sah.
Böses Erwachen
In dieser Nacht fand Henriette lange keinen Schlaf. Nachdem die Gäste gegangen waren, lag sie eine halbe Ewigkeit wach, starrte im Dunkeln an die Zimmerdecke und grübelte. Das Gespräch mit Ludwig Kiehn hatte viele Erinnerungen aufgewühlt. Und die Verabredung ihrer Schwiegereltern mit den Gästen, sich alle demnächst in einem größeren Salon Unter den Linden wiederzusehen, brachte sie zum Nachdenken darüber, ob sie sich wohl von Ludwig zum Tanz führen lassen würde. Ob sie das ertragen könnte, ohne in Tränen auszubrechen, weil es sie sofort an den einzigen Ball erinnerte, den sie mit Maximilian besuchen durfte.
Nein, es würde ihr wohl nicht gelingen. Wie sollte sie tanzen, wenn jede Unbeschwertheit seit Maximilians Tod in ihr erstorben war?
Ein barsches und hartnäckiges Klopfen riss die Bewohner des Hauses in der Brüderstraße 12 jäh aus dem Schlaf. Henriette fuhr zusammen und richtete sich erschrocken auf. Der Tag war noch gar nicht richtig angebrochen, wie sie mit einem Blick zum Fenster feststellte.
Eine laute, fordernde Stimme dröhnte von unten herauf: »Polizei! Machen Sie auf! Sofort«
Hastig schob sie das Federbett von sich, warf sich den Hausmantel und ein Schultertuch über und steckte das für die Nacht zum Zopf geflochtene Haar zu einem Knoten am Hinterkopf fest. Ein besorgter Blick auf Max, der angesichts des Tumults ein leises Wimmern von sich gegeben hatte, sagte ihr, dass er schon wieder schlief, während unten an der Tür immer noch gelärmt wurde.
Auf dem Flur traf sie Wilhelm und Carlotta Trepte, die beide ebenfalls Hausmäntel über der Nachtkleidung trugen und genauso überrascht und beunruhigt wirkten wie sie.
Gemeinsam hasteten sie hinunter. Vor der Eingangstür wartete Änni, das Dienstmädchen, die als Einzige vollständig bekleidet war, denn sie hatte bereits damit begonnen, die Kachelöfen und den Herd zu befeuern. Mit einer Kerze in der Hand sah sie verängstigt und fragend zum Hausherrn, während hinter der Tür immer noch eine Stimme lautstark Einlass forderte.
Wilhelm Trepte gab Änni das Zeichen, die Tür zu öffnen, und trat sogleich schützend vor die Hausbewohner.
Carlotta und Henriette stellten sich zwei Schritte hinter ihm auf und warfen sich bange Blicke zu.
In der Tür standen zwei Männer, beide eher klein, aber stolz in die Brust geworfen – ganz durchdrungen von der ihnen übertragenen Macht. Henriette kannte solche Wichtigtuer zur Genüge. Doch das Gehabe dieser beiden Männer beunruhigte sie sehr.
»Wohnt hier eine gewisse Henriette Trepte?«, fragte der ältere mit schnarrender Stimme. Er hatte Hängebäckchen und tief eingesunkene Schweinsäuglein, aus denen unverhohlener Triumph sprach.
Sein jüngerer Begleiter trug einen martialischen Schnauzbart, dessen Enden er mit viel Sorgfalt und Pomade hochgezwirbelt hatte.
»Wer sind Sie, was führt Sie in aller Herrgottsfrühe hierher?«, erkundigte sich Wilhelm Trepte höflich, doch bestimmt. Er war Rechtsgelehrter und würde sich nicht einfach so überrumpeln lassen.
»Schack, Polizeiinspektor Diederich Schack«, schnarrte der Ältere und wies auf seinen Begleiter. »Dies ist mein Kollege Wuttke. Wir sind hier im Auftrag des Polizeipräsidenten. Sind Sie Henriette Trepte?«, fragte er und starrte die junge Frau finster an.
Henriette wollte bejahen, doch ihr Schwiegervater fiel ihr ins Wort.
»Wozu wollen Sie das wissen?«
Schack holte ein gesiegeltes Schriftstück hervor und hielt es Wilhelm Trepte vor die Nase.
»Sie ist eine gefährliche Aufrührerin und wird auf Anordnung des Polizeipräsidenten mit sofortiger Wirkung aus Preußen ausgewiesen. Sie haben eine Stunde zum Packen, Madame, dann deportieren wir Sie über die Landesgrenze, nach Sachsen. Die Kutsche steht unten schon bereit.«
Fassungslos und unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, starrte Henriette ihn an. Durch die geöffnete Tür drang Eiseskälte in den Flur, die sie nach der Ankündigung Schacks noch mehr erstarren ließ.
Carlotta stieß einen Schreckensschrei aus, doch ihr Mann drückte kräftig ihre Hand, um ihr zu bedeuten, Ruhe zu bewahren.
»Es kann sich nur um einen Irrtum handeln«, widersprach Wilhelm Trepte, so gelassen er konnte. »Meine Schwiegertochter ist eine junge Mutter und Witwe, die Witwe eines preußischen Offiziers der Garde. Ich selbst bin Professor an der juristischen Fakultät unserer von Seiner Majestät dem König gegründeten Universität. Lassen Sie mich das Papier lesen, und ich bin sicher, wir können die Angelegenheit rasch aufklären.«
Inzwischen waren auch der Diener Paul und Madame Bellefleur herbeigeeilt, beide vollständig angekleidet. Madame Bellefleur erweckte den Eindruck, gar nicht erst geschlafen zu haben, so korrekt saßen ihr Kleid und ihre Frisur, während ihre Miene tiefste Missachtung für das rüde Auftreten der beiden Polizisten ausdrückte, zumal zu solcher Unzeit.
»Der Ehre, von einem preußischen Offizier erwählt zu werden, hat sie sich nicht würdig erwiesen!«, blaffte Schack. »Denn es stimmt doch, Madame, dass Sie ein Traktat über Ihre vermeintlichen Kriegserlebnisse geschrieben haben, welches Sie der Nicolaischen Verlagsanstalt zur Veröffentlichung anboten und in dem Seine Majestät, unser König, herabgewürdigt wird?«
Wilhelm Trepte bedeutete Henriette, nichts zu sagen, und forderte noch einmal, den Deportationsbefehl lesen zu dürfen.
Schack hielt das Papier mit beiden Händen fest, also zog der Jurist seine Brille aus der Tasche des Morgenrocks und beugte sich über das Schriftstück. Nachdem er es studiert hatte, richtete er sich auf.
»Die Anschuldigung ist falsch oder zumindest stark übertrieben«, widersprach er bestimmt und wandte sich direkt an Schack. »Würden Sie uns einen Aufschub gewähren, wenn ich mich für meine Schwiegertochter verbürge und wir den Tag nutzen, um dieses Missverständnis aufzuklären?«
Der Inspektor konterte genüsslich: »Ihre juristischen Spitzfindigkeiten werden Ihnen hier nichts nützen, Herr Professor. Meine Befehle sind eindeutig: Abtransport der aufrührerischen Person in einer Stunde! Die Zeit läuft.«
Dabei wedelte er mit dem gesiegelten Papier vor Wilhelm Treptes Nase.
Der rieb sich müde die Stirn, seufzte leise und erklärte den beiden Frauen: »Selbstverständlich kann das nur ein Irrtum sein, und ich werde persönlich im Polizeipräsidium Einspruch erheben. Doch leider hebt das den Deportationsbefehl nicht auf.«
Entsetzt starrten ihn sämtliche Bewohner des Hauses an.
»Das ist doch nicht …«, begann Carlotta, aber Wilhelm Trepte fiel ihr ins Wort, damit sie sich nicht auch noch in Schwierigkeiten brachte, und sagte zu Henriette: »Es tut mir leid. Ich werde alle Rechtsmittel einlegen, die mir zur Verfügung stehen, die Vorwürfe widerlegen und dich, so schnell es geht, zurückholen. Doch für den Moment gilt dieses Dokument. Wir müssen packen.«
Henriette fühlte den Boden unter sich wanken.
Wieder kam ihr der Schwiegervater zuvor.
Betont höflich wandte er sich an den Inspektor mit den Hängebäckchen: »Sie hat ein kleines Kind, kaum älter als ein Jahr. Meinen Enkelsohn. Können Sie nicht wenigstens mit Rücksicht darauf die Bedingungen etwas lindern?«
»Daran hätte sie denken sollen, bevor sie Seine Königliche Majestät verunglimpfte«, belehrte ihn der Polizeibeamte Schack genüsslich. »Sie sollte sich lieber um das Kind kümmern und sich einen Mann suchen, der auf sie aufpasst, statt aufwieglerische und wirre Pamphlete zu verfassen.«
Nun konnte er nicht nur ein anmaßendes Weibsbild maßregeln, sondern auch noch einen Universitätsprofessor in die Schranken weisen. Was für ein großartiger Tag!
Henriette war immer noch wie zu Eis erstarrt. Zu ihrem Entsetzen bat Wilhelm Trepte die beiden Polizeibeamten sogar ins Haus.
»Führe die beiden Herren in den Salon«, wies er Änni an. »Madame Bellefleur wird Ihnen einen Mokka bringen, während wir uns angemessen kleiden und mit dem Packen beginnen.«
Die Haushälterin sagte kein Wort, doch ihre Miene drückte deutlich aus, wie zuwider es ihr war, die beiden Eindringlinge bewirten zu müssen, die im Begriff waren, noch mehr Unglück über die Familie zu bringen.
Hatten die Treptes nicht schon genug zu leiden gehabt? Alle drei Söhne hatten sie im Krieg verloren! Und nun sollte auch noch die einzige Schwiegertochter ins Elend gestürzt werden. Henriette, das arme Ding, das so viel Schlimmes in den Kriegsjahren hatte erdulden müssen. Und was sollte aus dem kleinen Max werden?
Während Madame Bellefleur die Polizeiinspektoren ins Haus führte, hielt Carlotta ihren Mann am Handgelenk zurück.
»Du willst diese beiden aufgeblasenen Wichte auch noch bewirten? In unserem Salon?«, zischte sie mit mühsam verhaltenem Zorn.
»Sie mögen aufgeblasene Wichte sein, doch sie haben Macht über uns«, gab er leise zurück. »Ich muss eine ungezwungene Atmosphäre schaffen, damit sie auf meine Vorschläge eingehen. Zwar kann ich die Deportation der armen Henriette nicht verhindern, aber ich will einige Erleichterungen für sie aushandeln. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich sie allein mit diesen Widerlingen in eine Kutsche steigen und ins Ungewisse bringen lasse?«
Er schob seine Frau und seine Schwiegertochter in Jettes Zimmer und rief das Hausmädchen dazu.
Sorgfältig schoss Wilhelm Trepte die Tür des Zimmers hinter sich, wo der kleine Max schlaftrunken und mit zerzaustem Haar aus seinem Bettchen auftauchte.
Wortlos nahm ihn Henriette auf den Arm und drückte ihn an sich. Sollte sie tatsächlich binnen einer Stunde mit dem Kind hinaus in die Kälte getrieben werden? Des Landes verwiesen?
Wilhelm erklärte den fassungslosen Frauen: »Ich kann die Deportation in diesem Moment nicht verhindern, ich kann mich nur nachträglich darum kümmern, dass sie rückgängig gemacht wird. Doch das wird einige Zeit dauern. Also tun wir jetzt Folgendes: Ihr beginnt zu packen, das Nötigste für ein paar Tage, alles, was du für Max brauchst. Viel Warmes, in der Kutsche wird es eiskalt sein. Hab keine Angst, Jette, ich überlasse dich und den kleinen Max nicht allein diesen beiden Männern! Änni, du hilfst beim Packen. Und sag der Köchin, sie soll einen Korb mit Proviant füllen. Ich gehe derweil in den Salon und handle mit diesen beiden Polizisten aus, dass ich Henriette und Max begleite – bis Leipzig. Dorthin bitte ich deinen Freiberger Oheim, damit er dich abholt. Wenn ich Monsieur Gerlach jetzt gleich schreibe, erreicht ihn meine Nachricht mit der Reitenden Briefpost im günstigsten Fall, noch ehe wir in Leipzig eintreffen. Dort logieren wir uns ein und warten auf ihn.«
»Gibt es denn wirklich keinen anderen Weg? Und wie willst du diese Kerle dazu bringen, deinem Plan zuzustimmen?«, wehklagte Carlotta.
»Mir bleibt nichts übrig, als sie zu bestechen«, erklärte Wilhelm ruhig. »Natürlich nicht so, dass es nach Bestechung aussieht, sonst bekommen wir auch noch eine Anklage.«
»Sei bloß vorsichtig!«, rief Carlotta und rang die Hände.
Doch sobald ihr Mann das Zimmer verlassen hatte, übernahm sie energisch das Regiment, damit eilig gepackt und nichts Wichtiges vergessen wurde. Die Fahrt mit der Postkutsche würde ein oder zwei Tage dauern, je nachdem, ob die Herren von der Polizei eine Übernachtung in einer Poststation auf halber Strecke erlaubten; und der November war kalt und stürmisch. Also brauchten sie nicht nur warme Kleider, Mäntel und wollene Tücher, sondern auch Wärmpfannen für die Füße und Decken.
Bevor Wilhelm Trepte – nun vollständig bekleidet – den Salon mit den dort Kaffee trinkenden Polizeibeamten betrat, hieß er den Hausdiener Paul vor der Tür warten. Er würde ihn gleich hineinrufen und mit einem ebenso wichtigen wie eiligen Botendienst betrauen.
»Ich tue alles, wenn wir Madame Henriette damit helfen können«, versicherte der hagere Paul. »Am liebsten würde ich diese Kerle hochkant hinausbefördern.«
Das hätte Wilhelm zwar auch gern getan, aber den beiden musste er mit anderen Mitteln begegnen. Deshalb zwang er sich zu Gelassenheit und Höflichkeit, als er das Zimmer betrat.
»Ich hoffe, Sie haben es bequem. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein paar Butterbrote bringen lasse? Sicher hatten Sie noch kein Frühstück so zeitig am Morgen«, wandte er sich an Schack und Wuttke.
Schack sah ihn über den Tassenrand hinweg mit strengem Blick an. »Das wird uns nicht an der Ausübung unserer Pflichten hindern!«
Demonstrativ zog er seine Taschenuhr hervor, ließ den Deckel aufspringen und verkündete: »Die Zeit verrinnt. Eine Viertelstunde ist schon vergangen.«
»Selbstverständlich behindern wir die Vollstreckung des Befehls nicht, meine Herren. Ich bin Jurist, niemand kennt die Bedeutung eines solchen Dokuments besser. Es wird bereits gepackt.«
Wilhelm Trepte ging zur Tür, schickte Paul mit Anordnungen in die Küche und trug ihm auf, gleich zurückzukehren.
Danach nahm er in seinem Lehnsessel Platz und richtete den Blick auf den wortführenden Inspektor, der die Hände vor seinem Bauch verschränkt hatte, welcher fast die Knöpfe von der Weste sprengte.
»Meine Schwiegertochter wird der Verfügung Folge leisten und Sie ohne Widerspruch begleiten. Doch mit Rücksicht auf ihre Zartheit, die Kälte und das Kleinstkind – immerhin Sohn eines fürs Vaterland gefallenen preußischen Offiziers der Garde – möchte ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten.«
Triumphierend sahen ihn die beiden Polizeibeamten an, sofort willens, dies abzulehnen.
»Ich würde gern meine Schwiegertochter und meinen Enkel begleiten und sie hinter der preußisch-sächsischen Grenze in Leipzig an ihre sächsischen Verwandten übergeben. Sie wollen doch nicht eine so junge Frau allein hinter der Grenze aussetzen?«
»So lauten unsere Befehle«, schnarrte Schack genüsslich und täuschte Bedauern vor. »Selbst wenn wir es wollten, man ist ja kein Unmensch … Wir sind nicht befugt, eine weitere Privatperson – also Sie – auf Staatskosten zu befördern.«
»Natürlich nicht«, stimmte Wilhelm Trepte sofort zu. »Ich möchte auf eigene Kosten eine zweite Kutsche bestellen. Sie beide allein in einem Gefährt mit meiner Schwiegertochter und einem unruhigen Kind, das gewickelt und gefüttert werden muss – dies wäre ohnehin sehr beengt.«
Da die beiden Beamten nichts erwiderten, sondern auf weitere Einzelheiten warteten, konnte er erkennen, dass die Saat Früchte trug, die er mit seinen Worten gelegt hatte. Ohne es zu merken, rümpften beide Männer gleichzeitig die Nasen, angewidert von der Vorstellung, während einer langen Fahrt das Quengeln eines Kleinkindes und den durchdringenden Geruch nasser Windeln ertragen zu müssen.
»Wenn Sie uns freundlicherweise eine weitere Stunde bis zum Aufbruch gewähren, miete ich sofort die zweite Kutsche an. Und wenn ich meine Schwiegertochter und das Kind begleite, ersparte Ihnen das beträchtliche Unannehmlichkeiten. Wir können über Nacht Station in Wittenberg machen, auf halber Strecke, wie üblich bei den regulären Postkutschen. Natürlich komme ich für Ihre Verpflegung und Logis und sämtliche sonstigen Kosten auf.«
Diederich Schack versuchte, in seinem Sessel zu einiger Größe zu finden, und fragte streng: »Wollen Sie uns etwa bestechen?«
Trepte gab sich entrüstet. »Natürlich nicht! Wie kommen Sie nur darauf? Ich bin Professor der Jurisprudenz und stehe voll und ganz hinter dem Gesetz. Ich möchte lediglich für Ihre Mehrausgaben aufkommen, denn die wollen und dürfen wir nicht dem Staat auferlegen.«
Er räusperte sich und sagte dann mit gesenkter Stimme:
»Nach wie vor scheint mir, dass hier möglicherweise ein Versehen zugrunde liegt, was ich sogleich nach meiner Rückkehr erforschen werde. Immerhin fand sogar Prinzessin Louise von Preußen, die Fürstin Radziwill, Gefallen an den Texten meiner Schwiegertochter.«
»Die Prinzessin Radziw-w-w-?«
Diese Neuigkeit war eindeutig eine unliebsame Überraschung für den eifernden Schack. Nervös fuhr er mit dem Finger unter seinen Kragen, als sei der ihm zu eng geworden. Wenn sich die ganze Sache wirklich als Irrtum herausstellte, konnte sich das nachteilig auf seine Karriere auswirken.
Außerdem behagte ihm der Gedanke an ein wenig mehr Bequemlichkeit auf dieser Reise sehr. Tagelang in der Kutsche auf schlechten Straßen durchgerüttelt zu werden, war kein Vergnügen – und im nasskalten November schon gar nicht.
Er äugte misstrauisch hinüber zu Wuttke, ob der ihn womöglich bei den Vorgesetzten anschwärzen würde, doch der Schnauzbärtige schien ähnlich zu denken wie er.
»Wenn Sie für alle zusätzlichen Kosten aufkommen … Nun gut, dann wollen wir gestatten, dass Sie uns begleiten. Wie gesagt, man ist ja kein Unmensch. Aber was Sie auch danach unternehmen wollen, es wird nichts bewirken. Der Staat irrt sich nie!«, schnarrte Schack.
Wilhelm Trepte verzichtete wohlweislich darauf, diesen Punkt zu diskutieren, und rief Paul herein.
»Lauf, so schnell du kannst, zu Henochs Kutschenanstalt und bestelle ein Gefährt sofort hierher. Nach Leipzig mit Übernachtung in Wittenberg und zurück«, wies er an und drückte dem Burschen eine Geldbörse in die Hand.
Monsieur Moses Henoch war erst kürzlich das Privileg erteilt worden, gemeinsam mit einem Pferdehändler eine Mietanstalt für Droschken und Kutschen in Berlin zu eröffnen, und er war verpflichtet, mindestens achtzig Wagen parat zu halten. Das war ein großer Fortschritt für den Verkehr in der preußischen Hauptstadt, die immerhin fast zweihunderttausend Einwohner zählte.
»Beeil dich!«, mahnte Trepte den Burschen. »Danach stellst du mir Reisegepäck für vier Tage zusammen. Und dann musst du zwei Briefe aufgeben.«
Paul nickte und stob los, nachdem er einen rachsüchtigen Blick auf die beiden Inspektoren geworfen hatte.
»Es freut mich, dass wir zu einer Übereinkunft gekommen sind«, konstatierte Trepte erleichtert, ließ Madame Bellefleur mit einem Teller belegter Brote herein und ging zum Sekretär, um einen Brief an Henriettes Oheim Friedrich Gerlach in Freiberg aufzusetzen, ihn über die Notlage zu informieren und ihn nach Leipzig zu bitten, um seine Nichte und den kleinen Max von dort abzuholen.
Dann verfasste er noch eine Notiz an die Universität, dass er aufgrund eines Notfalls erst in frühestens vier Tagen zurück sein würde. Die Vorlesungen möge derweil Monsieur Stieglitz übernehmen.
Eilige Schritte auf den Treppen, Türklappern und Rufe kündeten davon, dass im Haus sämtliche Vorbereitungen für die unerwartete Abreise getroffen wurden – für Henriettes Verbannung.
Durch die Tür hörte der Rechtsgelehrte seinen Enkel weinen, der nicht damit einverstanden war, so früh aus seinem warmen Bettchen geholt und dick angezogen zu werden.
Madame Bellefleur – Gott segne sie für ihre Sorgfalt und Unerschütterlichkeit selbst in Notlagen! – trat erneut ein und erklärte sich bereit, das Reisegepäck für ihren Dienstherrn zu packen. Mit dem Nötigsten für Henriette und Max seien sie und Madame Trepte gleich fertig.
Der Jurist faltete seine Briefe und siegelte sie. Von draußen hörte er, wie eine Kutsche rasselnd und mit Hufgeklapper vorfuhr. Paul klopfte an, meldete die Ausführung seines Auftrags und ließ den Kutscher eintreten, der sich nach Einzelheiten der Reise erkundigte.
Trepte händigte dem Diener die Briefe aus. »Diesen schaff sofort zur Reitenden Post; ich hoffe, er geht noch heute morgen ab. Und danach bringst du das hier zur Universität.«
Paul nickte und trabte erneut los.
Eine weitere halbe Stunde verging, bis schließlich Madame Bellefleur verkündete, es sei alles gepackt und stehe bereit.
Die kreidebleiche Henriette trat ein, ein warmes Tuch über den Mantel geschlungen, ihr dick eingemummeltes Söhnchen auf dem Arm, gefolgt von der aufgelösten Carlotta.
»Das muss ein Irrtum sein, Sie können doch diese junge Frau und ihr Kind nicht aus unserem Haus jagen, aus unserem Land«, versuchte sie erneut, an die beiden Polizisten zu appellieren, noch bevor ihr Mann es unterbinden konnte.
Wilhelm legte ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm.
»Ich kümmere mich darum, dass Henriette und unser Enkel die Reise sicher überstehen«, versprach er. »Danach sehen wir weiter.«
»Selbst Prinzessin Louise von Radziwill …«, wollte auch sie anführen, aber ihr Mann drückte ihr sanft den Arm und hielt sie mit einem warnenden Blick zum Schweigen an.
»Sie messen dieser in Preußen unerwünschten Person eine Bedeutung zu, die sie niemals haben kann!«, meinte der Inspektor verächtlich zu Carlotta und schnaubte. Dann richtete er seinen Blick auf Henriette.
»Wenn es nach mir ginge, würde ich Sie zwingen, Ihr Machwerk eigenhändig zu verbrennen, gleich hier in diesem Kamin. Doch der Herr Polizeipräsident besteht darauf, Ihre wirren Traktate als Beweisstück aufzubewahren – falls Ihnen die Idee kommen sollte, sich erneut auf preußisches Staatsgebiet zu wagen.«
Selbstzufrieden schnaufte Schack, wobei seine Hängebäckchen zitterten, und Wuttke zwirbelte die Enden seines Schnauzbartes.
Unterwegs
Die Nachbarn hatten natürlich mitbekommen, dass etwas Außergewöhnliches in ihrer Straße geschah: das herrische Klopfen an der Tür, noch bevor die Sonne richtig aufgegangen war, und gleich zwei Kutschen vor dem Haus, von denen eine mit Gepäck beladen wurde. Neugierig sahen sie aus den Fenstern, einige kamen sogar nach draußen, um Genaueres zu erfahren.
Wilhelm Trepte drängte darauf, dass sie schnell einstiegen.
Carlotta sollte der sensationslüsternen Nachbarschaft einen familiären Notfall in Sachsen als Grund für diese ungeplante Reise nennen und sogleich Monsieur Parthey aufsuchen, um ihm unter vier Augen sämtliche Einzelheiten zu berichten. Möglicherweise hatte auch der Verleger Sanktionen zu befürchten.
Als Henriette mit ihrem Söhnchen auf dem Arm aus dem Haus trat, war ihr zumute, als würde sie erneut – wie schon mehrfach – von einem Leben in ein anderes geschleudert.
Sie folgte wortlos Schacks Anordnung und stieg in die größere der beiden Kutschen, die bei Monsieur Henoch gemietete. Ihr Schwiegervater setzte sich neben sie, Schack ihnen gegenüber. Wuttke würde in dem Polizeivehikel folgen.
Der Kutscher schlug die Tür zu, stieg auf seinen Bock und trieb die Pferde an.
Mit einem Ruck rollte das Gefährt los. Henriette wollte noch einmal durchs Fenster nach draußen sehen, zu denen, die sich vor dem Haus der Treptes versammelt hatten, um ihnen nachzublicken. Doch schon war der Moment verstrichen.
Sie schloss die Augen und fragte sich, ob und wann sie wohl je hierher zurückkehren würde.
Und was Oheim und Tante in Freiberg wohl sagten, wenn Wilhelm Treptes Brief sie erreichte? Sie hatte das Wehklagen Johanna Gerlachs schon im Ohr. Und war ihretwegen Monsieur Parthey in Gefahr? Vielleicht sogar ihr Schwiegervater? Zwischen all dem blitzte ganz kurz der Gedanke an Ludwig auf. Wie jäh hatte sich ihr Schicksal gewendet! Gestern Abend noch hatte sie mit ihm geplaudert und über ein Wiedersehen nachgedacht.
Dann kam ihr ein anderer schrecklicher Gedanke, so schlimm, dass sie zusammenzuckte und jäh den Arm ihres Schwiegervaters umklammerte. Doch der warnte sie mit einem Blick davor, etwas in Schacks Beisein zu äußern.
Der kleine Max hielt sie von weiteren Grübeleien ab, denn er war unleidlich, weil er so früh geweckt worden war und nun auf ihrem Schoß stillsitzen sollte.
Seine anfängliche Begeisterung über die Pferde und die Reise in einer Kutsche verflog rasch, nun wand er sich auf ihrem Schoß hin und her und quengelte. Seufzend holte Jette aus dem Proviantkorb zu ihren Füßen einen Zwieback und gab ihn dem Jungen, der daran zu nagen begann und für eine Weile Ruhe gab. Doch bald spielte er nur noch mit dem aufgeweichten Gebäck und zerdrückte es zwischen seinen kleinen Fingern.
Mutlos dachte Henriette, dass ihr Mantel schon auf den ersten Meilen dieser Reise beschmutzt wurde. Aber das war jetzt ihre geringste Sorge. Wie sollte sie den Kleinen so lange ruhig halten – noch dazu unter den missbilligenden Blicken des widerlichen Inspektors mit den Hängebäckchen, der seine tiefliegenden Augen mit höhnischem Grinsen auf sie richtete?
Schnell war sie durchgefroren, obwohl sie zusätzlich zu Mantel und dicken Strümpfen noch in wollene Tücher gehüllt war und Pulswärmer an den Handgelenken trug, denn im Muff konnte sie ihre Hände nicht wärmen, sie musste ja Max festhalten. Der sich prompt lautstark über ihre eisigen Finger beschwerte.
Das heiße Wasser in den kupfernen Wärmflaschen war bald erkaltet, und der Blick aus dem Fenster ließ sie weiter frösteln: grauer Himmel, kahle Bäume. Windböen trieben welkes Laub vor sich her und rüttelten an der Kutsche.
Zu allem Übel setzte Max nach einer Weile eine konzentrierte, in sich gekehrte Miene auf, ächzte vernehmlich, und das Resultat seiner Anstrengungen erfüllte die Kutsche mit einem durchdringenden Geruch.
Was nun? Sie konnte doch nicht hier seine Windel wechseln!
Schack verzog angewidert das Gesicht.
Ihren Schwiegervater allerdings erschien die Lage insgeheim zu amüsieren.
»Lassen Sie uns an der nächsten Poststation eine kurze Rast einlegen, damit das Malheur behoben werden kann«, schlug er höflich und mit vollkommen ernster Miene vor.
Der Inspektor schien hin- und hergerissen zwischen dem Drang, diesem renitenten Weibsbild eine Lehre in preußischem Untertanengeist zu erteilen, und dem Wunsch, dem Windelgestank zu entkommen.
Zähneknirschend stimmte er zu; dabei waren sie gerade erst kurz vor Zehlendorf. Den Gedanken, es heute noch bis an die Grenze zu schaffen, konnte er wohl aufgeben. Die Übernachtung in Wittenberg – üblich bei Reisen mit der Postkutsche zwischen Berlin und Leipzig – war unausweichlich geworden.
Aber dieser Advokat hatte ja zugesichert, für alle Kosten aufzukommen. Deshalb und mit der Aussicht auf heißen Kaffee und eine Mahlzeit stimmte Schack dem Vorschlag zu.