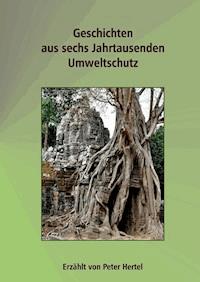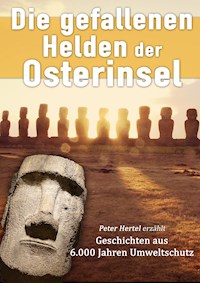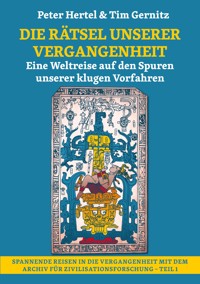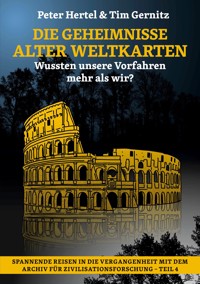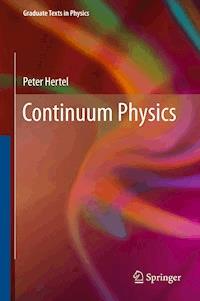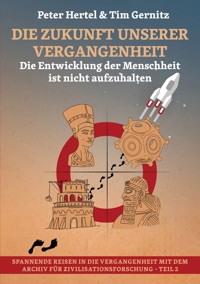
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Spannende Reisen in die Vergangenheit
- Sprache: Deutsch
Die zweite interessante Reise in die Vergangenheit mit dem Archiv für Zivilisationsforschung begleitet den Leser über einen sehr großen und besonders faszinierenden Zeitraum. Überall in der Geschichte der Menschheit findet man grandiose menschliche Leistungen. Nicht nur die Philosophen haben die Welt zu allen Zeiten und in allen bewohnten Gebieten verändert, sondern auch Bauleute, Handwerker und Künstler. Wir beginnen mit den ersten menschlichen Spuren in Afrika, schauen uns das älteste Heiligtum der Menschheit "Göbekli Tepe" an und lernen mit dem Zweistromland den Beginn unserer Zivilisation kennen. Auf Kreta finden sich die Anfänge Europas und in Derinkuyu lebten die Menschen unter der Erde. Weitere Reiseziele sind unter vielen anderen China, Italien, ausgewählte Weltwunder und die von den Römern zerstörte Hauptstadt der Daker: Sarmizegetusa. Anhand von Beispielen soll auch auf die ein oder andere eher absurde Deutung unserer Vergangenheit hingewiesen werden. Die Autoren des Freiberger Archivs für Zivilisationsforschung haben für dieses Buch zahlreiche Untersuchungen vor Ort und jahrzehntelange Recherchen durchgeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
VORWORT
Wir finden heute auf der Erde eine Vielzahl beeindruckender Relikte aus längst vergangenen Epochen. Die Pyramiden von Gizeh, die riesenhaften Steinstatuen der Osterinsel, die nur aus der Luft erkennbaren gigantischen Zeichnungen in der Wüste von Nazca oder der Transport tonnenschwerer Steine sind nur wenige Beispiele für Dinge, welche unmöglich von Menschenhand geleistet werden konnten. Oder doch?
Der konkrete Anfang der Geschichte unserer Zivilisation liegt möglicherweise in der Olduvai-Schlucht im Norden Tansanias. 1978 entdeckte die britische Archäologin Mary Leakey (1913 bis 1996) fossile Fußspuren von drei aufrecht gehenden Menschen des Typs Homo Habilis. Die Spuren entstanden vor 3,7 Millionen Jahren.
Zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat errichteten die Sumerer bereits vor 8.000 Jahren die erste Zivilisation auf unserem Planeten. Sie waren das Volk mit dem größten Beitrag zur Menschheitskultur. Die Sumerer erfanden als erste die Schrift, womit die Menschheit aus der Vorgeschichte in die Geschichte trat. Sie waren die ersten bekannten Städtebauer und die ersten Staatsgründer. Sie erfanden das Rad und spielten tausende Jahre die Rolle von Pionieren in der Weltgeschichte.
Allen Zweiflern zum Trotz haben die Menschen bis heute mit viel Geist und Kraft, unter ständiger Auseinandersetzung mit verschiedensten Widrigkeiten der Natur und im Kampf gegen Mitbewerber, unsere blühende Zivilisation aufgebaut, so, wie wir sie heute vorfinden.
Die Beispiele in diesem Buch spiegeln Freud und Leid der Menschen wieder und deren Gefühle, welche sich auch in der Gegenwart nicht viel von denen unserer Vorfahren unterscheiden. Schließlich sind alle Bewohner der Erde in Vergangenheit und Gegenwart durch Blutsbande miteinander verbunden.
Zahlreiche Beispiele in der Menschheitsgeschichte bieten auch eine Erklärung für die Herkunft scheinbar unglaublicher Relikte, welche die Zeiten bis heute überdauert haben.
Bei unseren Betrachtungen soll aber auch an die Faszination der untergegangenen Welten erinnert werden.
Die Faszination der Vergangenheit
Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir vor einem Bauwerk aus längst vergangenen Zeiten standen und eine Weile brauchten, um zu verstehen, dass dieses Wunder von unseren Vorfahren geschaffen wurde. Ein Nachschauen in unseren Geschichtsbüchern erklärt dann, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen diese Leistungen einst vollbracht wurden, und die Sache wird zunächst noch unverständlicher.
Neben den sachlichen Erklärungen in diesem Buch wollen wir keinesfalls die Faszination vergangener Welten vergessen. Genau diese ist der Grund, warum die hier ausgewählten Themen heute immer wieder zahlreiche Menschen beschäftigen und sie über Vergangenheit und Gegenwart nachdenken lassen.
Natürlich ist es wichtig, nach vorn zu schauen. Doch würden wir nicht engstirnig handeln, wenn wir die Jahrmillionen langen Erfahrungen der Menschen bei der Auseinandersetzung mit der Natur nicht für unsere Zukunft nutzen?
Es entspricht dem menschlichen Wesen, dass uns dies nicht immer leicht fällt. Oft glauben wir, dass gerade jetzt und von uns der „Stein der Weisen“ gefunden wird.
„Die Erforschung der Vergangenheit fasziniert nicht nur, um die Toten wieder lebendig werden zu lassen, sondern auch, damit das, was vorüber ist, dennoch nicht für immer verloren sei. Damit aus den Trümmern der Zeitalter, den untergegangenen Kulturen etwas gerettet werde und so die Gegenwart durch die Vergangenheit mehr Farbe bekommt und wir für die Zukunft mehr Mut. Die Forschungen nach den uralten Kulturen, nach der versunkenen Zivilisation, sind nur eine Abzahlung auf das, was wir all den Menschen schulden, die im Laufe von Jahrtausenden die Erde für uns formten“, schrieb Werner Keller (1909 bis 1980) in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts.
Der allgemein zu ziehende Schluss ist vielleicht für manchen enttäuschend, für andere eher tröstend: Glück und menschliches Leid, Freude und Trauer, all die Emotionen, die unser Leben zum großen Teil ausmachen, waren vor Jahrtausenden die gleichen wie heute. Wer wagt zu behaupten, dass wir heute glücklicher leben, als die alten Griechen oder Römer, dass wir besser essen oder besser schlafen? In ihrer Seele ähneln uns die längst Verstorbenen viel mehr, als wir oft vermuten.
Wir wünschen Euch mit diesem Buch viel Freude bei der Entdeckung neuer Blickwinkel auf unser aller Geschichte.
Zur Geschichte des Freiberger Archivs für Zivilisationsforschung
Peter Hertel gründete 1973 das Archiv für Zivilisationsforschung in Freiberg. Mit einer umfangreichen Bilder- und Dokumentensammlung sowie Interviews zu den Themen Archäologie und Kulturgeschichte beinhaltet es ein breites Spektrum an moderner und historischer Literatur. Neben Texten wurden auch Fotos und Grafiken archiviert. Damit konnte der Grundstein für zahlreiche Publikationen von 1974 bis heute gelegt werden. Umfangreiche Veröffentlichungen in Druckmedien, über 20 Multimedia-Vorträge mit rund 300 Veranstaltungen pro Jahr, Reisen in zahlreiche Länder und die filmische Umsetzung ausgewählter Themen gehören dazu. Seit 2016 veröffentlicht das Archiv für Zivilisationsforschung wöchentlich Artikel auf der eigenen Facebook-Seite.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
3,7 Millionen Jahre v. Chr.
Wo liegen die Anfänge unserer Zivilisation?
1 Million Jahre v. Chr.
Die steinzeitlichen Gesichtssteine von Max Seurig
8000 v. Chr.
Göbekli Tepe – Ältestes Heiligtum der Menschheit
6000 v. Chr.
Sumer – Wo unsere Zivilisation begann
3850 v. Chr.
Malta hat die ältesten Tempel
3000 v. Chr.
Die Pyramiden von Bosnien – was ist wirklich dran?
3000 v. Chr.
Die Palmblattbibliotheken – was verraten sie uns?
2500 v. Chr.
Der Turm zu Babel – zwischen Mythos und Wahrheit
2500 v. Chr.
Die ungewöhnliche Sabu-Scheibe aus Sakkara
2000 v. Chr.
Die früheste europäische Hochkultur lebte auf Kreta
1000 v. Chr.
Ephesos – eine bedeutende antike Stadt in Kleinasien
Um 1000 v. Chr.
Derinkuyu – ein Leben untertage
600 v. Chr.
Die Chinesische Mauer – ein gewaltiges Bauwerk
520 v. Chr.
Die Gräber der Etrusker
500 v. Chr.
Der Boitiner Steintanz – eine heilige Stätte?
360 v. Chr.
Atlantis – war es immer nur ein schöner Gedanke?
Etwa 300 v. Chr.
Zahnschmerzen – ein uraltes Leiden der Menschheit
280 v. Chr.
Der Leuchtturm von Alexandria – einst ein Weltwunder
250 v. Chr.
Ostia Antica – der Hafen des antiken Roms
146 v. Chr.
Karthago – die Vernichtung einer Stadt
100 v. Chr.
Aphrodisias – Stadt der Göttin der Liebe
ZEITENWENDE
50
Pont du Gard – ein römisches Viadukt
106
Sarmizegetusa – die verlorene Hauptstadt der Daker
125
Hadrianswall – eine römische Grenze in Britannien
200
Das Dodekaeder – was hat man damit bloß gemacht?
500
Buritaca – das vergessene Volk der Tayrona
600
Kachina – die bunten Ahnen der Hopi-Indianer
800
Wie bauten die Khmer über 1.000 Tempel?
1150
Die Externsteine – wie Menschen Mysterien erschaffen
1450
Das Voynich-Manuskript – was steht darin?
1500
Wer kartierte die Antarktis vor ihrer Entdeckung?
1722
Europäer entdecken die Osterinsel
1910
Pierre Loti – ein Reisender durch seine Zeit
1940
Bayan-Kara-Ula – eine fremde Kultur in den Bergen Chinas?
1960
Pater Crespi und die imaginären Goldschätze
2011
Sakkara – die Stufenpyramide ist wieder zugänglich
2020
Die uralte Siedlung Hasankeyf weicht einem Staudamm
2020
Tutanchamun und die Suche nach weiteren Gräbern
2020
Ägypten eröffnet das weltgrößte Archäologische Museum
Weisheiten unserer Vorfahren
Die Autoren
Veröffentlichungen des Archivs für Zivilisationsforschung Freiberg/Sachsen
Mit der zeitlichen Einordnung der Themen möchten wir auf die, weltweit gesehen, kontinuierliche Entwicklung der Menschheit hinweisen.
Die Kapitel sind in sich geschlossen und können separat gelesen werden.
ACHTUNG: Die angegebenen Jahreszahlen sind oft nicht bis zur letzten Konsequenz belegbar. Sie resultieren aus Schätzungen oder geben bei Fakes das Jahr der Veröffentlichung an.
3,7MILLIONENJAHREV.CHR.
WOLIEGENDIEANFÄNGEUNSERERZIVILISATION?
An unserem Anfang war nicht viel los auf dem Planeten Erde.
Liebe Freunde, wir wollen in diesem neuen Buch einen Streifzug durch die menschliche Kulturgeschichte unternehmen. Da bietet es sich ja an, genau am Anfang zu beginnen. Aber wann war das? Darüber gibt es, wie so oft, sehr unterschiedliche Auffassungen.
In der Paläontologie wird seit vielen Jahren der Zeitpunkt vor 3,7 Millionen Jahren favorisiert. Inzwischen gibt es weitere ältere Daten. Doch das würde hier zu weit führen.
Wenn wir unsere Reise vor 3,7 Millionen Jahren beginnen, so ist das, gemessen an ein paar tausend Jahren, die wir gerade noch so überblicken können – schon eine ewig lange Zeit.
Dennoch kann man den Zeitpunkt durchaus als Beginn des Aufbaus unserer Zivilisation betrachten. Natürlich waren die Anfänge nicht besonders spannend und bleibende Relikte, außer ein paar Knochen und einem Fußabdruck, wurden nicht gefunden.
Die berühmt gewordene Olduvai-Schlucht beginnt etwa 20 Kilometer nordwestlich des Ngorongorokraters und gehört zum ostafrikanischen Grabenbruch.
Foto: Wegmann 2012
Deshalb wollen wir uns in diesem ersten Kapitel auf die Entdeckungen der Familie Mary und Louis Leakey beschränken.
Die beiden britischen Forscher arbeiteten in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts in der in Tansania gelegenen Olduvai-Schlucht. Hier entdeckten sie prähistorische Steinwerkzeuge und Überreste von Menschen, die offenbar den ersten Schritt zum Homo sapiens bereits erfolgreich gegangen waren.
Es ist ein Canyon, der die östlichen Ebenen der Serengeti und die umliegenden Hänge des Grabenbruchs entwässert. Die Schlucht hat eine Länge von knapp 50 Kilometern und ist bis zu 100 Meter tief. Der Olduvai-River hatte sich in Tausenden von Jahren tief in die Landschaft gegraben. Dabei legte er insgesamt sechs Ablagerungsschichten verschiedener Erdzeitalter und Spuren menschlicher Existenz frei. Und so kamen zahlreiche versteinerte Überreste von Tieren und prähistorische Werkzeuge menschlicher Vorfahren, die sich seit Millionen von Jahren in der Erde befanden, zum Vorschein. Heute findet man hier noch, direkt an der Oberfläche, zahlreiche versteinerte Tierknochen.
1931 kam das britische Anthropologen-Ehepaar Mary und Louis Leakey in das Gebiet.
Foto: Ventertours
Schnell fanden die Leakeys eine Vielzahl an prähistorischen Steinwerkzeugen. Dadurch konnten sie den Gebrauch von Werkzeugen nachweisen, was als erster und wichtiger Schritt zur Zivilisierung des Menschen betrachtet wird. Zahlreiche Funde an Faustkeilen und steinernen Speerspitzen bestätigten immer wieder ihre Hypothese.
Die große Sensation gelang Mary Leakey 1959, als sie einen Schädel fand, der noch ziemlich intakt war und in dessen Oberkiefer sogar noch Zähne steckten. Er war rund zwei Millionen Jahre alt und bekam den Namen Boisei. Es war der bis dahin älteste Fund eines Hominiden, also eines menschenähnlichen Fossils. Er bekam den wissenschaftlichen Namen Australopithecus africanus.
1960 fand der Sohn der Leakeys, Jonathan, die Handknochen des Australopithecus.
Foto: Universität Zürich, Peter Schmid
Im Jahr 1978 gelang Mary Leakey ein weiterer spektakulärer Fund. Etwa 45 Kilometer südlich der Olduvai-Schlucht, in Laetoli, fand sie fossile Fußspuren von drei aufrecht gehenden Individuen der Hominiden.
Grafik nach: Wikimedia Commons, 2012
Die Spuren, deren Alter auf etwa 3,7 Millionen Jahre geschätzt werden, stammen möglicherweise von einer Familie. Man geht davon aus, dass die beiden Erwachsenen eine Körpergröße von 1,20 bis 1,50 Meter hatten. Vermutlich gingen diese Vormenschen über die Asche des heute erloschenen Makarot-Vulkans, wo die Fußabdrücke von der Asche späterer Vulkanausbrüche überdeckt wurden. Heute sind sie konserviert, um sie weiter zu bewahren.
Nach unserer Kenntnis handelt es sich bei den Olduvai-Funden um die ältesten Hinweise auf die Existenz von aufrecht gehenden und Werkzeug benutzenden Menschen.
Die Forschungen in der Olduvai-Schlucht gehen heute noch weiter. Für interessierte Besucher bietet das kleine Museum am Rand der Schlucht viel Informationen.
Das war vermutlich der Anfang, schauen wir weiter, was daraus entstand.
1MLLIONJAHREV.CHR.
DIESTEINZEITLICHENGESICHTSSTEINEVONMAXSEURIG
Wie man eine Laune der Natur „wissenschaftlich“ untersuchen kann.
Der Dresdner Forscher Max Seurig (1922–2016) arbeitete als Pädagoge in einer Dresdner Reha-Einrichtung. Bis zu seiner Rente und danach ganztägig war seine Berufung die Erforschung alter Steinzeitkulturen und die Entschlüsselung großer mathematischer Zusammenhänge zwischen Astronomie und Steinzeit.
Max Seurig (rechts) beim Erfahrungsaustausch mit dem Frankfurter Physikprofessor Dr. Herbert Bock im Jahr 1982.
Foto: Peter Hertel
Wir haben Max Seurig mehrfach in Dresden besucht, seine Sammlungen und mathematischen Schlussfolgerungen waren immer beeindruckend. Da existierten zunächst die sogenannten Gesichtssteine. Das sind Steine unterschiedlichen Materials von einigen Zentimetern bis zu einem Meter. Zugegeben, man muss die Steine ein wenig drehen, auf den Lichteinfall achten, doch dann kommen die merkwürdigsten Köpfe zutage. Inzwischen wird so etwas weltweit gesucht und mancher Felsen wurde schon so gedeutet.
Auf Kreta entdeckte beispielsweise sein Kollege Fritz Will (1937–2017) den liegenden Zeus auf einem großen Bergrücken.
Max Seurig hat in seiner Sammlung eine große Anzahl von derartig geformten Steinen zusammengetragen. Sie sind von wenigen Zentimetern bis über einen Meter groß.
„Möglicherweise war das Territorium des heutigen Dresdens schon vor Jahrtausenden eine Stätte der Kunst und Wissenschaft“, war der Forscher bis an sein Lebensende überzeugt. Mit Akribie und Verbissenheit forschte er sein Leben lang und baute seine Bibliothek immer weiter aus. Dabei und bei seinen Veröffentlichungen wurde er von seinem Partner H. Werner Baumann aus Bad Godesberg unterstützt.
Seurigs Untersuchungen führten das Mitglied der Palitzsch-Gesellschaft auch nach Rügen, Mecklenburg-Vorpommern und natürlich Dresden. Durch exakte Vermessung und Auswertung der Winkelverhältnisse vermutete er prähistorisches Astronomie-Wissen, welches sich auf den Tierkreis und die Planeten bezog. Nach unseren Vermessungen der Steinkreisanlage in Boitin (Mecklenburg, 1979) errechnete Max Seurig verblüffende Zusammenhänge. Allerdings hatten wir mehrfach den Verdacht, dass einige Zahlen angepasst wurden.
Seurigs größte Sorge war die fehlende Anerkennung der Altertumsforscher. „Ihnen fehlt das archäologische Fundumfeld für Ihre Gesichtssteine“, warfen die Dresdner Archäologen Seurig mehrfach vor.
Manchmal wird unsere Seele auch von Dingen begeistert, die nicht so ganz greifbar sind.
8000V.CHR.
GÖBEKLITEPE–ÄLTESTESHEILIGTUMDERMENSCHHEIT
Der Glaube des Menschen war von Anfang an eine große Triebkraft.
Die Reflexion menschlicher Vergangenheit brachte in den vergangenen 100 Jahren vor allem eine Erkenntnis: Es ist alles viel älter, als man bislang vermutete.
Die Tempel auf der Insel Malta entstanden um 3800 v. Chr., Stonehenge in England um 3000 v. Chr. und die Cheopspyramide in Ägypten wurde um 2600 v. Chr. errichtet. Das haben noch vor 100 Jahren nur wenige Menschen gewusst.
Der Pfeil zeigt die Lage von Göbekli Tepe an. Südwestlich befindet sich die 15 Kilometer entfernte südostanatolische Stadt Şanlıurfa. Im westlichen Teil der Karte beginnt das Mittelmeer.
Mittlerweile liegt der „Altersrekord“ bei einer Anlage in der Türkei. Das Kultzentrum von Göbekli Tepe in Südanatolien, das wir in diesem Kapitel vorstellen möchten, stellt bislang die anderen Bauwerke noch weit in den Schatten.
Der Göbekli Tepe (zu deutsch: bauchiger Hügel) ist ein prähistorischer Fundort. Er liegt auf dem mit 750 Metern höchsten Punkt der lang gestreckten Bergkette von Germuş. Es handelt sich um einen, durch wiederholte Besiedlung entstandenen, Hügel mit einer Höhe von 15 Metern und einem Durchmesser von rund 300 Metern.
Die megalithischen Strukturen von Göbekli Tepe sind ein einmaliges Zeugnis dieser Zeit.
Foto: Nico Becker (DAI)
Entstanden zu einer Zeit, als aus Jägern und Sammlern sesshafte Ackerbauern wurden, bieten die Strukturen einzigartige Informationen über das Leben vor über 9.000 Jahren. Die archäologische Stätte wurde 2018 als UNESCO-Welterbe anerkannt.
Auf einer Fläche von knapp einem Hektar richteten die Menschen rund 200 T-förmige Kalksteinsäulen von mehr als vier Meter Höhe auf. Sie stehen in mehreren Kreisen beisammen und umringen jeweils zwei besonders große Säulen von sieben Meter Höhe. Einzelne Pfeiler sind mit stilisierten Köpfen, Armen und Händen versehen. Sie stellen vermutlich Wesen wie Ahnen, Dämonen oder Götter dar.
Der deutsche Erforscher der Anlage, Klaus Schmidt, arbeitete ab 1995 als Leiter der Ausgrabungen am Gürcütepe und am Göbekli Tepe.
Foto: Andreas Müller
1999 habilitierte Schmidt an der Universität Erlangen, wo er ab 2000 als Privatdozent am Institut für Ur- und Frühgeschichte tätig war. Von 2001 an war er Referent für prähistorische Archäologie Vorderasiens bei der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Schmidt war seit 2006 korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts.
Besonderes Aufsehen erregten die Ausgrabungen am Göbekli Tepe nach der Veröffentlichung des Buches „Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger“.
Klaus Schmidt war mit der türkischen Archäologin Çiğdem Köksal-Schmidt verheiratet. Er starb tragischerweise im Alter von 60 Jahren während eines Badeurlaubs an der Ostsee.
Die Monolithe sind mit Tierreliefs oder abstrakten Piktogrammen verziert.
Foto: Klaus Schmidt
Diese Zeichen sind zwar keine Schriftzeichen, aber vielleicht allgemein verständliche heilige Symbole, wie man sie auch in jungsteinzeitlichen Höhlen fand. Die T-förmigen Pfeiler sind aus einem Stück gehauen.
Klaus Schmidt interpretierte sie als „die Verkörperung geheimnisvoller Wesen“. In den Querbalken sieht er aber nicht Arme, sondern den Kopf mit vorspringendem Kinn und Hinterkopf in der Seitenansicht, was bedeuten würde, dass die im Kreis stehenden Figuren nach innen auf die zwei mittleren Pfeiler blicken. Diese Deutung wird dadurch unterstützt, dass bei einigen der T-Pfeiler an den Seiten Arme und Hände als Relief zu erkennen sind. Die sehr sorgfältig bearbeiteten Darstellungen zeigen Löwen (oder Tiger oder Leoparden), Stiere, Keiler, Füchse, Gazellen, Schlangen, andere Reptilien, Geier, Kraniche, Ibisse und Skorpione.
Über viele Jahre arbeiteten hunderte Menschen auf dieser vermutlich ersten Großbaustelle der Weltgeschichte. Das Bild zeigt Vorstellungen über die Möglichkeiten des Baus dieser Anlage.
Zeichnung: Hergün Taze
Vielleicht erfanden die Menschen dabei sogar die Arbeitsteilung: Baumeister entwarfen zunächst die Anlage des Heiligtums, dann schlugen Arbeiter die Stelen mit Faustmeißeln aus dem Kalksteinbruch unterhalb des Hügels. Transporteure beförderten die bis zu 50 Tonnen schweren Säulen hinauf, wahrscheinlich mit reiner Muskelkraft, vielleicht auch schon mithilfe von Rollschlitten. Es gab sicher Vorarbeiter, die die Arbeitergruppen anleiteten.
Anschließend verzierten Künstler die Stelen mit Reliefs wilder Tiere, mit springenden Gazellen, Füchsen, Wildschweinen, aber auch mit Schlangen, Kröten und Spinnen.
Göbekli Tepe enthält megalithische Strukturen aus dem 10. und 9. Jahrtausend v. Chr.. Die Säulen in rund 20 Kreisen wurden durch geophysikalische Messungen gefunden. Sie haben eine Höhe von bis zu sieben Metern und wiegen bis zu zehn Tonnen. Einige Säulen sind mit Stein-Schnitzereien in Form von Tieren und abstrakten Piktogrammen verziert. Drei Säulen befinden sich noch in der Erde. Die Größte von ihnen liegt auf dem nördlichen Plateau. Sie hat eine Länge von sieben Metern und ihre Oberseite eine Breite von drei Metern. Das Gewicht wird auf bis zu 50 Tonnen geschätzt.
Die neolithische Revolution am Übergang zum Jungpaläolithikum fand vor etwa 12.000 Jahren erstmals im Gebiet des „Fruchtbaren Halbmonds“ statt. Anatolien gehört zu diesem Gebiet. Noch bevor der dörfliche Hausbau archäologisch belegt ist, gab es in dieser Region bereits monumentale Tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe. Das beweist, dass die Menschen über die lebenswichtigen Tätigkeiten hinaus, das Bedürfnis und die technischen Voraussetzungen hatten, solch eine Kultanlage zu bauen und zu nutzen.
Die Erfindung der Landwirtschaft hatte Menschen die Möglichkeit gegeben, Siedlungen zu bauen und ihre Zivilisation, einschließlich Kunst und Religion, zu entwickeln. Doch es gibt bisher keine Beweise für Landwirtschaft in der Nähe des Göbekli Tepe. Daraus lässt sich folgern, dass die Anlage vermutlich nur für religiöse Zwecke aufgesucht wurde.
„Wir haben viele zeitgenössische Stätten, die Siedlungen von Jäger-Sammlern sind. Göbekli Tepe war eine Zuflucht für Menschen, die in diesen Siedlungen lebten“, stellte Klaus Schmidt fest.
Es wird davon ausgegangen, dass die Bauwerke für Rituale genutzt und zu einem noch nicht sicher erforschten Zeitpunkt aufgegeben und zugeschüttet wurden. Auf dem so entstandenen Hügel wurden im 9. Jahrtausend v. Chr. kleinere, rechteckige Bauten errichtet, die ebenfalls T-förmige Steinsäulen aufweisen.
Nach der endgültigen Aufgabe des Ortes am Ende der frühen Jungsteinzeit verschwanden auch diese Bauten unter dem Boden, der erst in jüngerer Zeit landwirtschaftlich genutzt wurde. Seit 1995 konnte ein kleiner Bereich der archäologischen Stätte in dem etwa 130 Hektar großen Gebiet durch Ausgrabungen freigelegt werden. Göbekli Tepe wird als Langzeitprojekt des Deutschen Archäologischen Instituts ausgegraben.
Bei diesen Arbeiten wurde bisher nur reichlich ein Prozent des Areals freigelegt. Eine vollständige Ausgrabung ist im Moment nicht vorgesehen.
Archäologen, Beleuchter und Fotografen haben die einmalige Anlage ins rechte Licht gesetzt.
Foto: Vincent Musi
Für die Zukunft ist geplant, die Fundstücke vom Göbekli Tepe nicht nur museal zu präsentieren, sondern den Ort samt seiner Umgebung in Form eines Archäologieparks der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dadurch soll nicht zuletzt erreicht werden, dass der Ort in seiner Ursprünglichkeit bewahrt wird.
Der Tempel von Göbekli Tepe hat neben seinem religiösen Zweck auch Bedeutung als vermutlich erstes gemeinsames Bauprojekt von Menschen.
Literatur:
Klaus Schmidt, Sie bauten die ersten Tempel
Das rätselhafte Heiligtum am Göbekli Tepe, C.H. Beck, 2016
6000V.CHR.
SUMER–WOUNSEREZIVILISATIONBEGANN
Ist ein funktionierendes Staatssystem Voraussetzung oder Ergebnis einer Hochkultur?
Während die ersten aufrecht gehenden Menschen, die schon Werkzeug verwendeten, bereits vor 3,7 Millionen Jahren in Afrika lebten, war es in Sumer, dem Land zwischen den Strömen, in dem sich schon vor 8.000 Jahren die erste Zivilisation entwickelte. Wir sind hier wieder in dem Bereich des sogenannten fruchtbaren Halbmondes. Ideale Bedingungen für die Landwirtschaft ermöglichten den Beginn der Sesshaftigkeit.
Das historische Gebiet der Sumerer befand sich zwischen den Strömen Euphrat und Tigris. Heute gehört es zu den Staaten Iran und Irak.
In diesem Gebiet schufen die Sumerer den vermutlich größten Beitrag zur Entwicklung unserer Kultur. Sie erfanden die Schrift, womit die Menschheit aus der Vorgeschichte in die Geschichte trat. Sie waren die ersten bekannten Städtebauer und die ersten Staatsgründer. Die Sumerer haben die Mathematik entwickelt. Unsere Stundenzählung und die Unterteilung des Kreises in 360° stammen aus Babylon. Die Anfänge der Astronomie sind ebenfalls in Sumer zu finden. Sie kannten bereits einige Planeten. Sie gelten als die Erfinder des echten Gewölbes und des Rades. Sie gründeten mit Ur, Uruk und Lagasch die ältesten bekannten Städte mit Monumentalbauten, insbesondere der für Mesopotamien typischen Zikkurate, den sumerischen Tempeltürmen und Vorläufern der ägyptischen Pyramiden.
Das Land der Sumerer war der südliche Teil der Kulturlandschaft des mesopotamischen Schwemmlandes, das sich zwischen der heutigen Stadt Bagdad und dem Persischen Golf erstreckt. In dieser Region vollzogen einst die Sumerer erstmals in der Menschheitsgeschichte den Übergang zu einer Hochkultur und legten damit den Grundstein für unsere Zivilisation.
Die Sumerer hätten ihren Erfolgsweg nicht gehen können, wäre ihnen nicht die Beziehung zwischen Leistung und sozialer Ordnung bekannt gewesen. Zahlreiche Gesetze und Verordnungen konnten das Gemeinwesen der Menschen über Jahrtausende immer wieder sichern.
Die ältesten Siedlungsreste stammen aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. Von da ab ist eine kontinuierliche Entwicklung nachzuweisen. Sie führte im späten 4. Jahrtausend v. Chr. mit der Gründung der Stadt Uruk zu ihrem ersten Höhepunkt. Aus dem frühen 3. Jahrtausend v. Chr. liegen schriftliche Quellen vor. Bekannt sind die Stadtstaaten Adab, Eridu, Isin, Kiš, Kullab, Lagaš, Larsa, Nippur, Ur und Uruk.
Das große Problem der sumerischen Landschaft war allerdings die Bodenversalzung, die durch die ständige Bewässerung mit salzhaltigem Wasser entstand. Sie war der Grund für den allmählichen Untergang dieser Kultur. Die Getreideerträge wurden in Sumer genau aufgeschrieben und bestätigten den Niedergang der Landwirtschaft und infolgedessen auch großen Teilen dieser Kultur. Konnten 2400 v. Chr. pro Hektar noch 2.400 Kilogramm Weizen und Gerste geerntet werden, so waren es 1700 v. Chr. nur noch 700 Kilogramm der salzresistenteren Gerste. Noch heute sind weite Landstriche wegen des hohen Salzgehaltes im Boden nur bedingt landwirtschaftlich nutzbar.
Im Zweistromland wurde 3.000 Jahre lang in Keilschrift geschrieben. Im Foto die Stiftungstafel zum Gedenken an die Restaurierung des Tempels von Ningirsu, erbaut von Gudea, Prinz von Lagasch, Mesopotamien, um 2150 v. Chr.
Foto: Tim Gernitz
Die Keilschrift sieht aus, als wären Vögel über den feuchten Ton gelaufen, fanden die ersten Entdecker. Das Schriftsystem wurde vom 34. Jahrhundert v. Chr. bis mindestens ins 1. Jahrhundert n. Chr. benutzt. Es setzt sich aus keilförmigen Einzelelementen zusammen, die sie durch Abdrücke von Griffeln mit dreieckigem Querschnitt im frischen Ton erzeugten. In der Keilschrift gibt es rund 600 Schriftzeichen.
Den Schlüssel zur Entzifferung fand der Göttinger Lehrer Georg Friedrich Grotefrend zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Den endgültigen Durchbruch bei der Entzifferung brachte dann im Jahre 1837 die Entdeckung einer Inschrift des persischen Großkönigs Darius I. Der Brite Henry Rawlinson hatte sie auf einer Felswand bei Behistun im Iran gefunden. In der dreisprachig (babylonisch, elamisch und altpersisch) verfassten Nachricht hatte der Großkönig die Grenzen seines Reiches festgehalten.
Hammurapi I. war von 1792 bis zu seinem Tod 1750 v. Chr. der sechste König der ersten Dynastie von Babylonien und trug den Titel König von Sumer und Akkad. Im Bild die sitzende Person rechts.
Foto: Louvre
Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich vom Persischen Golf und dem Zagros-Gebirge bis zum Euphratbogen. Seinem Reich war keine lange Lebensdauer vergönnt. Schon während der Regierungszeit seines Sohnes Šamšu-iluna kam es zu Unruhen in Südmesopotamien und an den Grenzen erschien ein neues Volk, die Kassiten. Aus westlicher Richtung drangen fast gleichzeitig die Hethiter vor, die sich aber nach der Eroberung Babylons durch Muršili I. wieder zurückzogen.
Von Hammurapi I. stammt die Feststellung: „Weißt du nicht, dass die Felder das Leben unseres Landes sind?“