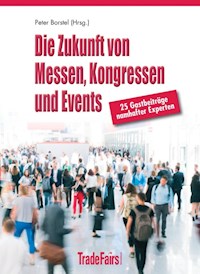
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie sieht die Zukunft von Messen, Kongressen und Events aus? 28 hochkarätige Autorinnen und Autoren* haben sich in 25 Gastbeiträgen geäußert und es ist eine spannende Sammlung entstanden – unterteilt in sieben Bereiche: Geschäftsmodelle, Veranstaltungsformate, Digitalisierung, Erwartungen von Zielgruppen, Unternehmensauftritte der Zukunft, Herausforderungen in der Live-Kommunikation und neues Denken. Eines wurde dabei deutlich: Die Voraussetzung für eine florierende Zukunft in der Veranstaltungsbranche sind gut. Es gibt viel, auf dem sich eine glänzende Zukunft aufbauen lässt. Und bei allem Negativen hat die Krise einen Vorteil: Sie nimmt ein bisschen vom Druck, auf Bewährtes setzten zu müssen und fördert wirkliche Innovationen. *Autorinnen und Autoren Victoria Alexander, Matthias Baldinger, Matthias Tesi Baur, Colja Dams, Wolfram N. Diener, Klaus Dittrich, Guido Fornelli, Uta Goretzky, Marc Halpert, Kai Hattendorf, Florian Hess, Ramona Kaden, Björn Kempe, Tanja Knecht, Michael Kruppe, Martina List, Wolfgang Marzin, Kati Rittberger, Steffen Ronft, Güray Saritas, Matthias Schultze, Urs Seiler, Olivier Sogno, Rudolf Sommer, Christian Ulrich, Vera Viehöfer, Gerd Weber, Jochen Witt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Borstel (Hrsg.)
Die Zukunft von
TFI-Verlagsgesellschaft
Herzlichen Dank an alle Autorinnen und Autoren, die sich mit leidenschaftlichem Einsatz dem Thema „Zukunft im Veranstaltungsbereich“ gewidmet haben!
April 2021
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Mein Foto wurde an der legendären „Penny Lane“ in Liverpool aufgenommen – am Vortag der letzten European Conference der UFI vor der Pandemie im Mai 2019 in Birmingham. Ich hatte seinerzeit die Messetagung genutzt und einen kleinen Abstecher gemacht. Besucht habe ich eine Stadt, die nach einem wirtschaftlichen Abstieg am Boden lag und sich neu erfinden musste. Das hat geklappt: Längst gilt Liverpool wieder als eine der hipsten Städte im Vereinigten Königreich.
Auch Messen, Kongresse und Events liegen aktuell im Frühling 2021 in Europa danieder. Natürlich hinkt der Vergleich. Denn die Gründe dafür sind nicht ursächlich wirtschaftlicher Art, sondern liegen in Verboten begründet, um das Virus zu bekämpfen. Hinterher, wenn alles vorbei ist, wird vieles genauso sein wie vorher, aber manches anders. Einige Entwicklungen lassen sich nicht zurückdrehen, sondern werden uns in Zukunft weiter begleiten.
Einerseits entsteht daraus die Frage, wie künftige Veranstaltungsformate aussehen werden. Hier spielen die Erwartungshaltungen der Teilnehmer und die digitalen Entwicklungen eine Rolle. Genauso interessant sind die Geschäftsmodelle, sprich, wie ausreichend Geld mit Veranstaltungen verdient werden kann.
Solche Zeiten des Wandels eignen sich gut für Bestandsaufnahmen und den Blick auf neue Perspektiven. Sicher, niemand hat eine Glaskugel auf dem Schreibtisch. Aber der Moment ist günstig, mal die Experten aus der Veranstaltungswirtschaft zu fragen, wie sie die Zukunft sehen. Schließlich beschäftigen sich wohl fast alle in der Branche intensiv damit, wie es weitergehen wird.
28 hochkarätige Autorinnen und Autoren haben sich in 25 Gastbeiträgen geäußert und es ist auf rund 240 Seiten eine spannende Sammlung entstanden – unterteilt in sieben Bereiche: Geschäftsmodelle, Veranstaltungsformate, Digitalisierung, Erwartungen von Zielgruppen, Unternehmensauftritte der Zukunft, Herausforderungen in der Live-Kommunikation und neues Denken. Auch blicken wir nach China, wo die klassische Messe aufgrund hoher Nachfrage weiter Konjunktur hat.
Eines wird dabei deutlich: Die Voraussetzungen für eine florierende Veranstaltungsbranche sind gut. Es gibt viel, auf dem sich eine glänzende Zukunft aufbauen lässt. Und bei allem Negativen hat die Krise einen Vorteil: Sie nimmt ein bisschen vom Druck, auf Bewährtes setzen zu müssen und fördert wirkliche Innovationen.
Digitalisierung und Technologie allein sind kein Selbstzweck. Entscheidend bleibt der Nutzen für die Teilnehmer, nur dann werden sie das jeweilige Format akzeptieren. Umgekehrt liegt darin auch eine große Chance, klassische Angebote umfassend zu erweitern und neue Zielgruppen zu erschließen. Veranstaltungen, die sich so neu erfinden, stärken auch ihren eigentlichen Kern: „Come together“ und „Get back“, um weitere Songs der Fab Four zu bemühen. Nur „Yesterday“ wird dagegen nicht mehr reichen.
Peter Borstel
GESCHÄFTSMODELLE
Die „Customer Centricity“ wird deutlich an Bedeutung gewinnen
JOCHEN WITT /DR. GERD WEBER / JWC, Köln
Messeformate verändern sich
Schon seit geraumer Zeit ist festzustellen, dass sich Messen und ihre Formate in Deutschland und Europa verändern. Die Ursachen sind vielfältig; sie liegen unter anderem im veränderten Kostenbewusstsein und Marketingverhalten der Aussteller: Neue Online-Marketingkanäle sind entstanden, die verstärkt Einfluss auf die Budgetierung haben. Viele Unternehmen denken darüber nach, ihre Budgets umzuverteilen und kleiner oder weniger auf Messen präsent zu sein. Ein aktuelles Beispiel liefert die Motorradsparte von BMW, die zukünftig auf eine Beteiligung an den Motorradmessen in Mailand und Köln verzichtet. Trotz nicht erfolgter Messeteilnahme und Konzentration auf das Online-Marketing war das letzte Geschäftsjahr für BMW-Motorrad das zweitbeste in der Geschichte. Nennenswerten Einfluss auf Messebeteiligungen hat zudem der wachsende Trend, Wertschöpfungsketten zu nationalisieren. Die Globalisierung ist rückläufig, das macht insbesondere ein Blick nach China deutlich: Das Land war in den letzten Jahren der maßgebliche Wachstumstreiber für die Weltwirtschaft. Mit der Hinwendung zu einer mehr national und auf heimischen Konsum ausgerichteten Politik wird diese Funktion abnehmen. Die Pandemie hat die zuvor beschriebenen Tendenzen lediglich beschleunigt.
Die rückläufige Globalisierung – verbunden mit den fortbestehenden Reisebeschränkungen oder der Reisezurückhaltung vieler Geschäftsleute wird sich insbesondere auf internationale Messen negativ auswirken. Die Luftfahrtbranche rechnet damit, dass im internationalen Geschäfts-Reiseverkehr das Niveau des Jahres 2019 (wenn überhaupt) erst nach Jahren wieder erreicht wird. Insbesondere bei stark international ausgerichteten Messeveranstaltungen werden Besucherzahlen daher tendenziell abnehmen – mit entsprechenden Folgen für die Ausstellerbeteiligungen. Zudem hat die Pandemie viele Unternehmen in eine Schieflage gebracht, das daraus resultierende verschärfte Kostenbewusstsein wird Einfluss auf die Messebudgets haben. Und: Viele Marktteilnehmer haben festgestellt, dass sich Dinge auch online abwickeln lassen, selbst wenn das physische Treffen dadurch nicht ersetzt wird. Auch wenn viele Aussteller und Besucher sagen “Wir müssen uns wieder persönlich treffen“ geht der Trend zu weniger Fläche pro Aussteller weiter: Stände mit einer Größe von mehreren tausend Quadratmetern werden bis auf wenige Ausnahmen verschwinden.
Der Trend, Ausstellungsflächen zu verkleinern, bestehtunseres Erachtens nach schon seit längerem. Nur hat in guten Zeiten vielen Ausstellern oft der Mut gefehlt, diesen Wunsch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Dafür gab es nicht zuletzt psychologische Gründe: Ein Fernbleiben oder ein verkleinerter Messeauftritt war mit der Sorge um aufkommende Negativ-Spekulationen verbunden. Jetzt sind die Schutzzäune eingerissen und die Corona-Krise liefert einen begründeten Anlass, um Flächen oder Beteiligungen zu reduzieren.
Und wenn Messen pandemiebedingt zweimal hintereinander nicht stattfinden können, besteht die Gefahr, dass die Teilnahme ganz in Frage gestellt wird. Oder es entwickelt sich eine neue Erkenntnis: Man muss gar nicht auf die Weltleitmesse, um nach China zu exportieren. Vielleicht reicht es aus oder ist es sogar erfolgreicher, wenn die chinesische Tochterfirma vor Ort in China ausstellt. Für die sogenannten Weltleitmessen ergibt sich dadurch ein Gefährdungspotenzial, der Trend geht zu mehr „Kontinentalisierung“ oder Regionalisierung. Neben der Frage nach der Zahl der Aussteller und der Fläche pro Stand werden damit auch die Beteiligungspreise unter Druck kommen: Bei nachlassenden (internationalen) Besucherzahlen sinken Kundennutzen und Zahlungsbereitschaften. Natürlich lassen sich diese Szenarien nicht pauschalisieren, die Auswirkungen werden je nach Branche, Veranstaltungscharakter, Region und Wettbewerb unterschiedlich sein – genauso unterschiedlich wie die zu findenden Antworten.
Omni-Channel-Geschäftsmodell gefragt
Das grundsätzliche Geschäftsmodell der Messewirtschaft – Angebot und Nachfrage physisch zusammenzubringen – wird sich nicht ändern: Lediglich die Art und Weise ändert sich. Das „Einmal-im-Jahr-Angebot“ wird zu einem „Omni-Channel-Geschäftsmodell“ entwickelt: Wir haben die Anforderungen schon vor circa zwanzig Jahren formuliert: „Erfolgreich wird dasjenige Messeunternehmen sein, welches Matchmaking- und Kommunikationsdienstleistungen unabhängig von Zeit, Ort und Medium anbietet“. Gleichzeitig wird es darauf ankommen, dass Veranstalter besser in der Lage sind, Kundenbedürfnisse zu erkennen und zu adressieren. Das Prinzip Zufall ist ein wichtiges Element einer Messeveranstaltung, die Veranstaltung darf aber nicht „nur“ Zufall sein. Das bisher praktizierte Verfahren, dass der Veranstalter die Hallen öffnet und anschließend nicht mehr weiß, wie Aussteller und Besucher interagieren, gehört der Vergangenheit an. Eine qualitative Kombination aus Digitalangebot und physischer Veranstaltung, verbunden mit Datenmanagement und künstlicher Intelligenz, wird Veranstalter in die Lage versetzen, spezifische Kundenbedürfnisse zu ermitteln und darauf aufbauend entsprechende Angebote mit höchstem Kundennutzen zu entwickeln. Online und Onsite wachsen zusammen. Ein Messebesuch könnte in der Praxis so aussehen: Ein Besucher meldet sich zu einer Veranstaltung an und erhält auf elektronischem Weg Informationen zu bestimmten Themen: Fortbildung, Innovationen oder Aussteller/Produkte, die ihn aufgrund seiner identifizierten Präferenzen interessieren sowie einen entsprechenden Besuchsplan für seinen Messeaufenthalt. Vor und nach der Messeveranstaltung werden, ausgerichtet an spezifischen Kundenbedürfnissen, ganzjährig „online“ und „onsite“ Produkte und Dienstleistungen angeboten. Das physische Treffen wird damit durch Komplementärangebote ersetzt, die Ausstellern und Besuchern einen tatsächlichen Mehrwert bringen. Entscheidend wird sein, die spezifischen Kundenbedürfnisse sowie die entsprechenden Zahlungsbereitschaften zu ermitteln.
Dass sich das Messegeschäft in den letzten Jahrzehnten wenig geändert hat, ist nachvollziehbar. Das Wachstum in der Branche war hoch, die Margen ebenfalls und in vielen öffentlich-rechtlich geführten Gesellschaften standen die Gesellschafter bei Bedarf mit finanzieller Unterstützung zur Verfügung. Es bestand daher kein Anlass für gravierende Veränderungen. Unseres Erachtens nach deutete sich allerdings schon länger ein Ende dieses Geschäftsmodells an, die Krise hat den Handlungsdruck dramatisch verschärft. Heute bedarf es einer neuen Denkkultur mit Auswirkungen auf Organisationen und benötigte Fähigkeiten. Der Verkauf von Standflächen ist nach wie vor wichtig, es erfordert aber Mitarbeiter(innen) und Teams, die die Integration von physischen und digitalen Konzepten verstehen und vermarkten können. Darüber hinaus sind neue Qualifikationen gefragt, wie zum Beispiel im Bereich Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Für die Messegesellschaften sind dies große Herausforderungen, da sehr unterschiedliche Kulturen aufeinanderstoßen und die Organisationen angepasst werden müssen. Insbesondere die angelsächsischen Gesellschaften haben hier in den letzten Monaten wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht.
Digitalisierung bietet große Chancen
Die Digitalisierung birgt nicht nur Risiken, sondern vor allem große Chancen. Veranstalter können 365 Tage im Jahr digital mit ihren Zielgruppen kommunizieren, die Kundenbindung wird intensiviert, die Reichweite um ein Vielfaches erhöht und die Gewinnung neuer Kunden vereinfacht. Auch lassen sich neue Umsatzquellen erschließen, wenn digitale Angebote einen Mehrwert bieten, der entsprechend „bepreist“ werden kann. Die bisher vielfach geübte Praxis, digitale Pakete für Aussteller verpflichtend anzubieten, ist nicht nachhaltig, sie wird häufig von den Ausstellern wie eine Steuer ohne Kundennutzen empfunden. Letztlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, einen wirklich nutzbringenden Beitrag zum Geschäftserfolg der Kunden zu leisten und sich das angemessen vergüten zu lassen. In jedem Fall wird die „Customer Centricity“ deutlich an Bedeutung gewinnen: Veranstalter haben mehr denn je zu verstehen, welche Dienstleistungsangebote von ihren Kunden geschätzt werden und wie die Zahlungsbereitschaften sind. Wird dies gut gemacht, werden die physischen Veranstaltungen gestärkt aus der Digitalisierung hervorgehen.
Messegelände müssen sich anpassen
Veranstaltungsgrößen von 250.000 Quadratmetern erscheinen in der Zukunft immer weniger realistisch. Solche oder ähnliche Größenordnungen können allenfalls durch mehrere Parallelveranstaltungen erreicht werden, die sich thematisch gegenseitig ergänzen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Messeinfrastruktur.
Geländegröße ist anders als in der Vergangenheit kein Vorteil mehr. Die Messegelände müssen sich an die neuen Entwicklungen anpassen. Zum einen geht es um das Thema Funktionalität. Großgelände müssen in der Lage sein, mehrere Veranstaltungen parallel zu organisieren, um auch nur annähernd die historische Auslastung zu erreichen. Verschiedene Eingangsoptionen mit direkten Zugängen zu Parkplätzen und ÖPNV sind dementsprechend neu zu gestalten/zu schaffen, ebenso wie dezentrale Konferenzflächen und Qualitätsflächen für Besucher. Zeit ist ein kostbares Gut und Besucher schätzen Messegelände der „kurzen Wege“. Shuttlebusse für Veranstaltungen mit 10.000 oder 20.000 Besuchern gehören der Vergangenheit an. In anderer Hinsicht wird es ebenfalls Anpassungen geben müssen. Bislang waren Messegelände darauf ausgerichtet, Besucher möglichst schnell an die Stände der Aussteller zu bringen. In der Praxis löst sich dieses klassische Schema auf, da Trennlinien verwischen: Besucher wollen nicht mehr nur Aussteller treffen, sondern auch andere Besucher. Nehmen wir eine Dienstleistungsmesse wie die Expo Real in München als Beispiel: Gespräche zwischen Besuchern untereinander machen hier sicherlich die Hälfte der Kontakte aus. Dieser Trend wird zunehmend auch auf anderen Messen spürbar werden, es wird die Herausforderung sein, solche Bedürfnisse durch Umgestaltung der „Hardware“ zu erfüllen, etwa durch das Schaffen geeigneter attraktiver Treffpunkte an oder in den Hallen.
JWC ist für zahlreiche Gesellschaften in Europa beratend tätig, unter anderem auch für Geländeeigentümer oder -betreiber. In rund 80 Prozent der Fälle sind wir uns mit den Auftraggebern einig, dass zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit von Geländen eine Qualitätssteigerung mit einer Quantitätsreduktion einhergehen muss. Trotzdem stellen wir verwundert fest, dass in einigen Fällen weiter ausgebaut wird, so als sei nichts passiert. Dabei kann mehr Qualität zum Teil ähnliche Effekte haben, etwa verhältnismäßig mehr erzeugbare Nettofläche bedeuten. Hier sollte spätestens die Corona-Krise ein Umdenken bewirken, eine Abkehr von der Maxime, unbedingt die bestehende Bruttoausstellungsfläche halten zu wollen.
Die Kernflächen attraktiver machen
Um Wettbewerbsvorteile zu generieren, sind Investitionen in die Attraktivität der Gelände-Kernfläche(n) erforderlich. Dazu gehört unter anderem die technische Ausstattung, mit deren Hilfe Veranstaltungen und Messegeschehen zusätzlich live im Netz stattfinden können. Sollen zum Beispiel 20 bis 30 Vorträge/Diskussionen gleichzeitig rund um den Globus übertragen werden, muss die technische Ausstattung angepasst werden. Kostenloses WiFi, das aufgrund günstigerer Mobilfunkverträge von den Teilnehmern ohnehin seltener genutzt wird, ist heute schon Standard. Attraktiver werden müssen ebenso die Food+Beverage-Angebote. Das traditionelle, fixe Restaurant ist vielleicht wirtschaftlich attraktiv, aber nur mit Mehraufwand in der Lage, flexibel auf die betreffenden Zielgruppen zu reagieren. Dienstleistungenwie etwa Abhängungen, bleiben wichtig, werden allerdings zukünftig keine Hauptrolle mehr spielen. Die Dimension der Elektroversorgung oder die Bodenlast in der Halle werden ebenso an Bedeutung verlieren, da nicht mehr so viele und große Maschinen in den Hallen präsentiert werden. Logistik ist weiterhin wichtig, das Transportvolumen wird allerdings geringer, da es künftig mehr um den persönlichen Austausch als um Produktpräsentationen geht.
Interessant bleibt die Frage, was mit nicht mehr benötigten Flächen passiert. Der aktuelle Immobilienboom könnte eine andere Nutzung attraktiv erscheinen lassen. Allerdings befinden sich nicht alle deutschen Messegelände in zentraler Citylage und zudem drückt die Anteilseigner die Sorge um die Umwegrentabilität. Die aktuelle Krise zeigt die große Abhängigkeit der Hotels, Restaurants und anderer vom Messegeschäft; hier sind erhebliche Investitionen getätigt worden. Diese „Stakeholder“ sind an der reinen physischen Präsenz möglichst vieler Messeteilnehmer interessiert, sodass Widerstände gegen Geländeverkleinerungen und Beharrungstendenzen in der Politik zu erwarten sind.
Die Autoren Jochen Witt / Dr. Gerd Weber
Jochen Witt ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensberatung JWC, Köln. Vor seiner jetzigen Position war Jochen Witt von 1998 bis April 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Während dieser Zeit betrieb er erfolgreich die internationale Erweiterung des Koelnmesse-Portfolios, den Ausbau des Servicegeschäfts und die Modernisierung des Messegeländes in Köln. Witt war von 1999 bis 2005 Vorsitzender des European Chapter der UFI und von Oktober 2006 bis Oktober 2007 UFI-Präsident. Vor seiner Tätigkeit bei der Koelnmesse war Witt in verschiedenen Positionen bei der BASF-Gruppe in Europa und Kanada tätig. Neben Deutschland hat Witt in Kanada, Russland, Sri Lanka und Oman gelebt.
Dr. Gerd Weber arbeitet seit Februar 2011 bei JWC. Er ist Partner und Seniorexperte für Strategie, Messeplanung, Geländeplanung und Geländeeffizienz. Zuvor war er von Januar 2000 bis Juli 2010 Geschäftsführer der Koelnmesse. Von 1991 bis 1999 arbeitete Weber als Projektmanager bei McKinsey & Co. Er studierte von 1986 bis 1990 Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen, wo er auch von 1994 bis 1997 promovierte.
VERANSTALTUNGSFORMATE
Hybrid Events – Live und Digital verschmelzen in einer spannungsgeladenen Einheit
COLJA DAMS
CEO Vok Dams Events & Live-Marketing, Wuppertal
Hybride Eventformate sind nicht neu. Durch die Covid-19-Pandemie katalysierten Entwicklungen von Digitalisierung haben Hybrid Events jedoch einen regelrechten Boost erlebt und spielen die zentrale Rolle im Live-Marketing. Während analoge und physische Live-Events vor allem durch direkten und persönlichen Kontakt und multisensuale Ansprache punkten, steht bei digitalen Formaten bisher meist die Reichweite im Fokus. Das ergibt sich vor allem daraus, dass digitale Formate in aller Regel orts- und zeitunabhängig genutzt werden und nahezu immer und überall verfügbar sind. Weitere Argumente sind Nachhaltigkeit (zum Beispiel die Reduzierung von Emissionen durch Reisen zu physischen Treffen), Effektivität und Effizienz (beispielsweise durch die Reduzierung der Reisezeit zu physischen Treffen) sowie Convenience (es ist bequemer die Veranstaltung auf dem eigenen Monitor zu verfolgen). Hybride Events und entsprechende Konzepte verbinden das Beste aus beiden Welten: Die Aspekte physischer Events (Multisensualität, persönlicher Dialog) und die Vorteile der digitalen Kommunikation (Reichweite, Nachhaltigkeit, Effektivität und Effizienz, Convenience) begegnen sich auf Augenhöhe. Als „Hybrid“ bezeichnet man etwas, das gebündelt, gekreuzt oder vermischt wird. In der Technik versteht man unter „Hybrid“ ein System, bei welchem zwei Technologien miteinander kombiniert werden. Dabei betont die vorangestellte Bezeichnung „Hybrid“ ein aus unterschiedlichen Arten oder Prozessen zusammengesetztes Ganzes. Die Besonderheit liegt darin, dass die zusammengebrachten Elemente für sich schon Lösungen darstellen, durch das Zusammenbringen aber neue erwünschte Eigenschaften entstehen können (Vgl. Wikipedia.de, Eintrag zu „hybrid“: https://de.wikipedia.org/wiki /Hybrid).
Und ebendies ist auch die Besonderheit von Hybrid Events. Es sind eben nicht nur Events, bei denen sich sowohl Live- als auch digitale Elemente finden, sondern es sind Eventformate, bei denen das Digitale mit dem physischen Vor-Ort-Erlebnis zu einem neuen Ganzen verbunden wird. Hat man in der Vergangenheit gern noch jederlei Einbindung von digitalen oder virtuellen Elementen in eine Veranstaltung, seien es Social Media-Posts oder digitale Abstimmungs-Apps, als hybrid bezeichnet, so zeigt sich heute, dass Hybrid Events weit mehr sind. Sie ermöglichen eine gleichzeitige Teilnahme vor Ort (physical attendance) und aus dem (Home-)Office (digital attendance), sie verschmelzen digitale mit Vor-Ort- und Live-Formaten zu einer neuen Einheit und ermöglichen echte Interaktionen zwischen Teilnehmenden und Veranstaltenden – unabhängig davon, ob diese physisch anwesend oder digital zugeschaltet sind. Damit haben Hybrid Events eine ganz neue Stufe in der Event-Evolution erreicht. Augenhöhe, Interaktion, Simultanität und Flexibilität sind die Kernbegriffe der neuen Hybrid Events. Durch die Kombination der unterschiedlichen Eigenschaften von „Live“ und „Digital“ lassen sich Synergien, aber auch ganz neue Veranstaltungsformte und Kommunikationsstrategien schaffen.
Auch wenn dies vielleicht zunächst einfach klingt, ist es in der Umsetzung doch ein großer und häufig unterschätzter Schritt. Hybrid Events benötigen ein Technik-Know-how, das ebenfalls als ein Hybrid zwischen IT und Eventtechnik-Expertise bezeichnet werden kann. Techniker*innen müssen die interaktiven Notwendigkeiten mit den digitalen Möglichkeiten durchdenken, entsprechende Zugänge sicherstellen, sodass eine zeitgleiche Kommunikation zwischen den Teilnehmenden vor Ort und vor den Bildschirmen ermöglicht wird. Auf dieser technischen Basis baut das Event-Konzept auf.
Legen diese technischen Voraussetzungen die Basis, so sind nun Eventspezialisten und Kommunikationsexperten gefragt. Denn ein Hybrid Event ist keine Aneinanderreihung von digitalen Format-Feuerwerken, sondern benötigt, mehr noch als ein klassisches Event, eine stringente Dramaturgie, eine smarte Storyline und durchdachte Formate. So stellt ein Hybrid Event neue und besondere Anforderungen an Eventdesigner und Konzeptioner. Hier stehen die Interaktionsmöglichkeiten und Involvierungsformate klar im Vordergrund. Ein Hybrid Event muss Augenhöhe zwischen den Teilnehmenden herstellen, egal, ob sie aus dem Homeoffice, dem Urlaubsort, dem Büro oder vor Ort teilnehmen – ihnen müssen gleichwertige Erlebnisse und Involvierungsmöglichkeiten geboten werden. Interaktion untereinander muss angeregt und ermöglicht werden, Involvement der Teilnehmenden eine aktive Auseinandersetzung mit den Kernbotschaften und Eventzielen forcieren. Dies erfordert neue Formate, neue Konzepte und ein Hybrid aus digitalen und Live-Formaten, das die Teilnehmenden immer wieder aktiviert und einbindet, sodass gar nicht erst die Gefahr aufkommt, dass sie sich als passive Empfänger*innen oder bloße Zuschauende zurücklehnen oder ablenken lassen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen, aber nicht nur, die Teilnehmenden an den Bildschirmen, die noch mehr als die Teilnehmenden vor Ort im „Working Mode“ bleiben und nebenher von eingehenden Emails und möglichen anfallenden Arbeitsaufträgen abgelenkt werden. Daher steht das Hybrid Event immer auch ein Stückweit in Konkurrenz zu den sonstigen Anforderungen an die Teilnehmenden und muss kontinuierlich und in verschiedenen Formatangeboten stets die Bereitschaft wecken, sich auf das Event einzulassen und aktiv teilzunehmen. Teilnehmende müssen also noch stärker in das Geschehen eingebunden werden, als es sonst die Regel ist. Hybride Events stellen die Zielgruppe und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Inhalte müssen an diese Bedürfnisse angepasst sowie spannend, unterhaltsam und professionell umgesetzt werden.
#1 Involvement benötigt integrierende Aktivierung
Um das Involvement der Teilnehmenden sicherzustellen und immer wieder zu ermöglichen, benötigt es Formate und Elemente, welche die Teilnehmenden sowohl im digitalen als auch im Raum vor Ort aktiv einbinden und zu Aktionen auffordern. Dabei muss die Integration von digitalen Elementen so in den Eventablauf eingebunden werden, dass die Unterschiedlichkeit zwischen Live und Digital aufgelöst wird. Die Grenzen zwischen digitaler und physischer Teilnahme vor Ort müssen aufgehoben werden, digitale und live Formate integrativ ineinander verwoben und als integrierend erlebt werden. Gelingt dies, so steigert das die Wirkung im Vergleich zu reinen Live-Events enorm und das weit über den eigentlichen Veranstaltungszeitraum hinaus. Denn digitale Elemente spannen auch lange nach der Veranstaltung einen kommunikativen Rahmen. Auf aktive Integration muss daher eins der Hauptaugenmerke von Hybrid Events liegen.
#2 Interaktion benötigt Augenhöhe
Wie bei physischen Events ist auch bei Hybrid Events die Partizipation der Teilnehmenden ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ein Hybrid Event muss deswegen immer wieder die Interaktion mit den Teilnehmenden suchen. Dies gelingt allerdings nur dann, wenn Augenhöhe der Teilnehmenden untereinander ermöglicht und immer wieder in den Fokus genommen wird. Dafür eignen sich Formate, welche die Interaktion zwischen digitalen und physisch-anwesenden Teilnehmenden nicht bloß ermöglichen, sondern immer wieder einfordern. Dies kann durchaus auf spielerische Weise geschehen. Da ein wesentlicher Aspekt von Live-Events auch immer der Wunsch nach Austausch und Netzwerken ist, gilt es gerade solche interaktiven Formate zu kreieren, die ebendies ermöglichen und fördern. Daher bieten sich Co-Creation-Formate besonders für Hybrid Events an.
Dabei ist eines besonders zu beachten: Die einzelnen Formate für die unterschiedlichen Teilnehmergruppen müssen dabei nicht gleich aber gleichwertig sein. So werden die Teilnehmergruppen in „physical attendance“ oder „digital attendance“ unterschiedliche Erlebnisse haben und unterschiedliche Formate nutzen, die besonders auf ihr gewähltes Teilnahmeformat einzahlen und die jeweiligen Themen in unterschiedlicher Form darstellen.
#3 Insight benötigt authentischen Mehrwert
Menschen gehen auch deshalb zu Veranstaltungen, weil sie dort besondere Insights und Einblicke gewinnen. Diesen Motivator gilt es auf Hybrid Events zu stärken, um auch die Aufmerksamkeit der digitalen Teilnehmenden zu binden. Ein gelungenes Hybrid Event bietet den Teilnehmenden exklusive Insights und einen spürbaren Mehrwert. Hierbei ist wichtig, dass der Exklusivitätscharakter zwar spürbar ist, immer aber auch zum Absender der Botschaften passen muss. Exklusivität, wie man sie vor einigen Jahren noch mit besonders ausgefallenen Buffets oder Dinner-Arrangements zu betonen versuchte, ist auf einem Hybrid Event fehl am Platz. Denn sie verschärft nur ein Ungleichgewicht zwischen den Teilnehmenden vor Ort und den digitalen Teilnehmenden. Ein Unternehmen muss überlegen, welche Art der Exklusivität gut zu Marke und Markenversprechen passt. Authentizität und Bodenständigkeit sind hier wichtige Stichworte. Es gilt, Exklusivität über besondere Insights, über Mehrwert in Unterhaltung oder Netzwerken, über Zugang zu Wissen oder Mitgestaltung zu schaffen. Gerade wenn auch digitale Teilnehmende zugeschaltet sind, liegt es nahe, dass sie Behauptungen oder Insights sofort online recherchieren und überprüfen, daher ist es bei Hybrid Events unabdingbar, dass die Storyline authentisch und passgenau zum Markenkern beziehungsweise dem Unternehmen entwickelt wird. Mehrwert ist mehr als nur Exklusivität – und diesen Mehrwert müssen Konzeptioner von Hybrid Events herausarbeiten und erlebbar machen.
#4 Potenziale heben
Anders als auf klassischen Events hinterlässt hybride Eventkommunikation im digitalen Raum unzählige Spuren, die durch den Einsatz von moderner Tracking- Software im Rahmen von zum Beispiel Live+ Marketing Automation zurückverfolgt, abgebildet und operationalisiert werden kann.
Auf der quantitativen Seite kann durch die Messung von Zugriffs-, Klick-, Zuschauer- und Downloadraten ein einfacher Überblick über die Effektivität der Kommunikationsbestandteile geschaffen werden. Hierdurch können Inhalte später bestmöglich ausgewertet und an die jeweilige Situation angepasst werden. Auf der qualitativen Seite bieten zum Beispiel Social Media Monitoring-Methoden eine Möglichkeit, Tonalität und Meinungen der Zielgruppe übersichtlich abzubilden, um so einen tieferen Einblick in die Welt und die Bedürfnisse der Interessentengruppen zu erhalten. Live+ Marketing Automation geht dabei noch einen Schritt weiter: Live+ Marketing Automation oder auch Data Driven Marketing ist die Erweiterung der Marketing Automation durch Daten von Events und Live-Marketing. Ziel ist erstens die intelligente Steuerung von Inhalten über alle Touchpoints hinweg, um aktuelle und potenzielle Kunden an jedem Punkt der Customer Journey individuell abzuholen. Zweitens die Transparenz im Sales-Funnel: über die lückenlose Dokumentation wird der Kampagnenerfolg messbar. Und drittens erfolgreiche, datenbasierte Post-Event-Kampagnen. Durch Hybrid Events lässt sich tiefgehendes Konsumentenwissen zusammentragen, welches unter nicht-hybriden Eventbedingungen im Verborgenen und damit nicht nutzbar geblieben wäre. Letztendlich trägt dies gleichermaßen zur Steigerung von Effizienz und Effektivität bei.
#5 Komplexität verlangt Öffnung
Eins wird zunehmend deutlich: es werden sich nur Systeme durchsetzen können, die eine einfache Integration bestehender, spannender Lösungen im Netz ermöglichen. Geschlossene Systeme kommen schnell an ihre Grenzen, sie laufen Gefahr der Vereinfachung oder werden sich an neue Entwicklungen kaum mehr integrativ anschließen lassen. Gerade hier aber liegt ein großes Potenzial, das kommunikativen Mehrwert schafft: durch Schnittstellen und Zusammenbringen unterschiedlicher Systeme und Lösungen, ganz neue Möglichkeiten zu erschließen. Es muss also möglich sein, die besten Anwendungen und Technologien zusammenzubringen und immer wieder neu zusammenfügen zu können. Auf „Open Platforms“ zusammengestellt können so die einzelnen Anwendungen maßgeschneidert ausgewählt und für den jeweiligen kommunikativen Nutzen zusammengebracht werden.
RoE – Return on Event
Die Integration von virtuellen Kommunikationsbestandteilen erfordert auf Seite der Unternehmen zwar zunächst ein Umdenken und Neu-Denken. Allerdings sind auch die Chancen deutlich, denn Hybrid Events generieren zusätzliche Intensität und Reichweite.
Der AutorColja M. Dams
ist Inhaber und CEO von Vok Dams worldwide, einer internationalen Agentur, die seit 1971 an der Spitze der internationalen Event- und Live-Marketing-Branche steht. Zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen bestätigen den Ruf von Vok Dams als eine der weltweit führenden Agenturen für Events, für Live- gleichermaßen wie für digitale Formate.
Wachstum durch Vertrieb: Zur Neuausrichtung von Messen
WOLFRAM N. DIENER
Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf





























