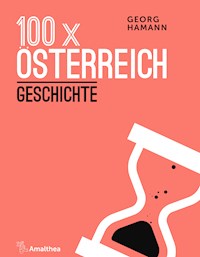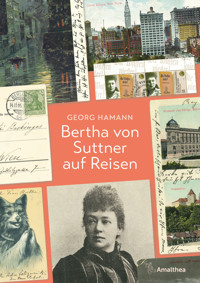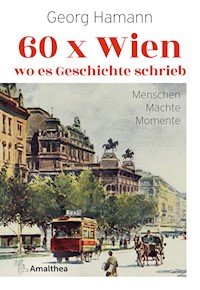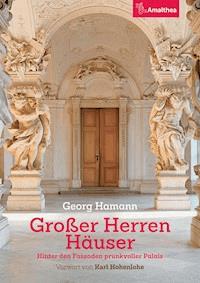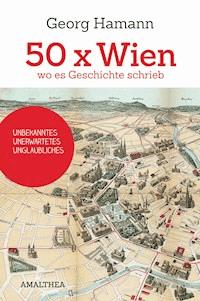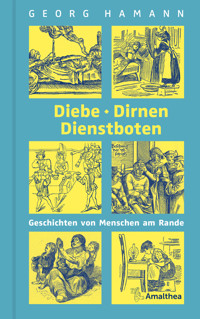
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Georg Hamann erzählt vom harten Alltag jener Menschen, die in der Geschichte oft vernachlässigt werden: Von jenen, die aufgrund von Herkunft, Beruf oder Krankheit am Rand der Gesellschaft standen und keine Möglichkeit hatten, je zu Ansehen oder Geld zu gelangen. Über Dienstbot:innen, Räuber, Henker, Soldaten, Prostituierte, Spitalsinsassen im Mittelalter, türkische Kriegsgefangene und Berufe, die heute nicht mehr geläufig sind: Köhler, Hausierer:innen, Bandlmacher oder Wurzelgräber:innen. Hamann gelingt es, uns mit erzählerischer Leichtigkeit in verschiedene Epochen zu versetzen. In 13 spannenden Kapiteln tauchen wir ein in die Zeit und das ungewöhnliche Leben jener Menschen, die über Jahrhunderte die Gesellschaft prägten, ohne die gebührende Aufmerksamkeit zu bekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Hamann
DIEBE, DIRNEN, DIENSTBOTEN
Geschichten von Menschen am Rande
GEORG HAMANN
Diebe ◆ Dirnen Dienstboten
Geschichten von Menschen am Rande
Mit 38 Abbildungen
INHALT
Vorwort
1 Krank und arm im Mittelalter – vom Alltag in Spital und Leprahaus
2 Die »Hübschlerinnen« von Wien – Prostitution im Spätmittelalter zwischen Toleranz und Ausgrenzung
3 Schinder und Scharfrichter – die »Ehrlosen« und ihr grausiges Handwerk
4 Der Kampf gegen das »Bettelunwesen« in Mittelalter und früher Neuzeit
5 »Mach mit der Türckhin wie du wilt, Sie ist dein« – das Los osmanischer Kriegsgefangener in Österreich
6 In der Infanterie Ihrer Majestät – Soldatenleben um 1760
7 Leben zwischen Not und Verbrechen – Räuberbanden um 1800
8 Kinder und Frauen in der Textilindustrie – von Maria Theresia bis in die Biedermeierzeit
9 Bandlkramer, Scherenschleifer und »Zigeuner« – unterwegs auf der Landstraße
10 Die Köhler des Piestingtals – vom einsamen Leben im Wald
11 Vom Wurzelgraben, Bergheuen und Grasrupfen – Frauenarbeit zwischen Alpenromantik und bitterem Alltag
12 Die Arbeiter der Semmeringbahn – ein österreichisches Prestigeprojekt im Schatten der Revolution von 1848
13 Im Dienst bei den »gnädigen Herrschaften« – weibliches Hauspersonal in Wien um 1900
Literaturverzeichnis
Personenregister
Abbildungsnachweis
Vorwort
Dieses Buch erzählt von jenen Menschen, die man einst als die »kleinen Leute« der Geschichte bezeichnete. Mit diesem im 19. Jahrhundert aufgekommenen Begriff wollte man verdeutlichen, dass sie nie aufgrund ihrer vornehmen Geburt, ihres Vermögens oder anderer Privilegien zu den wirkungsmächtigen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft zählten. Nie wurde ihnen eine Rolle als Akteure im Weltgeschehen zugestanden, sondern sie mussten tun, was man ihnen auftrug, ausführen, was andere befahlen. Selbstverständlich traf das auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu, und diese große Masse teilte sich wiederum in mehrere Klassen und Untergruppen auf. Auch diese separierten sich ihrerseits durch Standesdünkel und starre Milieugrenzen voneinander. Da gab es solche, die zwar nicht vermögend, aber dennoch als ehrbar und angesehen galten und solche, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Berufes völlig ins Abseits gedrängt waren. Letztere sollen im Mittelpunkt dieses Buches stehen. Prostituierte, Schinder, Scharfrichter, Bettler und Landstreicher etwa wurden Jahrhunderte hindurch als Randgruppen stigmatisiert und von der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen. Türkische Kriegsgefangene hielt man als Sklaven, Wurzelgräberinnen und »Jätergitschen« bildeten die soziale Unterschicht im Gebirge, und Köhler – so wichtig das Produkt ihrer Arbeit auch war – betrachtete man als schrullige Außenseiter. Doch selbst »anständige« Bürger waren nicht davor gefeit, durch eine gefährliche, ansteckende Krankheit wie die Lepra zu Almosenempfängern degradiert zu werden, ein Unfall konnte ganze Bauernfamilien ins Elend stürzen und eine Verwundung einen Soldaten in die Kriminalität absinken lassen. In Zeiten, da man keine Sozialversicherung kannte, keine effektive medizinische Versorgung und keine verlässliche staatliche Armenfürsorge, war es leicht, binnen kürzester Zeit ganz nach unten abzurutschen.
Es soll versucht werden, ein möglichst anschauliches Bild der Lebensumstände jener Menschen zu zeichnen. Am Beginn jedes Kapitels findet sich ein kurzer, kursiv gedruckter Abschnitt, in dem eine charakteristische Situation aus deren Alltag geschildert wird. Dabei sei ausdrücklich erwähnt, dass diese »erzählerischen« Texte keineswegs reiner Fantasie entspringen, sondern angelehnt sind an reale Geschehnisse. Alle Namen und persönlichen Umstände, die darin vorkommen, sind historisch verbürgt.
2Die »Hübschlerinnen« von Wien – Prostitution im Spätmittelalter zwischen Toleranz und Ausgrenzung
Endlich war der große Tag gekommen: Der Kaiser kehrte von seiner Krönung zurück. Schon seit Wochen hatte man in Wien von kaum etwas anderem mehr gesprochen, und es war während dieser Zeit sehr geschäftig zugegangen. Der Unrat wurde von den Straßen geschafft, jeder Platz gekehrt und jedes Haus festlich geschmückt. Die Stadt wurde herausgeputzt, so wie man es schon seit Jahren nicht gesehen hatte. Nahe der Burg errichtete man Brunnen, aus denen in Kürze weißer und roter Wein sprudeln sollte, anderswo baute man hölzerne Podeste zur Bewirtung von Festgesellschaften, und auf langen Tafeln richtete man Unmengen an gebratenem und gekochtem Fleisch für das Gefolge der hohen Herrschaften her.
Auch in den Frauenhäusern, den Bordellen der Stadt, ging es in jenen Tagen hoch her. Boten der Stadtregierung hatten den hier arbeitenden Frauen schon vor Längerem große Pakete mit feinstem Samt gebracht, damit sie sich neue Kleider nähen konnten. Der Magistrat legte schließlich Wert darauf, dass auch die Dirnen stilvoll und einheitlich ausstaffiert waren, wenn sie dem Kaiser unter die Augen kamen. Zum großen Empfang am Stadttor und den folgenden Feierlichkeiten waren sie selbstverständlich eingeladen. Als sich der Zug des Kaisers näherte, läuteten alle Kirchenglocken und die Trompeter stießen Fanfaren aus. Die Würdenträger der Stadt und die Abordnungen der Zünfte zogen mit ihren Fahnen den Ankommenden entgegen, ebenso wie Priester mit den wichtigsten Reliquien aus Wiens Kirchen.
Den festlich zurechtgemachten Dirnen war klar: Bald würde es viel für sie zu tun geben. Am Abend waren sie zu den Veranstaltungenin den noblen Patrizierhäusern bestellt, wo sie in Anwesenheit des Bürgermeisters und des Stadtrats Tänze aufzuführen hatten. Die Türen der Bordelle standen jedermann offen, das verlangten die Behörden so. Geld durften die Hübschlerinnen für ihre Arbeit nicht verlangen – abgerechnet wurde später mit dem Magistrat. »Was jeder haben wolt, das gab man Im«, hieß es an solchen Tagen, und »derfft khaine khain Pfening nicht nehmen …, zallets alles von Hof«. Alle wussten, dass mit fortschreitender Stunde die Stimmung immer lauter und aufgekratzter sein würde. In einer solcherart aufgeheizten Atmosphäre ließen sich die ehrbaren Frauen der Stadt besser nicht mehr unbegleitet auf den Straßen blicken.
In einer dicht besiedelten Stadt wie Wien konnte es schon einmal vorkommen, dass man sich über lästige Nachbarn ärgern musste. In der Seilerstätte zum Beispiel regte man sich über das laute Geschnatter auf, das vom dortigen Hühnermarkt durch die Fenster drang, und die Benediktinerpater des Schottenklosters beschwerten sich darüber, dass die Körbe der Marktfahrer den Weg in ihre Kirche blockierten. Ein Hausbesitzer in der Bäckerstraße zeigte seinen Nachbarn an, aus dessen Senkgrube es unerträglich stank, und besonderen Ärger hatten die Minoriten. In unmittelbarer Nähe ihres Klosters, gleich neben ihrer Backstube, lag nämlich ein Freudenhaus, in dem die »Lupae«, die »Wölfinnen« der Nacht, ihre Dienste anboten. Abend für Abend herrschte dort lautstarkes Treiben, worüber die gottesfürchtigen Mönche wiederholt Klage führten.