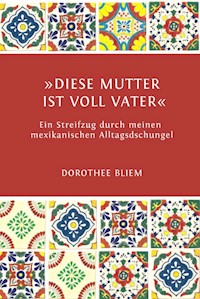
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach einem neuen Job folgt Doro kurzerhand einem Stellenangebot in San Luis Potosí, Mexiko. Vom Leben in einem improvisierten Hippiehaus über die Fortbewegung mittels "Ei" bis hin zum Einkaufen in fremden Schlafzimmern konfrontiert sie der mexikanische Alltag mit vielen verrückten Herausforderungen. Sie erzählt von "großen Geschäften" und leeren Spülkästen; von Bier mit Tomatensaft und von der wahren Bedeutung von Schokolade. Davon, dass man sich das Recht auf eine Erkältung hart erkämpfen muss und warum man Kondome nur ungern am Kiosk kauft. Ein kompakter Abriss einer Alltagskultur, die mehr zu bieten hat als Drogen, Korruption und Tequila.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Diese Mutter ist voll Vater« - ein Streifzug durch meinen mexikanischen Alltagsdschungel
Davor-WortLa Casona Comonfort - Vom Wohnen etwas fürs Leben lernenNeue Routinen - Einkaufen in MexikoEin Taxi namens Krankenwagen - unterwegs von A nach B»Mañana vamos« - die Bürokratie des Einwandererdaseins»¿A qué te dedicas?« - Arbeit, Geld und die Frage, die man nicht stellt»¿Cómo lo hacemos?« - ein BestechungsexkursVon Zelten und Schwimmwesten - Urlaub auf mexikanischViva México! Bunte Alltags- und Festtagsfreuden»¿Qué te gusta más de México?« - Ein Stich ins Herz und in den MagenBier mit Sauce - mexikanische Trinkgewohnheiten»Wo man singt, da lass dich ruhig nieder« - Musik und TanzZeit, die Maske fallen zu lassen - über den Sport»¿Ya te tomaste algo?« - vom Kranksein und anderen PlagenDie wahre Bedeutung von Schokolade - mexikanische Liebeshürden»Diese Mutter ist voll Vater« - das Einmaleins des KommunizierensDanach-WortGlossarQuellenverzeichnisÜber die AutorinDavor-Wort
Zum ersten Mal in meinem Leben erfüllt mich eine trockene Brezel mit tiefer Dankbarkeit. Sie ist mein Henkersfrühstück am Münchner Flughafen, dann werde ich es für voraussichtlich ein Jahr mit mexikanischen Frühstücksalternativen aushalten müssen. Gut, müssen ist vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Erstens zwingt mich ja niemand dazu, mich plötzlich nach Mexiko »abzusetzen«, und zweitens kann ich mir essensmäßig weitaus größere Übel vorstellen. Bebuttert ist meine vorerst letzte Brezel nun zwar nicht mehr ganz so trocken, doch sie schmeckt immer noch fade genug, um mir den Abschied von zuhause etwas zu erleichtern.
Zeitlich gesehen befinden wir uns gerade im Januar 2017. Ich bin 24 Jahre alt und werde in geschätzt 20 Stunden erstmals mexikanischen Boden betreten. Dort werde ich an einem deutschen Kulturinstitut Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Genauer gesagt verschlägt es mich nach San Luis Potosí – eine Stadt im gleichnamigen Bundesstaat in Zentralmexiko. Die Betonung von Potosí liegt – angedeutet durch den Akut auf dem i – übrigens auf der letzten Silbe, was mir zum Zeitpunkt der Abreise noch nicht klar ist. Von mir aus könnte man auch Pótosi oder Potósi sagen, denn noch ist die Stadt für mich ein grauer, seelenloser Fleck. In Reiseführern finden sich darüber höchstens mitleidige Dreizeiler, die ein Eisenbahnmuseum und die Nähe zu anderen, attraktiveren Städten anpreisen. Ganz geheuer ist mir das nicht. Auch über den Rest von Mexiko weiß ich im Grunde nichts, außer dass die Menschen dort sehr nett sind. Das weiß ich so genau, weil ich mal eine sehr herzliche mexikanische Studienkollegin namens Jimena hatte. Die nicht so netten Leute – so viel recherchierte ich – sollen sich zum Glück nicht auf San Luis Potosí, sondern auf andere Bundesstaaten konzentrieren.
Zwischen den Aussprachevarianten hin- und hergerissen, gebe ich beim Check-in einfach San Luis als Enddestination an. Ich sei auf keinen Flug gebucht, verunsichert mich die Dame am United-Airlines-Schalter. Als wüsste sie sie auswendig, hämmert sie meine Passdaten in ihren Computer und erkennt zum Glück noch knapp vor meiner Panikattacke, dass ich gar nicht nach St. Louis in Missouri, sondern nach Mexiko möchte.
Da ich nur die nötigsten Eckdaten von der mir bevorstehenden Zeit kenne, habe ich keine konkreten Vorstellungen oder Erwartungen. Ein paar Ängste und Hoffnungen keimten abwechselnd in den aufgeregten Nächten vor meiner Abreise auf, die ich jedoch weitgehend zu ignorieren versuchte. Doch was soll schon groß passieren? Sieht man von ein paar Horrorszenarien ab, lande ich im schlimmsten Fall in einer Einöde in der mexikanischen Bergwelt, wo ich tagein tagaus Däumchen drehen und mir aus Langeweile ein Abo fürs Eisenbahnmuseum besorgen werde. Im besten Fall hingegen liegen zwölf lebendige Monate vor mir, in denen ich mir das berühmt-berüchtigte fuego latino, das ›lateinamerikanische Feuer‹, zu eigen machen werde. In jedem Fall aber will ich versuchen, alles aufzusaugen, was meinen Blickwinkel, meinen Horizont und nicht zuletzt meine Spanischkenntnisse irgendwie erweitern könnte. ¡Olé!
So viel vorweg: Die Angst, in einer deprimierenden Einöde zu landen, war unbegründet. Obwohl ich tatsächlich von Bergen umgeben war, fühlte es sich an, als habe man plötzlich einen riesigen Felsbrocken vor meinem Geiste beiseite gerückt. Den nahm ich paradoxerweise erst wahr, als er nicht mehr da war. Plötzlich sah ich nicht nur die fremde, sondern auch meine Heimatkultur aus einer befreiend distanzierten Perspektive. Es waren gerade die kleinen, scheinbar belanglosen Aspekte des täglichen Lebens, die mich immer wieder überraschten. Wie Puzzleteile fügten sie sich nach und nach zu einem größeren Ganzen zusammen. Ich fand an diesem Spiel Gefallen und hängte an die zwölf lebendigen Monate noch einmal neun dergleichen dran. Meine Erlebnisse hielt ich über diese Zeit hinweg in einem kleinen Online-Tagebuch fest. Manche meiner Freunde sprachen auch von einem Blog, doch dafür fehlte ihm meiner Meinung nach der Glitzer. Den möchte ich nun, zum krönenden Abschluss, in Form dieses Büchleins drüberstreuen.
Wer sich fragt, was es mit dem seltsamen Titel auf sich hat, den bitte ich an dieser Stelle noch um etwas Geduld. Die Taktik, sich einfach einmal auf Dinge einzulassen, hat mir in Mexiko sehr oft sehr gut geholfen. Vielleicht funktioniert das ja auch beim Lesen. Und nur, weil etwas auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt, heißt das nicht, dass man ihn nicht irgendwann erkennt.
Thematisch will ich mit euch einmal durch meinen mexikanischen Alltag streifen: Blauäugig in Situationen hineintreten und auf hoffentlich erheiternde Weise wieder herauswachsen. Es geht um große Geschäfte und kleine Flüchtigkeitsfehler; um Bier mit Tomatensaft und Suppe auf dem Grill; um »Liebesg’schichten und Heiratssachen«; wenig um morgen, aber viel um heute; um Improvisationsgeschick und Zuversicht. Drogen, Gewalt und Korruption lasse ich dabei weitgehend aus dem Spiel. Dafür offenbarte sich mir in Mexiko zu viel Schönes, das leider oft im medialen Schatten der Kriminalität untergeht. Bis auf eine kleine Bestechungsaktion kann ich diesbezüglich außerdem nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Dies hier ist auch kein Reisebericht, kein Verhaltensguide, keine Überhöhung oder Erniedrigung der mexikanischen Kultur. Nach zwei Jahren auf einem verschwindend kleinen Fleck in einem 1.973.000 km² großen Land mit 129 Millionen Einwohnern würde ich mir das nicht anmaßen wollen. Und überhaupt bin ich kein Freund kultureller Dos and Don’ts. Bei der einen oder anderen überzeichneten Darstellung denke man sich also bitte mein zwinkerndes Auge hinzu. An dieser Stelle möchte ich außerdem anmerken, dass zu den Mexikanern, den Österreichern und den sonstigen Europäern, von denen hier die Rede sein wird, auch jeweils die weibliche Form gehört – und alles, was dazwischenliegt. Der Einfachheit halber habe ich mich aber dafür entschieden, nur von der generischen Form abzuweichen, wenn es mir sinnvoll und relevant erschien.
Doch wer soll dieses Buch nun überhaupt lesen? Wie vor meiner Abreise habe ich auch hier nur ein vages Bild vor Augen. Im besten Fall fällt es Menschen in die Hände, die auch ohne große »Wanderung« einmal hinter ihr geistiges Gebirge spähen wollen. Oder jenen, die kurz davorstehen, sich auf ein ähnliches Abenteuer einzulassen. Menschen, die sich nicht so sehr um geschichtliche Fakten kümmern, sondern vielmehr um die kleinen Dinge des Alltags. Sehr gerne auch euch, die ihr einfach nur ein wenig Unterhaltung sucht.
Im schlechtesten Fall verblassen diese Seiten in meinem Bücherregal und werden noch staubiger als die alte Flughafenbrezel vom Januar 2017. Ich kann nur hoffen, dass sie mich nichtsdestotrotz immer wieder nach Mexiko zurückkatapultieren werden und mich mit ebenso viel Dankbarkeit erfüllen.
Innsbruck, im Dezember 2019
La Casona Comonfort - Vom Wohnen etwas fürs Leben lernen
Keine Angst, das hier ist keine IKEA-Werbung. Im Gegensatz zu vielen anderen Kapiteln meines Lebens beginnt mein Kapitel Mexiko ausnahmsweise nicht mit einem strapaziösen Besuch im schwedischen Möbelhaus. Laut meinem zukünftigen Chef erwartete mich nämlich eine voll ausgestattete Wohnung. Voll ausgestattet! In diesem Zusammenhang wurde ich mir wieder einmal des Schönen, gleichzeitig aber auch Beängstigenden an Begriffen bewusst: ihrer Dehnbarkeit. Was für meinen Chef »voll ausgestattet« bedeutete, rief bei meiner Mutter erniedrigende Kommentare wie »Du wohnst ja im Slum!« hervor. Mein anfänglicher Ärger über diese Parallele galt eigentlich mir selber, denn auch ich sah anfangs nur das Gefälle zu meinen bisherigen Wohnstandards. Mit der Zeit eröffnete sich mir jedoch eine ganz neue (Wohn-)Welt. Unter der Oberfläche von improvisierten Möbeln und zweckentfremdetem Hausrat entdeckte ich eine Mentalität, die durch ihre Genügsamkeit fast eine Art buddhistische Freiheit in sich trug: nichts zu wollen, was man nicht hat.
In diesem Kapitel entführe ich euch in mein mexikanisches Hippiehaus. Gemeinsam überwinden wir den ersten Kulturschock und lernen, wie man den typischen Herausforderungen des mexikanischen Alltags begegnet. Dabei werden wir erkennen, dass gerade im Verzicht viele erheiternden Seiten des Lebens zutage treten.
Im Januar 2017 stand ich erstmals vor der Tür, die von jenem Augenblick an das Tor zu meinen mexikanischen vier Wänden sein würde. Für mein Gefühl unterschied sich die Haustür Nr. 715 nur durch ein Stück weiße Kreide von all den anderen Haustüren der Calle Ignacio Comonfort im Zentrum von San Luis Potosí. Die Kreide steckte in einem zeigefingergroßen Loch und sollte uns Bewohner, so meine Vermutung, vor voyeuristischen Passantenaugen schützen. Neben mir stand Hector, der Chauffeur des Centro Cultural Alemán, meiner zukünftigen Arbeitsstätte. Von einem Chauffeur vom Flughafen abgeholt zu werden, stellte ich mir aufregend und exklusiv vor. Hector kam jedoch nicht mit einem polierten Hochglanzschlitten angefahren, sondern mit einem klapprigen VW-Käfer. Auch Hectors Aufmachung entsprach nicht gerade dem Bild des klassischen Chauffeurs: Anstelle von Hut, Handschuhen, Anzug und Krawatte trug er ein lockeres Paar Jeans und ein Polohemd.
Auf der Fahrt hatte mir Hector bereits von meinem zukünftigen Mitbewohner Salvador und dessen Renovierungskünsten erzählt. Die Kreide ließ nun durchsickern, dass diese »Renovierungskünste« wohl ihrer ganz eigenen Definition bedürfen. An der hölzernen Haustür prangte ein eiserner Türklopfer. Er war nicht nur zur Zierde, denn neben der Klingel klebte ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift: »Timbre no sirve« – ›Klingel funktioniert nicht‹. Die Klingel muss ihren Dienst schon vor längerer Zeit niedergelegt haben, denn der Zettel hatte bereits einige Regenfälle gesehen. Hector klopfte dreimal. Nichts passierte. Er klopfte weitere dreimal. Wieder nichts. Erst das fordernde »¡Holaaaaa!«, das er in die Ungewissheit hinter der löchrigen Tür schickte, setzte das Leben dort in hörbare Bewegung. Zwei Schlüsselumdrehungen entriegelten die Tür.
Noch bevor ich die menschlichen Züge meiner zukünftigen Mitbewohner erahnen konnte, umhüllte mich eine dicke Rauchwolke, ein Gemisch aus Tabak und aromatischen Terpenen. Letztere sind für den charakteristischen Cannabisgeruch verantwortlich. Inmitten der Rauchwolke schlangen sich zweimal zwei Arme um mich und bestätigten, dass das Kreidestück inklusive mir mindestens zwei Frauen und einem Mann dienlich sein würde. Ich hörte die Namen Amelie und Salvador und hatte jetzt zumindest eine Stimme zum Renovierungskünstler und meiner deutschen Kollegin, von der mir mein Chef bereits erzählt hatte. Amelie war wie ich als Deutschlehrerin nach San Luis gekommen und wohnte seit einem halben Jahr mit Salvador und drei weiteren Mitbewohnern unter einem Dach. Wobei man das mit dem Dach nicht zu wörtlich nehmen darf. Neben Amelie und Salvador gab es noch den langgezogenen Carlos und sein optisches Gegenstück, den kleinrunden Norberto. Salvador teilte sich sein Zimmer mit seiner Freundin Rigel, benannt nach dem hellsten Stern im Sternbild Orion.
Mein Begrüßungskomitee führte mich durch einen fünfzehn Meter langen, unüberdachten Gang, von dem links drei fensterlose Schlafzimmer abzweigten. Die rechte Wand war geziert von Aloe Vera und anderen, auch in Mexiko nicht ganz legalen, Grünpflanzen. Am Ende des Ganges hing über einer Tür ein WLAN-Router, den ich nur anhand seiner Antenne identifizierte. Um vor dem Regen geschützt zu sein, war das Herzstück des Routers in einen knittrigen Plastiksack gehüllt worden.
Die Tür führte in das belebteste Zimmer des Hauses. Wofür es bestimmt sein sollte, war meinem kategorisierenden Geist in diesem Moment noch nicht ersichtlich. Esszimmer? Oder Raucherzimmer? Arbeitszimmer? Malzimmer? Reines Durchgangszimmer oder schlichtweg Wohnzimmer? Die paar Quadratmeter wurden von einer querliegenden Tür auf zwei Tischblöcken fast komplett ausgefüllt. Drumherum zusammengewürfelte Stühle mit den ebenfalls zusammengewürfelten Freunden meiner Mitbewohner. An der schmalen Wand erkannte ich die Umrisse der für Mexiko charakteristischen Virgen de Guadalupe. Dieses Gnadenbild der Maria findet man in jedem traditionsbewussten mexikanischen Haushalt. Der Legende zufolge erschien dem Indianer Juan Diego im Dezember des Jahres 1531 die Mutter Gottes, die ihn mit dem Bau einer Kirche beauftragt haben soll, der Basilica de Guadalupe. Acht Millionen Indios wurden innerhalb der darauffolgenden Jahre zum Christentum bekehrt. Die Basilica im Norden von Mexiko-Stadt ist heute ein beliebter Wallfahrtsort und das Marienbildnis allgegenwärtig. Für gläubige Katholiken wäre die Guadalupe an unserer Wand jedoch vermutlich ein blasphemischer Affront gewesen. Meine Mitbewohner waren nämlich gerade dabei, sie in einen T-Rex umzuwandeln, unseren Guadarex. Ein erstes Indiz dafür, dass mein mexikanisches Wohnerlebnis nicht ganz den traditionellen Standards entsprechen würde.
Hinter diesem Zimmer mit dem Guadarex befand sich ein abstellkammerartiger Innenhof. Mein Blick blieb an einer riesigen, schwarzen Mülltonne hängen, deren Deckel durch die aufeinandergestapelten Müllsäcke bereits ziemlich hoch gewandert war. Da der Turm in sich zusammenzufallen drohte, packte Salvador eines der herausstehenden Säckchen und platzierte es ganz oben, über dem Mülltonnen-Mittelpunkt. Der Deckel wanderte weiter in die Höhe, doch der Turm stand. Im Müll-Jenga wieder eine Runde weiter.
Über den Innenhof gelangte man zu Bad, Küche und einem weiteren Schlafzimmer. Nach der durchlöcherten Haustür und dem bunten Türtisch war ich mir nun unsicher, was es mit der Badezimmertür auf sich hatte. War sie das Resultat künstlerischen Schaffens oder das traurige Ergebnis einer Fehlkalkulation? Die Tür reichte nicht bis an die Decke, sondern ließ, wie viele öffentliche WCs, nach oben hin einen ziemlich großen Spalt frei. Es ragte zwar höchstens Carlos’ Kopf darüber hinaus, doch wer neben der visuellen auch auf akustische Abgeschiedenheit Wert legte, tat gut daran, seine Notdurft an einem anderen Ort zu verrichten.
Vom Innenhof führte eine steile Betontreppe zu meinem Zimmer. Es war das einzige Zimmer im Obergeschoss. Beim Anblick der Treppe war ich für einen kurzen Moment froh, dass es mein Gepäck nicht bis nach San Luis geschafft hatte. Laut Flughafenpersonal sollte mein Koffer zwar automatisch von Houston nach San Luis weitertransportiert werden, doch am Ende erreichte ein Großteil der Passagiere San Luis ohne Gepäck. Hector zeigte sich darüber nicht weiter überrascht. Er hatte die Zeit am United-Airlines-Schalter schon einkalkuliert und half mir über meine noch ziemlich holprigen Spanischkenntnisse hinweg. Bis ich endlich den langersehnten Outfitwechsel durchführen konnte, sollte es jedoch eine geschlagene Woche dauern.
Als ich die steile Treppe zu meinem Zimmer erklomm, machte mir am meisten meine schwache Blase Sorgen: Immerhin würde ich mich für jeden Toilettengang den gegebenen Wetterverhältnissen und 15 scharfkantigen Stufen aussetzen müssen. Schnee und Überschwemmungen hielt ich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise noch für unrealistisch.
Als letzten Raum präsentierte mir Salvador nun mein Zimmer. Der Boden bestand zur einen Hälfte aus schlichtem Beton, zur anderen Hälfte aus einem hölzernen Podest. Dieses Podest diente anscheinend der Stabilität des Raumes, was ich vorsichtshalber nicht hinterfragte. Es bot Platz für mein Bett mit einer dicken, durchgelegenen Matratze sowie für einen kleinen Nachttisch mitsamt Nachttischlampe. An Mobiliar gab es ansonsten einzig ein paar Holzbretter, die Salvador höchstpersönlich mithilfe einer Limettenpresse an die Wand genagelt hatte. Ein weiterer Vorgeschmack dessen, was mich in diesem Haus noch erwarten würde. Dass ich dort tatsächlich noch so vieles erleben würde, hätte ich anfangs nicht gedacht: Über die Rustikalität erschrocken, konnte ich mir nicht vorstellen, länger als unbedingt nötig zu bleiben. Und obwohl ich noch nicht wusste, ob ich es mit meiner mexikanischen WG verhältnismäßig gut oder schlecht getroffen hatte, plante ich im Geiste schon meinen Umzug. Warum war ich also ein Jahr später immer noch da?
Ich hatte zum Glück schnell erkannt, dass ich von meiner österreichischen Komfortzone direkt in die mexikanische Panikzone geschlittert war. Die fremde Umgebung, das kahle Haus, die rauchenden Mitbewohner und die Zeitverschiebung verursachten primär eines: Stress! Das Eustress-Level war dabei längst überschritten und ich heillos überfordert. Erst versuchte ich mir einzureden, dass diese Panik eine ganz normale Reaktion sei, die von selbst wieder abklingen würde. Den Moment machte dieser Gedanke jedoch auch nicht erträglicher. Ich verlor mich für einige Stunden in einem Buch und fasste den etwas schizophrenen Plan, einfach selbst zur Romanfigur zu werden – aus mir herauszutreten und mich von oben zu betrachten. Wie reagiere ich auf mein neues Leben in diesem absurden Hippiehaus? Was gibt es sonst noch zu entdecken? Und was kann ich aus diesem Abenteuer lernen? Tatsächlich half mir diese Strategie dabei, mich physisch und psychisch auf Mexiko einzulassen. Stück für Stück begann ich, die Casona, wie wir unser Haus liebevoll nannten, in mein Herz zu schließen – denn mit ihrer (vermeintlichen!) Unvollkommenheit hat sie mir sehr viele Dinge gelehrt. Zum Beispiel, wie schön ein Leben als Provisorium sein kann.
Nach einer Phase des Eingewöhnens war ich richtig beschämt darüber, wenn ich daran zurückdachte, wie schwer es mir fiel, meinen knallroten Milchaufschäumer zuhause zurückzulassen. Der Verzicht auf die milchige Schaumhaube auf meinem morgendlichen Kaffee erschien mir nicht unwesentlich. Aber man kann nicht alles haben – bei 22 Kilo Heimat für (geplant) 365 Tage waren nun einmal Prioritäten zu setzen. Ich ging richtig in der Annahme, dass ich als verwöhnte Besitzerin skurriler Haushaltsartikel auf viele meiner geliebten, neudeutschen »Gadgets« würde verzichten müssen. Am Ende verzichtete ich allerdings nicht nur auf das eine oder andere Luxusgut, sondern auch auf klassischere Alltagshelfer, die mir bis dahin selbstverständlich erschienen waren: Wir hatten weder Mikrowelle noch Wasserkocher, lebten ohne Staubsauger und Bügeleisen – von einer Spülmaschine ganz zu schweigen. Und auch Dosen- oder Flaschenöffner suchte ich vergeblich. Bei manchen Dingen bin ich mir bis heute noch nicht sicher, ob es sie in Mexiko überhaupt gibt. Zumindest im Falle des Staubsaugers hatte ich den Eindruck, dass sich der Mexikaner diesem Gerät aktiv verweigert – war doch der Besen sein liebstes Accessoire. Ob in Wohnhäusern oder Einkaufszentren, auf Straßen oder Baustellen – irgendwer war immer am Kehren. Meiner Auffassung nach entspricht der Begriff Kehren ja dem gezielten Beseitigen von Staub, Bröseln oder ähnlichem Dreck. In Mexiko hingegen scheint vor allem die Zielgerichtetheit keine entscheidende Bedeutungskomponente zu sein. Die Gemächlichkeit, mit der so manch Besen durch die Gegend wedelte, war bemerkenswert. Das Fegen, Kehren oder eben das sinnbefreite Staubaufwedeln muss für den Mexikaner also eine willkommene Freizeitbeschäftigung darstellen, so meine Schlussfolgerung. Für mich persönlich war der Verzicht auf den Staubsauger zwar weniger unterhaltsam, doch immerhin übte ich mich damit in der Entschleunigung. Denselben Effekt hatte der nichtvorhandene Geschirrspüler. Dabei musste ich bei der meditativen Tellerwäsche immer wieder über eine kuriose Vorrichtung schmunzeln: den Schwammbecher. Der Schwammbecher gehört zum festen Inventar mexikanischer Haushalte. Es handelt sich dabei um einen alten Plastikbecher, in dem der Spülschwamm in alter Spülsuppe auf seinen nächsten Einsatz wartet. Ich war in der Bakteriologie zum Glück nicht gut genug bewandert, um genaue Vorstellungen davon zu haben, was dieser Schwammbecher bazillenmäßig bedeutet.
Viel bedrohlicher als die Schwammbazillen schien mir beim Abwasch die Gefahr des sich leerenden Wassertanks. Unbegrenzt fließendes Leitungswasser ist in Mexiko nämlich keine Selbstverständlichkeit. Auf den Hausdächern stehen runde Wassertanks, die regelmäßig von einer elektrischen Wasserpumpe befüllt werden müssen. Unsere Wasserpumpe – die Bomba – konnten wir mit einem Stromkabel in Salvadors und Rigels Zimmer aktivieren. Mit einem ratternden Geräusch teilte sie uns mit, dass sie dabei war, unsere Wasservorräte sicherzustellen. Dafür reichten in den meisten Fällen 30 Minuten pro Tag. Noch erleichternder als beim Abwasch war die Gewissheit über die Wasserversorgung übrigens nach dem »großen Geschäft« – um einiges erleichternder als die Darmentleerung an sich. Stellte man nämlich fest, dass der Spülhebel keinen Widerstand leistete und die Verdauungsreste somit nicht bald der Kanalisation zugeführt werden konnten, hätte man sie retrospektiv doch lieber bei sich behalten. Nur bei Salvador löste dieses Gefühl keine Beklemmnis aus; zumindest war er der Einzige, der sich dieses Problems nicht immer unmittelbar annahm. Meinen restlichen Mitbewohnern war es zum Glück kein Bedürfnis, nachfolgende WC-Benutzer mit ihren schwimmenden Hinterlassenschaften zu beglücken. Wer jedoch versuchte, das Problem mit Toilettenpapier zu kaschieren, der schoss sich selbst ins Knie. Durch die engen Abflussrohre gibt es einen guten Grund dafür, dass der für Toilettenpapier prädestinierte Ort nicht die Kloschüssel, sondern der Mülleimer ist. Es hieß also wohl oder übel, sich unauffällig des Trinkwasserkruges zu bemächtigen, um den Spülkasten manuell zu befüllen. Erst dann konnte man beruhigt darauf warten, dass die Bomba





























