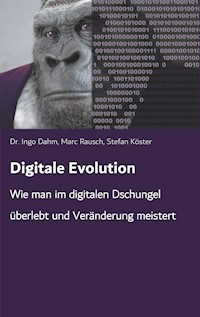
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn drei Silberrücken des Web 1.0 sich bei einem Buch über Digitalisierung fühlen wie Gorillas im Nebel. Aber es ist auch ein Ansporn. In diesem Buch haben wir die Quintessenz aus vielen Jahren Leadership, Beratung, eigenem unternehmerischen Streben und noch mehr Rückschlägen und Umwegen auf dem Weg zu digitaler Exzellenz aufge-schrieben. Das Buch ist anekdotenhaft konzipiert um Spaß zu machen und Lernerfolge zu maximieren. Es schlägt fachlich fundiert eine Schneise quer durch den Dschungel aus Buzz-Words, Hypes und Nonsens mit dem Ziel, Orientierung zu geben. Es bietet Anregungen für eigene digitale Projekte und Werkzeuge, um die vielfältigen Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu meistern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle, die Digitalisierung verstehen möchten.
Für alle, die den Mut haben, Fragen zu stellen.
Für alle, die von einer digitalen Zukunft träumen.
Für alle, die wissen wollen, was Affen damit zu tun haben… springt doch direkt zu Seite →.
Inhalt
Bedienungsanleitung
Symbole zur Orientierung
Prolog
Die vier Todfeinde der Digitalisierung
Wie hilft dieses Buch beim Digitalisieren?
Technologie
Big Data – Das Öl des Informationszeitalters
Künstliche Intelligenz - Echte Gefahr?
Blockchain – Mehr als nur Kryptowährung
Virtual Reality - Rocke oder verrecke!
UX / UI – Die Sehnsucht nach Tante Emma
3D-Druck – Booster für die Fertigung
Chatbots – Reden wir mit dem Computer!
Socialmedia – Wie es wirklich gemeint ist
Geschäftsprozesse & Daten
Prozesse – Wo sich die Digitalisierung lohnt
Vertrieb – Erfolg im digitalen Verkaufsprozess
Marketing – Mit Daten zu Top-Performance
HR 4.0 – Personalarbeit (in) der Zukunft
Daten – Sammeln, verwenden, vermarkten
Organisation &Zusammenarbeit
Geschäftsmodelle – Digital Geld verdienen
New Work – Nur Tischkicker und Obstteller?
Die Rolle von Werten – Lernen von den Rittern
Projekte – Agilität allein reicht nicht
Change – Organisationen erfolgreich ändern
Affen – Die besseren Change-Manager?
Checkliste für Ihr digitales Projekt
Epilog
Best of Autorenteam (Outtakes)
Unsere persönlichen Learnings
Literaturverzeichnis
Disclaimer
Danksagung
Bedienungsanleitung
Sie können dieses Buch auf drei unterschiedliche Arten und Weisen nutzen.
Lesen Sie es einfach von vorne nach hinten durch und haben Sie eine gute Zeit mit hoffentlich interessanten Inhalten, geschrieben in einem weitgehend kurzweiligen Stil. Jedes Kapitel ist ein Life Hack für sich, ideal für den Weg zur Arbeit, mit leckerem Tee am Kamin oder zum Einschlafen im Bett.
Springen Sie von hier einfach bis fast ans Ende des Buches und starten Sie mit unserer Checkliste für die Digitalisierung. Dort finden Sie eine ganze Reihe von Szenarien, Annahmen oder Fragestellungen. Wenn Sie einen dieser Punkte als relevant für Ihre momentane Fragestellung oder Ihr aktuelles Projekt sehen, blättern Sie von dort einfach zum entsprechenden Kapitel.
Die dritte Alternative, Sie lesen den Epilog und Ihnen wird bewusst, dass Digitalisierung selbst Digitalprofis manchmal zur Verzweiflung treibt –und das wegen ganz banaler Dinge. Wenn Sie dann merken, dass Sie nicht allein sind, diese Erkenntnis hoffentlich als tröstlich empfinden und immer noch Lust auf Digitalisierung haben, dann entscheiden Sie sich einfach für 1. oder 2.
Symbole zur Orientierung
Zur Verständlichkeit verwenden wir in diesem Buch an einigen Stellen besondere Piktogramme und Formatierungen. Diese weisen auf Passagen hin, an denen wir ganz besonders zum Mitmachen und Nachdenken anregen wollen.
Definitionen und wichtige Hinweise
Hervorgehobene Definitionen empfehlen wir auswendig zu kennen. Im Alltag erfasst man Zusammenhänge dann schneller.
Praktische Beispiele und Werkzeuge
Gelegentlich nutzen wir Beispiele, um komplexe Strukturen einfach erklären zu können, Anregungen zum Nachahmen oder Impulse für eigene Umsetzungen zu geben.
Checklisten und Hilfe zur Selbstreflektion.
Wenn sich am Ende eines Kapitels die Frage „…und nun?“ stellt, raten wir zur Selbstreflektion. Diese speziell markierten Abschnitte sollen helfen, die wichtigsten Themen des Kapitels auf Ihren eigenen, ganz speziellen Fall zu beziehen.
Schlüssel dazu sind Sie persönlich, denn Sie kennen Ihr Unternehmen und Projekt besser als jeder außenstehende Digitalisierungsprofi. Reflektieren Sie die offenen Fragen oder tauschen Sie sich mit uns darüber aus – am besten online unter fb.me/kongsdigital
Damit Sie keine Links abtippen müssen, verwenden wir praktische QR-Codes.
Mit einer QR-Code-App können Sie jeden Link über Ihr Smartphone einfach öffnen. Während die QR-Code-Funktion im iPhone integriert ist (Sie brauchen bloß mit aktivierter Kamera auf den Code zeigen), muss bei anderen Telefonen eine passende App installiert sein. Probieren Sie es gleich aus und besuchen Sie unsere Facebook-Seite.
Prolog
Die vier Todfeinde der Digitalisierung
Immer noch haben Executives der Prä-Internet-Ära Schwierigkeiten, echte digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Statt disruptiver Veränderung versuchen sie ihr Unternehmen mit einer Mischung aus Anpassung (aka „Evolution statt Revolution“), Aussitzen oder halbgaren Experimenten in die Gegenwart zu bringen. Digitalisierung geschieht letztlich nur halbherzig, denn das Management hat nur zu oft die vier Todfeinde der Digitalisierung im Haus:
1. Angst erzeugt Widerstand
Der größte Feind der Innovation ist die Angst. Viele Unternehmenslenker fürchten nicht steuerbare Kannibalisierung, schrumpfende Margen und generell den Verlust von Kontrolle. Dabei täten sie gut daran, sich lieber heute als morgen mit Innovationen anzufreunden. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, lautet ein altes deutsches Sprichwort. Schrumpfen erst einmal Marktanteile, weil Kunden zum digitalen Innovationsführer wechseln, wird es weit schwerer (und teurer!), diese Kunden wieder zurückzugewinnen, als wenn vorübergehend sinkende Profite mit dem Ziel der Eroberung neuer Märkte in Kauf genommen werden.
2. Gier frisst Innovation
Wir sprechen hier nicht nur über Unternehmen mit einer stets auf Sparflamme kochenden Forschungs- und Entwicklungsabteilung, denn dieser aus unserer Sicht in der Regel völlig fehlerhafte Sparansatz wird noch übertroffen von einem wesentlich größeren Problem:
Tatsächlich träumen viele Unternehmer davon, man könne die Cashcow noch ein wenig länger melken und sich später um Innovation bemühen. Dies funktioniert eventuell in Unternehmen mit großen Produktportfolios. Dort jedoch, wo eine Abhängigkeit von einem Kernprodukt entstanden ist, muss dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt sein!
Jedes Quartal, das ungenutzt verstreicht, ist Wasser auf die Mühlen des Wettbewerbs.
3. Misstrauenskultur verschleiert Fehler und verjagt Talent aus Ihrer Organisation
Eine besondere Form von Angst ist die Sorge um die eigene Zukunft. Sie ist nicht nur anzutreffen bei alteingesessenen Mitarbeitern, sondern auch in einer ganz besonders gefährlichen Form bei Führungskräften, die es versäumt haben, frühzeitig auf Innovationen zu reagieren. Hier hat die Personalfunktion versagt, für eine offene Fehlerkultur und ein Klima des Vertrauens sowie des Miteinanders zu werben und diese nachhaltig zu implementieren. Ein offener Umgang mit Fehlern führt zu lernenden Organisationen, die eben nicht versuchen, sich auf dem „sinkenden Schiff“ zu halten, sondern sich mit ganzer Kraft um einen klugen Umbau kümmern. Dies bedeutet aber auch, dass Mitarbeiter mit Fähigkeiten, die in der Vergangenheit weniger im Rampenlicht standen, nun stärker gefördert werden müssen. Und vor allem bedeutet das, dass nicht Aufgaben, sondern echte Verantwortung delegiert werden muss.
Damit dies in der Sozialstruktur eines Teams nicht zu Verwerfungen führt, ist ein moderner, kooperativer Managementstil mit großer Wertschätzung gegenüber allen Talenten einer Gruppe die erfolgskritische Voraussetzung.
4. Tagesgeschäft erdrückt Strategie & Vision
Kommt es in Unternehmen zum Schwur, so siegt zumeist Sales über Strategie. Der Verkaufserfolg wird mehr gewürdigt als eine gute Vision. Ein „Big Deal“ des Vertrieblers wird oft stärker honoriert als eine vertrauensvolle Kundenbeziehung, die auf Dauer ein Fundament für weit attraktivere Geschäfte werden kann. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass heute messbare Erfolge sofort als solche erkennbar sind, während künftiger Erfolg mit Fragezeichen und Unwägbarkeiten verbunden ist.
Dabei wird mit der gleichen Logik außer Acht gelassen, dass mit dieser Piratentaktik strategische Vision zerstört und Kundenbeziehungen verbrannt werden.
Kurzum: Es gibt keine Alternative zum Digitalisieren. Ebenso wenig war das Festhalten an der Kutsche eine Alternative zum Automobil. Sicher, auch heute werden Kutschen verkauft und es gibt immer noch einen Markt für ausgebildete Hufschmiede – aber im realen Leben geht der Anteil von Pferdefuhrwerken im Vergleich zu Benzinkutschen ganz klar im Rauschen unter.
Was machen erfolgreiche Digitalunternehmen anders?
Schauen wir uns digital erfolgreichere Wettbewerber an, so werden wir feststellen, dass diese nicht nur ein anderes Geschäftsmodell verfolgen. Vielmehr sind diese Unternehmen eben nicht von den vier Erzfeinden der Digitalisierung verseucht:
Neue Unternehmen bzw. Startups haben nichts zu verlieren. Sie sorgen sich nicht um bröckelnde Margen, die Positionierung von „Produktlinie A“ vs. „Produktlinie A Digital“. Außerdem tendieren Menschen, die sich als Unternehmer behaupten, dazu, weniger Bedenken als vielmehr Mut zu zeigen.
Erfolgreiche Digitalunternehmen haben verstanden, dass es klüger ist, sich selbst zu kannibalisieren, als sich kannibalisieren zulassen [1].
Immerhin lernen sie früher als andere das neue Geschäftsfeld kennen, sind somit fehlertoleranter und langfristig stabiler. Sie verlieren keine Kunden, sondern können dem Wettbewerb Marktanteile abtrotzen. Auch wenn dies zunächst zu scheinbar weniger Profitabilität führt: der alternative Weg ist gekennzeichnet von Siechtum und Veränderungen in Zeiten, die noch schwieriger sind als im Hier und Jetzt.
Moderne Unternehmen experimentieren nicht nur mit neuartigen Organisationsstrukturen, sondern sie setzen agile Methoden umfassend ein, um alle Teammitglieder gleichermaßen offen zu informieren. Fehler werden in Backlogs protokolliert. Nicht um die Verursacher zu denunzieren, sondern um eine Dopplung zu vermeiden. Sofern das Top-Management dies mitträgt, entstehen hierdurch Geschwindigkeit und Attraktoren für Vielfalt und Talent.
Eine gute Balance zwischen Tagesgeschäft (Business Operation) und Strategie zu finden, ist eine wirklich schwierige Managementaufgabe, die von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich gelöst wird. Aktuelle Digitalunternehmer fokussieren zumeist auf Wachstum, um in einer späteren Phase die eroberten Marktanteile in profitables Geschäft umzuwandeln, was sie ganz offenbar von klassisch ausgerichteten Wettbewerbern unterscheidet.
Wie bringt man „Digitalität“ in das eigene Unternehmen?
Einige Unternehmen haben den Wandel geschafft – andere haben ihn nie benötigt. Oder glaubt irgendjemand, dass das Silicon Valley in Krisensitzungen die Digitale Transformation erörtern wird, Master-Projektpläne erarbeitet und eine digitale Task-Force aufgestellt wird? Natürlich nicht.
Junge erfolgsverwöhnte Digitalunternehmen haben es mit ganz anderen Problemen zu tun – sie besitzen kaum Krisenerfahrungen. Und das macht sie einerseits gefährlich, weil sie keine Angst kennen, andererseits führen Euphorie und Arroganz auch schnell zum Verlust von Bodenhaftung.
Und „heiße Luft statt Substanz“ – das ist eine große Chance für kluge Modernisierer aus der klassischen Geschäftswelt.
Es liegt also auf der Hand, dass Digitalisierung erfolgen muss, viele Unternehmer, Führungskräfte und Experten stimmen hier zu. Und trotzdem scheitern viele große Projekte.
Die strategische Rolle des Chief Digital Officers
Einerseits lesen wir immer wieder die Prophezeiung, die Rolle des CDO werde bald wieder verschwinden [1], [2], [3]. Die Begründungen hierzu sind vielfältig und klingen einleuchtend, doch wir meinen, die Verankerung von digitalem Denken in der Geschäftsstrategie ist entscheidend, um den Wandel zu meistern. Schafft es Geschäftsführung oder Vorstand nicht, so muss um diese digitale Kompetenz erweitert werden.
Doch es gibt auch die Gegenstimmen: Jede Firma hat Autos. Trotzdem gibt es keinen Chief Car Officer.
Das kann man aus unserer Sicht nicht gelten lassen. So wenig universell wie ein Auto ist ICT-Technologie nämlich nicht. Sie ist mehr als ein Werkzeug. Sie trägt direkt zur Wertschöpfung bei. Und sie ist auf dem besten Weg, die Talente der Mitarbeiter zu ergänzen und abzulösen. Eine Industrie macht selten solche disruptiven Veränderungen durch.
Die Einführung von Dampfkraft und Elektrizität waren massive Veränderungen. Doch beide haben einige Industrien kaum berührt.
Gesundheits- und Finanzwesen entwickelte sich beispielsweise evolutionär weiter. Das Telefon und das Flugzeug haben alle Industrien gleichermaßen betroffen, doch zunächst wurden bestehende Prozesse „nur“ schneller und schrittweise ergaben sich neue Geschäftsmodelle und internationale Märkte wurden besser erschließbar. Die Einführung des Computers hat wieder viele Industrien berührt – zunächst als Bildschirmarbeitsplatz, was Aktenordner und Karteikarten ablöste. Spezielle Software machte Prozesse schneller, transparenter und überhaupt kontrollierbar. Und Roboter machten Produktion qualitativ besser und kostengünstiger.
Digitale Transformation ist größer als jede dieser für sich genommen schon sehr bedeutsamen Innovationen.
Keine Industrie ist vor digitaler Disruption gefeit [5]. Keine klassische Rolle ist nicht betroffen. Was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert: Software is going to eat the world [6]. Daher hat digitale Transformation eine ganz eigene Kraft. Vielleicht vergleichbar mit der Kraft des Geldes, auf das wohl schwerlich irgendeine Firma verzichten kann. Und einen CFO hat jedes Unternehmen.
Tatsächlich wurde die Rolle des CIO in einigen Firmen wieder eingestampft oder abgewertet. Doch wo sind diese Unternehmen heute? Sie haben den Anschluss verpasst, denn IT ist für sie stets eine Kostenkomponente geblieben. Stellen wir uns nur einen Moment vor, dass immer mehr Personal durch ICT ergänzt und ersetzt wird. Um es in der Vorstellung einfacher zu machen: Jede zweite Position wird durch intelligente Roboter besetzt [7]. Wer organisiert diese hybride Unternehmensarchitektur? Wer optimiert fachübergreifend die reibungslose Mensch-Maschine-Interaktion? Ein CDO macht mehr als „nur“ Change-Management. Diese Rolle beginnt mit der Digitalen Transformation. Doch sie endet dort nicht. Der CDO ist „The Newcomer that’s here to stay.“ [8].
Stellen Sie sich im engsten Führungskreis die Frage, ob es in Ihrem Markt schon digitale Pioniere oder Kannibalen gibt. Wenn ja, analysieren Sie nüchtern, was diese Pioniere besser machen als Sie und geben Sie Gas. Wenn nein, suchen Sie nach Ihrer digitalen Chance und geben Sie auch Gas.
Wie hilft dieses Buch beim Digitalisieren?
Wir sind sicher, dass es in jedem Unternehmen die vier Todfeinde Angst, Gier, Misstrauen und Tagesgeschäft gibt. Tauchen sie auf, so sind sie wie die apokalyptischen Reiter ein böses Omen für die Zukunft ihres Geschäfts.
Um gegen die Angst vorzugehen, hilft es immer, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Wer dieses Buch in die Hand genommen hat, ist offenbar auf dem besten Weg, dem Erzfeind Nr. 1 den Wind aus den Segeln zu nehmen – sehr gut! Betrachten wir die Konkurrenz für den Augenblick nicht als Feind, sondern als Unterstützer, neue Märkte zu erschließen. Jeder Player, der den Nutzen eines neuen Produktes in einem neuen Markt erläutert, ist ein Türöffner. Jedes Startup-Unternehmen, welches unser Kerngeschäft durch innovative Ideen bedroht, stiftet unseren Kunden echten Nutzen. Und Kundennutzen, das ist doch genau das, was wir wollen! Konzentrieren wir uns auf die Frage, wie wir diesen Rückenwind nutzen, anstatt darüber zu grübeln, wie wir dem Wettbewerb den Wind aus den Segeln nehmen.
Den anderen drei Gegnern widmen wir jeweils ein eigenes Kapitel.
Fehlende Investitionen in Innovation und Produktentwicklung sind Ursache für ein ausgemergeltes Produktportfolio mit dürftigen Umsätzen und mageren Margen. Daher beschäftigen wir uns mit zukunftsträchtigen Technologien und zeigen auf, welche Chancen in ihrer Anwendung liegen.
Der Fokus auf das Tagesgeschäft rührt zumeist vom hohen Wettbewerbsdruck – denn der hat sich massiv verschärft und ist internationaler geworden. Markteintrittsbarrieren bröckeln, Zölle schwinden, Sprache und Kultur stellen längst keine Schranken mehr dar und Logistik ist wie Infrastruktur inzwischen als Service verfügbar. Wir zeigen auf, wie Geschäftsprozesse digitalisiert werden können, um den Blick für strategische Themen wieder frei zu bekommen.
Um die neuen Herausforderungen zu meistern, genügt es jedoch nicht, wenn ein einzelner Unternehmer Grenzen überquert und neue Wege beschreitet. Ein Unternehmen benötigt Vielfalt, um nicht nur komplizierte, sondern komplexe Herausforderungen zu meistern. Das bedeutet Vertrauen und das muss tief in der Organisation verankert werden. Wie diese neue Form der Zusammenarbeit gelingen kann, darüber schreiben wir im dritten Kapitel.
Gerechtigkeit kommt so oder so
Jedenfalls in dem Sinne, dass ihr Kunde genau die Produkte oder Services aussuchen wird, die ihm den größten Nutzen versprechen. Es liegt an Ihnen, ob er das Optimum bei Ihnen findet – oder beim digitalen Wettbewerber.
Ist Vertrauen als ein entscheidender Erfolgsfaktor bereits tief in Ihrer Organisation verwurzelt? Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern und Führungskräften? Vertrauen Ihre Mitarbeiter Ihnen?
Technologie
Fehlende Investitionen in Innovation und Produktentwicklung sind Ursache für ein ausgemergeltes Produktportfolio mit dürftigen Umsätzen und mageren Margen. Daher beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit zukunftsträchtigen Technologien und zeigen auf, welche Chancen in ihrer Anwendung liegen.
Big Data – Das Öl des Informationszeitalters
Ohne jeden Zweifel tragen die Daten als Rohstoff der Digitalisierung eine ganz besondere Bedeutung. Interessanterweise und völlig im Gegensatz zu anderen Rohstoffen sind Daten allgegenwärtig und lassen sich zu extrem niedrigen Kosten fast beliebig vermehren.
In dieser Beziehung unterscheiden sie sich von Öl, Erz, Edelsteinen oder Ackerland. Andererseits gibt es auch Parallelen – so ist die Suche nach wertvollen Daten vergleichbar mit dem Schürfen nach Erz oder dem Aussieben von Nuggets bei der Suche nach Gold. Schließlich geht es nicht darum, irgendwelche Daten zu verarbeiten, sondern die richtigen.
In diesem Datenmeer zu fischen, das ist die Aufgabe von „Big Data“ – einem Begriff, der so inflationär gebraucht wird wie kaum ein zweiter. Kaum sind mehr als eine Handvoll Daten beieinander ist es „Big Data“. Eine Aufstellung aller Kunden und deren Umsätze der letzten 17 Jahre? Big Data. Die Werbeumsätze einer Website gepaart mit ein wenig Google Analytics? Big Data. Eine Excel-Tabelle mit fünf Spalten? Big Data.
Das ist nicht Big Data – das ist Big Bullshit!
Es wäre schön, wenn wenigstens ein paar grundlegende statistische Kenntnisse voraussetzbar wären, wenn jemand der Meinung ist, massenhaft Daten auswerten zu wollen, zu müssen oder sogar zu können.
Big Data bedeutet, dass massenhaft Daten auszuwerten sind. Massenhaft bedeutet: So viele, wie Sie vermutlich nicht zählen können. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Millionen oder Milliarden ... kann man zählen. Eine Million Millionen Datensätze? Hier scheitert es beim Zählen oft schon daran, dass man nicht weiß, ob die Zahl nun Billion oder Trillion heißt. Es ist übrigens eine Billion – außer im angelsächsischen Raum. Dort heißt die Billion Trillion und hat 12 Nullen. Hier in Deutschland hat sie 18 (wirklich!).
Wenn so viele Daten auszuwerten sind, dann kann man nicht mehr alle Möglichkeiten durchrechnen, sondern muss mit Statistik und Heuristiken arbeiten. Schätzen, Ableiten, Runden und auf seinen mathematischen Verstand vertrauen. Die zugehörigen Fähigkeiten unterscheiden sich so fundamental von den Skills eines konventionellen Datenbankers wie ein moderner Astronaut von einem mittelalterlichen Astrologen.
Big Data bedeutet eben nicht, eine ultimative Wahrheit zu finden, nicht die korrekte Version von Daten kultisch zu verehren, sondern durch statistische Verfahren einer möglichen Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Das ist etwas vollständig anderes als die klassische Excel- und Datenbank-Zahlenpfuscherei.
Big Data passt in keine Excel-Tabelle.
Um wirklich große Datenmengen zu halten und zu verarbeiten, benötigt ein Unternehmen mehr als Excel. Voraussetzung ist eine Datenbank oder – noch besser – das Zusammenführen möglichst aller Daten eines Unternehmens in ihrem Originalformat in einen sogenannten „Datensee“ [4].
Mit der Größe des Datensees steigen aber auch die Anforderungen an die Datenhaltung. Da sie auf mehreren Computern bzw. Servern gleichzeitig läuft, muss sie das gleiche Ergebnis liefern, egal, welcher Computer angesprochen wird. Sie muss auch dann funktionieren, wenn einzelne Computer ausfallen und zwar ohne dass Daten verlorengehen. Und schließlich darf die Suche nach den Daten nicht länger dauern, nur weil sich die Menge der Daten, in denen gesucht wird, verzigtausendfacht. Die bekannteste Technologie, die all diese Probleme löst, heißt HADOOP und ist defacto Standard, wenn es um Big-Data-Verarbeitung geht [5].
Wenn man genügend viele Daten gesammelt hat, kann man diese doch auch gleich vermarkten – immerhin verbessert das die Liquidität des eigenen Unternehmens, stärkt Deutschland als Datenstandort und diese wertvolle Ressource wird nicht nach Amerika abgezogen.
Big Data reimt sich auf Analytics – wer Daten sammelt, investiert in diese. Und daher gehört die Datenwissenschaft – Data Science – zum Datensammeln wie die Raben zum Tower von London. Auch die Art, wie Daten ausgewertet werden, hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert.
In der Vergangenheit stellten Wissenschaftler, Statistiker oder Mathematiker Thesen auf und prüften dann, ob sich in Daten Belege dafür finden ließen, dass ihre Thesen zutreffend seien.
Angenommen, ein Unternehmer hat den Eindruck, sein Produkt würde besonders oft von jungen Menschen (20–30 Jahre) gekauft. Um diese These zu belegen, wird ausgezählt, wie viele Personen dieser Altersgruppe zum Kundenstamm zählen.
Im Beispiel sind es 45 % junge und 55 % ältere Kunden. Obwohl es mehr alte als junge Kunden sind, ist die Arbeit damit noch nicht getan! Denn nun wird das Ergebnis mit der Grundgesamtheit verglichen. Da tatsächlich nur 15 % aller Deutschen zur Altersgruppe 20–30 zählen, ist die Annahme tatsächlich richtig: Die Käufer sind überdurchschnittlich oft jung.
In der modernen Data Science wird das Verfahren umgedreht. Computer ermitteln Zusammenhänge (die sogenannte Korrelation) zwischen den Daten und schlagen Thesen vor, die dann auf Plausibilität geprüft werden können.
Solche Thesen könnten sein: „Ihr Umsatz ist an Regentagen um 5 % höher als an Tagen ohne Niederschlag“ oder „Menschen, die in einem Haus am Waldrand wohnen, besuchen ihre Zahnarztpraxis häufiger als andere“.
Während es in der Vergangenheit schwierig war, die Korrelationen zu berechnen, übernimmt dies der Computer quasi „nebenbei“ und das hat deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Ein neues Berufsbild ist entstanden: der Data Scientist.
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter mit ausgeprägtem, mathematischem Sachverstand? Wenn ja, versuchen Sie in der Gruppe diejenigen zu finden, die nicht nur Zahlen und Logik, sondern auch die unternehmerischen Zusammenhänge verstehen. Leute, die verstehen, dass Schwarz und Weiß nicht Gegensätze sind, sondern die Basis für Grau und alle seine Schattierungen – diese brauchen Sie für Big Data.





























