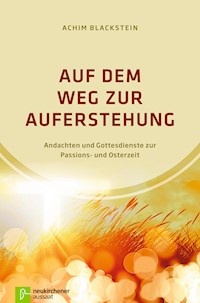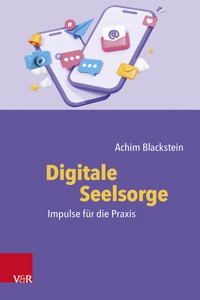
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Nachfrage nach Seelsorge und Beratung im Internet ist schon jetzt enorm. In Zukunft wird der Bedarf weiter steigen und auch Kirchengemeinden vor Ort werden sich darauf einstellen müssen. Wie funktioniert aber eine Seelsorge im digitalen Raum, die nur schriftlich Informationen austauscht, an der Menschen anonym teilnehmen oder die auf Social Media, per Chat, Video oder im Messenger angefragt wird? Achim Blackstein gibt Anleitungen und Beispiele für eine Seelsorge, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt und sich selbst als gesundheitsfördernden Beitrag zum Wohl der Menschen versteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Achim Blackstein
Digitale Seelsorge
Impulse für die Praxis
VANDENHOECK & RUPRECHT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © Adobe Stock/accogliente_3D
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99326-3
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Log-in – eine Annäherung
Zur Haltung in der digitalen Seelsorge
Online gut in Kontakt kommen
Schriftbasierte Seelsorge
Chat
Gruppen
Netiquette
Oraliteralität
Die E-Mail lesen
Fragetechniken
Zwischen den Zeilen lesen
Auf die E-Mail antworten
Nachbereitung der schriftbasierten Seelsorge
Warum uns Schreiben guttut
Videogespräch
Bild oder Ton
Störungen im Videogespräch
Verhalten vor der Kamera
Selbstfürsorge am Arbeitsplatz
Zoom-Fatigue
Nachbereitung eines Videogesprächs
Hybrid oder blended
Messenger
Zeitliche Abgrenzungen
Emojis
Sprachnachrichten in der Seelsorge
Messenger als Broadcaster
Seelsorge über den Status
Besondere Situationen, Krisen, Suizidales
Suizidalität
Fakes und Inszenierungen
Vielschreiber und Vielschreiberinnen
Stagnierende Gespräche
Grenzen in der digitalen Seelsorge
Gespräche beenden
Datenschutz und Schweigepflicht
Digitale Seelsorge in der Kirchengemeinde
Digitale Seelsorge und Klimakrise
Social Media
Apps, Tools und Ressourcen
Evermore
KrisenKompass
Andachtsapp
Die-Bibel.de-App
DemenzGuide
Aufstellungsarbeit
Whiteboard
Verstofflichen
Meditation
Anker-Übung
Die Zukunft digitaler Seelsorge
Log-out
Literatur
Vorwort
Die Digitalisierung hat inzwischen alle Lebensräume erreicht und so sind auch die Kirchen aufgefordert, sich mit neuen Fragen zu beschäftigen. Der Bedarf an Seelsorge ist nach wie vor groß und nicht zuletzt während der Coronapandemie ist auch die Nachfrage nach digitalen Formaten gestiegen.
Dabei war die Seelsorge schon lange vor der pandemisch bedingten Notwendigkeit, auf digitale Settings umzusteigen, im virtuellen Raum vertreten. Die ersten Angebote der Online-Beratung wurden in Deutschland bereits Mitte der 1990er Jahre von der Telefonseelsorge entwickelt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und Mediatisierung unserer Alltagswelt haben sich auch unsere Kommunikationsformen grundlegend verändert. Viele Gespräche, die zuvor in Präsenz oder telefonisch stattfanden, erfolgen inzwischen digital vermittelt – seien es im beruflichen Kontext vor allem E-Mails oder Videokonferenzen oder im privaten Bereich Messenger wie WhatsApp & Co.
Kommunikation und Austausch sind häufig schriftbasiert, sodass man fast von einer »Renaissance der Schriftlichkeit« sprechen könnte. Schreiben ermöglicht eine besondere Form der Selbstreflexion. Man sieht sich selbst beim Denken zu und kann das fertige Produkt mit anderen teilen. In der Online-Beratung hat sich daher die schriftbasierte Beratung per E-Mail oder Chat in den letzten 25 Jahren etabliert und als besonders wertvoll gezeigt. Gerade auch in seelsorglichen Kontexten, in denen es oftmals um längere Prozesse und ein vorsichtiges Vortasten geht, ermöglicht das Schreiben Resonanzräume.
Mit Beginn der Covid-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen der direkten Begegnung im physischen Raum wurden neben den klassischen Formen der Online-Beratung auch Videogespräche als Möglichkeit eingeführt. Das videovermittelte Gespräch ermöglicht hierbei vor allem Menschen den Zugang zu Unterstützungsangeboten, für die schriftliche Kontakte zu hochschwellig sind. Nicht zuletzt, da sie auch über ein Smartphone stattfinden können und die technischen Voraussetzungen inzwischen relativ gering sind.
In diesem Buch vermittelt Achim Blackstein wichtige »Impulse für die Praxis« seelsorglichen Arbeitens in digitalen Settings. Dabei wird die Seelsorge nicht digital, wie der Titel vielleicht zuerst vermuten lässt. Vielmehr wird der digitale Raum mit Menschlichkeit und Zuversicht gefüllt. Der Autor lässt die Lesenden an einer persönlichen Reise durch diesen digitalen Erfahrungsraum teilhaben. Neben wichtigen Fakten zum Thema »Datenschutz und Technik« sowie konkreten Tipps für Programme und Apps lädt Achim Blackstein vor allem dazu ein, den Möglichkeiten der digitalen Seelsorge mutig und offen gegenüberzustehen.
Ihm gelingt dies vor allem deshalb gut, da er viele Textbeispiele und eigene Erfahrungen teilt und mit einer metaphernreichen Sprache und einem klaren Bezug zum kirchlichen und seelsorglichen Arbeitsfeld schreibt. Zu den einzelnen Themen finden die Lesenden kleine Übungen und Denkimpulse, die immer wieder zu einer persönlichen Reflexion einladen.
So kann dieses Buch vor allem als Wegweiser und Begleiter verstanden und genutzt werden. Und als eine Einladung an seelsorglich Tätige, sich mit aktuellen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren: die Menschen, die nun auch über digitale Wege erreicht werden können und die von digitaler Seelsorge profitieren, da diese sie in ihrer Lebenswelt abholt.
Prof. Emily M. Engelhardt
Einleitung
Haben Sie sich das auch schon mal gefragt: »Wie ist das früher nur ohne gegangen?«
Ein Leben ohne Internet ist kaum noch vorstellbar. Ob wir uns auf Social-Media-Plattformen mit Freunden verbinden, online einkaufen oder Nachrichten lesen – das Internet ist unser ständiger Begleiter. Früher waren die Möglichkeiten des Internets begrenzt und das Surfen im Netz war mit einem Modem und einem klingelnden Geräusch verbunden. Heute können wir auf eine Vielzahl von Angeboten zugreifen, die uns das Leben leichter und unterhaltsamer machen. Wir können unseren Tag mit einem Work-out-Video auf YouTube beginnen, uns während der Arbeit mit einem Podcast ablenken oder abends auf Netflix unsere Lieblingsserie streamen. Auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, hat sich durch das Internet verändert. Die sozialen Medien haben eine neue Dimension der Vernetzung geschaffen und uns ermöglicht, Kontakte auf der ganzen Welt zu knüpfen. Jederzeit und überall bleiben wir nun mit Freunden und Familie in Kontakt und teilen unsere Gedanken und Erlebnisse mit ihnen. Auch das Einkaufen ist anders geworden. Wir suchen, vergleichen und kaufen längst online, was wir brauchen oder haben möchten, ohne jemals unser Zuhause verlassen zu müssen. Das Internet ist nur ein Teil unseres Alltags, es bestimmt und begleitet unser Leben an jedem Tag und zu beinahe jeder Stunde. Wo sollen wir auch sonst die passenden Rezepte finden oder klären, wer wann wen von der Schule oder Arbeit abholt?
Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich so etwas wie eine Revolution mitgemacht und sie ist eigentlich noch gar nicht beendet. Die Digitalisierung geht weiter. Und mittlerweile hat sie auch die Kirche erreicht. Gottesdienste oder Andachten werden gestreamt und bei YouTube hochgeladen, Trauer- oder Taufgespräche werden auf einem Videokonferenz-System geführt und die Fotos der Feiern finden sich nicht selten dann auf den persönlichen Seiten der Social-Media-Kanäle und Messenger. Auch Seelsorge ist online gegangen. Schon lange sogar. Seit 1995 gibt es institutionalisierte Seelsorge per E-Mail und seit 2003 auch als Chatgespräch. So vieles ist in den vergangenen Jahrzehnten entstanden und gewachsen und vieles hat während der Coronapandemie noch einmal einen neuen Schub erfahren oder wurde dann erst erfunden und aufgebaut. Das Internet hat uns verändert und wird es sicher weiter tun. Eine neue Art des Zusammenlebens ist entstanden, eine neue Art sich zu informieren, eine neue Art, das Leben mit all den Herausforderungen zu meistern. Und das ist oft gut so, denn durch die Digitalisierung haben mehr Menschen ein höheres Maß an Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erhalten. Und so wenden sich auch immer mehr Menschen online an Seelsorgerinnen und Seelsorger, um Hilfe, Unterstützung oder Begleitung bei Fragen und Problemen oder in schwierigen Zeiten zu erhalten. Die Nachfrage nach digitaler Seelsorge hat in den letzten Jahren enorm zugenommen und stellt die Kirche vor verschiedene Herausforderungen, personell, aber auch datenschutztechnisch.
Mit diesem Buch möchte ich eine praktische Einführung in die digitale Seelsorge vorlegen. Aus der Praxis, für die Praxis. Und, das werden Sie merken, an vielen Stellen sind die Überlegungen und Methoden pragmatisch und vor allem optimistisch. Ich sehe die Möglichkeiten und reflektiere die Chancen der digitalen Seelsorge und möchte sie gerne nutzen. Dabei achte ich die Grenzen, lasse mich aber von Zweifeln oder Zögern nicht abhalten. Es ist Zeit. Die digitale Seelsorge ist gekommen, um zu bleiben, und wir dürfen, müssen bereit sein, mitzugehen und uns anzupassen. Das Angebot, sich anonym zu melden, die örtliche und zeitliche Flexibilität, das niedrigschwellige Teilnehmen und nicht zuletzt auch die eingesetzte Technik sorgen vor allem dafür, dass digitale Seelsorgeangebote gerne in Anspruch genommen werden.
Fragt man Menschen, die sich an die digitale Seelsorge wenden, warum sie sich für dieses Medium entschieden haben, dann antworten viele, dass es gerade die anonyme, schnelle und unkomplizierte Hilfe ist, die sie erwarten und hier bekommen. Wie gesagt, eine Chance für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich auf die digitale Welt und ihre Bedingungen einlassen möchten. Die sich trauen, hier und da immer wieder Pionierarbeit zu leisten, und die sich voll und ganz auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers einstellen können.
Darum freue ich mich, wenn Sie sich anstecken lassen von den hier beschriebenen Wegen und Fenstern digitaler Seelsorge. Ich hoffe, eine große Vielfalt an Anregungen und Ermutigungen zu liefern, die Ihren Dienst als Seelsorgerin oder Seelsorger, als Beraterin oder Berater im digitalen Raum angenehm und hilfreich machen. Lassen Sie sich ermutigen und motivieren. Ich habe mich bemüht, möglichst direkt und aus dem täglichen Tun heraus zu schreiben. So, wie ich es bisher selbst erleben und kennenlernen durfte. Aber ich sage es gleich zu Beginn: Dieses Buch ist nicht vollständig. Bestimmt fehlt ein wichtiges Seelsorgebeispiel, ein richtig gutes Angebot, eine wichtige App oder ein hilfreiches Tool, das hier hätte geteilt und benannt werden können. Und ganz sicher gibt es noch mehr Beispiele für Beratungsanfragen und Seelsorgethemen. Vielleicht würden Sie auch auf die hier vorgestellten E-Mail- und Chatgespräche anders reagieren, vielleicht würden Sie anders antworten, anders schreiben oder andere Fragen stellen. Es ist gut, wenn wir alle unsere eigenen Arten, Vorlieben und Erfahrungen in die Seelsorge einbringen. Bestimmt machen Kolleginnen und Kollegen in der digitalen Seelsorge auch ganz andere Erfahrungen und ziehen ganz andere Schlüsse, als ich es hier tue. Wie überall in der Arbeit mit und für Menschen gibt es nicht den einen richtigen Weg. Wir Menschen sind nicht einheitlich, auch wenn wir miteinander ähnliche Bedürfnisse und Wünsche teilen. Darum ist es gut, wenn wir viele verschiedene, sich voneinander abgrenzende und einander ergänzende, auf jeden Fall respektierende Ansätze verfolgen und Erfahrungen austauschen. Vielfalt ist ein positiver Wert, der es umso mehr Menschen ermöglicht und sie ermutigt, Kontakt zu einer Beratungsstelle oder Seelsorge aufzunehmen. Folgen Sie also Ihrem Herzen und nehmen Sie auf diesem Weg eine gehörige Portion guter und reflektierter Ausbildung mit, inklusive Supervision und kollegialer Beratung. Es freut mich, wenn dieses Buch jeweils einen kleinen Teil dazu beitragen kann.
Ich schreibe hier allgemein von Ratsuchenden und Ratgebenden oder beratenden Menschen. Es ist klar, dass nicht alle, die sich an die Seelsorge wenden, Rat suchen und nicht alle Seelsorgerinnen oder Seelsorger sich als Ratgeberin oder Ratgeber verstehen. Schon gar nicht in dem Sinne, dass Ratschläge erteilt werden. Seelsorge ist etwas anderes als Beratung und trotzdem gehört es zum weiten Feld beratender Tätigkeiten. Mit den Bezeichnungen Ratsuchende und Ratgebende soll keine Hierarchie eingeführt werden. Seelsorge kann nur im partnerschaftlichen Miteinander auf Augenhöhe stattfinden. Es werden aber Blickrichtungen beschrieben, die aufeinander bezogen sind.
Mir ist eine geschlechtergerechte Sprache wichtig. Wer Seelsorge als Begegnung auf Augenhöhe versteht, kann Menschen nicht in einer generischen Geschlechtsbezeichnung mitmeinen, sondern muss versuchen, (möglichst) alle anzusprechen und damit anwesend sein zulassen. Darum versuche ich durchgehend zu gendern und von Seelsorgern und Seelsorgerinnen zu sprechen oder auch allgemein von Seelsorgenden oder Ratsuchenden.
Die hier geschilderten Chat- und E-Mail-Gespräche wurden von mir zur Anonymisierung in Anlehnung an reale Gespräche neu verfasst.
Einige der hier genannten Apps, Webseiten und Systeme haben sich dem kirchlichen Datenschutz unterworfen, andere arbeiten nicht EKD- oder KDG-DSG-konform. Die Einbindung in die seelsorgliche und beraterische Arbeit erfolgt in eigenem Ermessen und auf eigene Verantwortung und sollte transparent mit den ratsuchenden Personen besprochen werden.
Dieses Buch möchte einen ersten Einblick geben, Handwerkszeug vermitteln und vor allem eine Ermutigung sein, sich mit Seelsorge im digitalen Raum zu beschäftigen und es auszuprobieren. Ob in Social Media, per Messenger, im Videogespräch oder etwas klassischer im E-Mail- oder Chatgespräch. Es lohnt sich! Für ratsuchende Menschen genauso wie für ratgebende und zuhörende Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen, Krankenhäusern, Einrichtungen und Werken, Kirchengemeinden und Initiativen, aber auch Beratungs- und Fachstellen.
Vieles in diesem Buch durfte ich über die Jahre selbst durchführen und ausprobieren, manches habe ich bei anderen erlebt oder begleitet. So sind in dieses Buch nicht nur meine persönlichen Erfahrungen eingegangen, sondern auch viel geteiltes Wissen und erprobte Ideen aus zahlreichen Fortbildungen, Supervisionen, Vorträgen, Gesprächen und Feedback. Vielen Dank für alles!
Ein besonderer Dank geht an Annegret von Collande (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers), Stefanie Hoffmann (EKD Stabsstelle Digitalisierung), Christine Tergau-Harms (Evangelischlutherische Landeskirche Hannovers), Carel Mohn (klimafakten.de) und Lutz Neumeier (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) für ihr Feedback und ihre Anregungen zu einzelnen Kapiteln.
»Do not be dismayed by the brokenness of the world.
All things break.
And all things can be mended.
Not with time, as they say, but with intention.
So go.
Love intentionally, extravagantly, unconditionally.
The broken world waits in darkness for the light that is you.«
L. R. Knost1
_________________
1http://lrknost.com.
Log-in – eine Annäherung
Seelsorge darf »agil« sein. Das heißt: flexibel und darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ zugleich. Den Begriff des »Agilen« kennen wir aus der Unternehmensführung. Agile Unternehmen richten ihre Strategien am Kunden aus und streben eine Maximierung des Kundennutzens an.
Für die Seelsorge bedeutet das, nicht selbst allein geltende Maßstäbe festzusetzen, was und wie Seelsorge ist und was nicht, sondern die zu fragen, die Begegnung in Anspruch genommen oder erlebt haben, ob das gerade Seelsorge für sie war. »War das etwas für dich? War das nützlich oder hilfreich für dich?«
Jesus hat die Menschen da aufgesucht, wo sie waren. Geografisch, biografisch. Niemand musste damals bei Jesus Bedingungen erfüllen, sich würdig erweisen oder als gläubig bestehen. Er hat die Menschen so genommen, wie sie waren, und ist den Menschen in den Situationen begegnet, in denen sie sich befanden. Und genau dort hat er getan, was getan werden musste. Gleichnishaft wird das in seiner Rede vom Weltgericht (Mt 25) deutlich. In Anlehnung an seine Worte können wir heute sicher sagen: »Ich war online und ihr habt euch mit mir vernetzt.«
Das darf für uns Antrieb und Auftrag sein: seelsorglich im Internet engagiert und präsent zu sein. Folgen wir ihm also digital.
Wir tun das, was wir tun, nicht irgendwie. Wir begegnen einander nicht irgendwie. Wir tun das, was wir tun, auf und in der Art und Weise, wie wir der Welt, den Menschen begegnen in Wort und Tat, in Kommunikation und Handeln. Im Englischen heißt es: »The outer world is a reflection of the inner world.« Und in unserer »inner world« sind wir und ist der andere Mensch immer geliebtes Geschöpf. Wertvoll in Gottes Augen. Gerettet, rechtfertigt. Gottes Ebenbild. Ein Geschenk. Ein möglicher Engel. Ein Brief Gottes. Wie wunderbar wäre es, wenn sich diese Überzeugung in jeder Äußerung reflektieren würde – auch für uns selbst!
Es gibt eine Reihe von Fragen in der Bibel, deren Intention oder Fragerichtung sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch der Bücher zieht.
– Nachdem Adam und Eva von der Frucht des verbotenen Baumes im Garten Eden gegessen hatten, fragte Gott: »Mensch, wo bist du?« (vgl. Gen 3,9)
– Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, fragte Gott: »Wo ist dein Bruder Abel?« (vgl. Gen 4,9)
– Als Jesus erkrankten Menschen begegnete, fragte er sie eigentlich immer: »Was kann ich für dich tun?« (vgl. Mk 10,51; Lk 18,41)
– Als ein Gesetzeslehrer Jesus fragte: »Wer ist denn mein Nächster?«, antwortete Jesus: »Der, dem du helfen kannst.« Oder als Frage formuliert: »Wem kann ich ein Mitmensch werden?« (vgl. Lk 10,25 ff.)
– Mensch, wo bist du? Wo ist dein Bruder? Was kann ich für dich tun? Wem kann ich ein Mitmensch werden?
Häufig sind es rhetorische Fragen. Fragen, bei denen sich die Antwort wie von selbst aus dem Kontext ergibt, manchmal auch mit gesundem Menschenverstand wie von selbst beantwortet werden kann. Es sind Fragen, die in die Begegnung führen, die Menschen zusammenbringen, die uns einander zur Gabe und Aufgabe machen, uns aufeinander beziehen und uns an unsere Verantwortung füreinander erinnern.
Es sind diese Fragen und viele Geschichten und Gleichnisse aus der Bibel, die die große Bewegung Gottes zur Welt, zur Begegnung mit der Schöpfung, mit den Menschen, erzählen und uns gleichzeitig mit hineinnehmen wollen, diese Bewegung Gottes in der Bewegung von Mensch zu Mensch fortzusetzen. Individuell und gesellschaftlich, zumindest natürlich kirchlich, erst recht seelsorglich. Menschen sollen sich nach Gottes Willen begegnen. Und ist das Internet, der digitale Raum, nicht ein wunderbarer, weil niedrigschwelliger Begegnungsraum?
Weil Menschen sich verbinden mögen, fungiert das Internet als »Internetz« zwischen ihnen. Es ist die moderne Infrastruktur heutiger Begegnungen und Beziehungen. Das ist es natürlich nicht nur. Aber in, mit und unter diesem Internet findet Kontakt statt. In ihm, mit ihm (durch es) und unter seinen Möglichkeiten, Räumen, Zeiten und Bedingungen. Als Kirche haben wir hier die Chance, unsere seelsorgliche Haltung mit einzubringen. Insofern ist Seelsorge tatsächlich interaktiv. Und darum ist Seelsorge im digitalen Raum so gut aufgehoben. Darum hat sie dort ihren Sitz, Sinn und Nutzen. Die spezifischen Bedingungen des Internets tun ihr gut. Gerade das Internet und die in ihm befindlichen medialen Angebote öffnen Türen zu den Menschen. Hier können sie selbst so (inter-)agieren, wie sie es selbst möchten und wie es ihnen entspricht. Das sorgt mehr und mehr für eine Begegnung auf Augenhöhe, ja sogar für eine größere Demokratisierung der Seelsorge.
Eine, vielleicht sogar die Grundfrage des Internets lautet: Wie kommen wir miteinander in Kontakt oder in die Begegnung? Und das ist doch zugleich eine zutiefst seelsorgliche Frage. Auch in der Seelsorge geht es um die Begegnung und um ein In-Kontakt-Kommen.
Wir wissen, dass Botschaften auf verschiedene Ohren stoßen können. Wir wissen auch, dass es verschiedene Wege braucht, um die Botschaften hörbar werden zu lassen, weil wir mit verschiedenen Ohren hören. Niedrigschwelligkeit, also die Chance, möglichst viele verschiedene Ohren zu erreichen, erlangen wir durch eine Vielfalt an Angeboten. Insofern können wir nur sagen: Seelsorge im Internet – wo denn sonst?!
Wir sind alle Menschen, aber eben nicht alle gleich. Manche Menschen schreiben lieber. Andere möchten sehen und gesehen werden. Wieder andere schreiben erst mal, um dann das Medium zu wechseln. Andere sprechen am Telefon. Der digitale Raum hat all das und noch mehr im Angebot, und zwar bei aller verbindlichen Unverbindlichkeit. Die kommunikative Grundhaltung bietet Freiraum. Ein Raum, in dem ich mich öffnen mag und öffnen kann. Wir brauchen das seelsorglich nur aufzugreifen und uns darauf einzustellen. Die Erfahrung zeigt dabei, dass gerade die Paradoxie »Nähe durch Distanz« es den Ratsuchenden ermöglicht, sich relativ schnell zu öffnen und auch sehr persönliche Themen anzusprechen.
Nicht jeder ist gleich in der Lage zu einem Face-to-Face-Kontakt. Manche brauchen Anonymität, andere gerade nicht. Niemand kann in einen anderen Menschen hineinschauen. Das kann nur in einem Gespräch, einer Begegnung geschehen, wenigstens ansatzweise und soweit es die andere Person zulässt. Darum wissen wir erst einmal nicht, wie es ihr geht. Viele wissen das ja selbst nicht. Wir wissen erst mal nicht, woran oder worunter sie leidet. Wir kennen ihre Geschichte nicht und nichts von ihren Lasten und nichts von ihren Ressourcen. Darum sind Orte und Gelegenheit der Begegnung nötig. Und eine Haltung, die fragt und nicht urteilt oder bestimmt. Und weil Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Fragen und Hintergründe haben, brauchen wir ein vielfältiges Angebot.
Wir brauchen also unterschiedliche Türen zur Seelsorge oder Beratung, verschiedene Wege und Kommunikationsangebote, und doch findet überall Ähnliches statt: Wir fördern das Leben unseres Nächsten. Und wir teilen die Erfahrung und den Zuspruch, dass der Nächste heilsam ist, allein durch sein Dabeisein. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht. Wir stärken die Lebens- und Glaubensgewissheit der Menschen. Wir helfen dabei, die persönliche Resilienz und Problemlösekompetenz zu erweitern. Wir schenken Zeit, Ermutigung, Wertschätzung, Nächstenliebe, sprechen Vergebung zu und Segen. Und das ist wichtig, gerade in diesen Corona-Klimawandel-Kriegs-Krisen-Zeiten, wo so vieles anders ist und wegbricht, neu gelernt und ausprobiert oder weggelassen werden muss.
Als Menschen sind wir »wireless« unterwegs. Hin und wieder brauchen wir eine Dockingstation, um zur Ruhe zu kommen, aufzuladen, uns neu zu orientieren, mit anderen zu verbinden, um weitergehen zu können. Es wäre ein Segen, wenn dieser Ort, wo wir Netz finden, auch die Kirche mit ihren Seelsorge- und Beratungsangeboten ist.
Auch wenn viele immer noch von den »neuen Medien« sprechen: Digitale Seelsorge wird bereits seit fast 30 Jahren durchgeführt und angeboten. Und sie ist mit den sich entwickelnden Möglichkeiten und neuen Gewohnheiten mitgewachsen. Als 1995 die E-Mail-Seelsorge durch Jakob Vetsch in der Schweiz eingerichtet und aufgebaut wurde, war E-Mail das Kommunikationsmedium im digitalen Raum schlechthin. Mit dem Erscheinen erster sogenannter Communities, wie FunCity, kam dann die Möglichkeit zu chatten hinzu. 2002 entstand die Chatseelsorge der Landeskirche Hannovers (https://chat-seelsorge.evlka.de), gemeinsam mit der Kirche im Rheinland. Und vieles änderte sich nochmal mit der Erfindung des Smartphones 2007 von Apple. Es sorgte vor allem für eine andere Haptik aufseiten der Nutzer und läutete den Siegeszug der kleinen Taschenallrounder ein, die wir heute noch bewundern und täglich viele Stunden nutzen. Jetzt können wir aussuchen, ob wir E-Mails schreiben, chatten oder doch lieber die Kamera für ein Videogespräch aktivieren. Und nicht selten passiert das alles zeitgleich und zudem mobil. Immer und überall sind wir nicht nur erreichbar, wir erreichen auch andere ganz unabhängig von Raum und Zeit und dabei auf dem Kanal, der uns im Moment oder für dieses Anliegen am besten erscheint. Mittlerweile sind die Möglichkeiten noch weitergewachsen. Systeme für Videokonferenzen sowohl mit Kamera als auch mit Avataren sind dazugekommen. Die Datenübertragung und damit die Stabilität der Verbindung auch von unterwegs wird immer besser und ermöglicht auch eine Kommunikation von unterwegs oder aus fernen Ländern. Social-Media-Plattformen vernetzen Menschen weltweit miteinander und sorgen für einen Kontakt auf Augenhöhe. Gleichzeitig sind Einzelne zu Influencern gewachsen, die mitunter viele Tausend sogenannter Follower haben und auf deren Wort gewartet und deren Ratschläge und Ideen befolgt und ausprobiert werden. Dabei geht es zum einen um Marketing, zum anderen um Sinnfragen und Lebenshilfe. Und es ist erstaunlich, wie offen Menschen hier miteinander kommunizieren, wie sehr sie sich selbst zeigen und ihre Probleme oder Herausforderungen beschreiben, wie sehr sie dem Gegenüber, aber auch dem digitalen Raum trauen, unabhängig von allen Fragen zu Datenschutz und mehr. Was bedeutet das für die Seelsorge? Welche Schlussfolgerungen, vor allem, welche Ermutigungen für unsere Arbeit und Angebote ziehen wir daraus?
Viele Menschen suchen im Internet nach Antworten auf ihre Fragen. Laut der international am meisten genutzten Suchmaschine Google stellten die Menschen im Jahr 2020 weltweit mehr als jemals zuvor die Frage nach dem Warum: Warum sterben so viele Menschen an Corona? Warum brennen in Australien die Wälder? Warum ist Empathie so wichtig? Warum ist Demokratie wichtig? Die Menschen fragten nach dem Leben und seinen Zusammenhängen und Kontexten.
Im Jahr 2021 fragten die Menschen u. a.: Wie werde ich gesund? Wie kann ich auf meine psychische Gesundheit achten? Wie bleibe ich stark? Wie kann ich meine Widerstandskraft verbessern? Was ist meine Aufgabe im Leben? Wie können wir den Planeten schützen?
Im Jahr 2022 suchten die Menschen Antworten auf die Fragen (vgl. https://about.google/stories/year-in-search/): Wie kann ich mein Leben verbessern? Kann ich mich verändern? Wie kann ich positiver sein? Wie kann ich meine Einstellungen ändern? Kann ich es schaffen?
Das sind im Kern seelsorgliche Fragen. Fragen nach dem Leben und Überleben, nach Ressourcen und Kraftquellen, nach Identität und Identifikation, nach Umkehr und Neuanfang, nach Sinn und Auftrag.
Und auch wenn das nur ein Schlaglicht, ein kleiner Ausschnitt aus der weltweiten Suchbewegung der Menschen ist, wird für mich deutlich: Menschen haben immer noch Fragen und sie suchen ihre Antworten im Internet. Das heißt, Menschen vertrauen dieser Suchmaschine, diesem digitalen Ort und auch den Antworten und Antwortgebern. Natürlich werden noch viel mehr Orte und Menschen befragt, nicht nur digital, sondern auch analog, aber bei den vielen Nachrichten über digitale Trends, über Phänomene wie »Hate Speech« und »Fake News« und viele, viele weitere Oberflächlichkeiten dürfen wir nicht vergessen, dass der digitale Raum vielfältig ist und immer noch ein Ort der Begegnung, des Miteinanders, der Vernetzung und des Austausches ist. Menschliche Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Solidarität, Information und Teilhabe finden hier ihre entsprechenden positiven Antworten. Es ist viel Vertrauen im Netz. Das darf uns für Seelsorge ermutigen und auch anspornen.
Laut ARD-ZDF-Onlinestudie 2022 nutzen vier von fünf Personen in Deutschland das Internet täglich (https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/). Das sind 80 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Die User und Userinnen ab 14 Jahre nutzten durchschnittlich rund 234 Minuten, oder knapp vier Stunden am Tag, das Internet. 160 Minuten verwenden sie davon zur Mediennutzung. Dazu gehören das Ansehen von Videos, Hören von Audios, Podcasts, Radiosendungen oder Musik über Musikstreaming-Dienste, das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften sowie das Lesen von Texten auf Onlineangeboten von Fernsehsendern und auf Social-Media-Kanälen. Rund eine Stunde wird für die persönliche Kommunikation verwandt und eine weitere Stunde für Sonstiges. Die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen verbringt fast sieben Stunden täglich aktiv im Netz. Entsprechend mehr nutzen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die medialen Angebote (284 Minuten), aber auch die private Kommunikation (100 Minuten) und die sonstige Nutzung (133 Minuten) legen gegenüber dem Erwachsenendurchschnitt zu.
Von den Videodiensten ist YouTube insgesamt die meistbesuchte Seite. Facebook und Instagram sind weiterhin die größten Social-Media-Netzwerke, gefolgt von TikTok und Snapchat, Pinterest, Twitter und Twitch. Weit über die Hälfte der Angebote und Webseiten wird mobil angesteuert, vor allem mit dem Smartphone.
Wenn wir also fragen, wo die Menschen sind, dann finden wir im digitalen Raum eine der wichtigsten Antworten. Der digitale Raum ist gut gefüllt mit unseren Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden und Fremden. Die Menschen verbringen gerne und viel Zeit dort, surfen von einem Angebot zum nächsten oder auf dem Sofa zu Hause im Heimkino. Der digitale Raum ist längst zu einem immer verfügbaren, immer geöffneten und selbst zu gestaltenden Lebensraum geworden.
Off- und Online werden zusammengedacht. Und für die meisten Menschen gehört das eine zum Leben genauso dazu, wie das andere. Das Leben im Netz und die Kommunikation dort, wird als genauso echt empfunden wie in der präsentischen Welt. Wir leben digital bzw. eng verbunden mit digitalen Mitteln als täglicher Begleiter, viele Werkzeuge in einer Hand/in einer Maschine, handhabbar und damit auch mit dem Gefühl unterwegs, die Welt in der Hand zu haben, das Leben managen zu können. Und somit bringen die Menschen ihre Digitalität auch mit in die Seelsorge. Und wir dürfen davon ausgehen, dass sie, bevor sie zu uns kommen, ihre Themen, Probleme und Herausforderungen längst per Suchmaschine abgeklopft haben. Genauso werden schließlich wir als Anbieter, aber auch unsere Antworten und Hilfestellungen online überprüft, hinterfragt und mit weiteren Informationen ergänzt oder ersetzt.
Während der Höhepunkte der Coronapandemie wurden technische Hilfsmittel gern genommen. Was hätten wir verpasst, wenn wir nicht so schnell es ging, auf Videokonferenz-Systeme, Streaming und digitale Gesprächskanäle ausgewichen wären. Viel Kreativität und Wagemut wurde gezeigt und belohnt. Und auch wenn die Coronapandemie abzuklingen scheint, wir müssen uns gleichzeitig doch schon auf die nächste Herausforderung dieser Größenordnung einstellen. Es wäre gut, wenn wir dann auf erprobte Werkzeuge und eingeübte Praktiken zurückgreifen könnten. Auch darum ist es so wichtig, dass wir jetzt verstärkt in digitale Kanäle investieren und uns mit ihren Konsequenzen und ihrer Bedienung vertraut machen. Loggen wir uns also ein.
Zur Haltung in der digitalen Seelsorge
Wir bewegen uns mittlerweile in zwei verschiedenen Räumen, und das oft gleichzeitig. Wir sind offline und online unterwegs. Wir leben »kohlenstofflich« in der realen, nicht-virtuellen Welt und ebenso sind wir in der realen, aber virtuellen Welt aktiv und lebendig. Natürlich macht das noch nicht jeder Mensch und natürlich nicht jeder Mensch immer. Aber längst ist es auch kein Phänomen der Jugend oder jungen Erwachsenen mehr. Die Mediennutzung in unserer Gesellschaft insgesamt ist vielfältig und diffus geworden. Viele Menschen streamen oder verfolgen ein Fernsehprogramm und sind gleichzeitig mit dem Tablet oder Smartphone, dem sogenannten »Second Screen«, auf YouTube oder in den sozialen Medien aktiv. Die Grenzen verschwimmen und werden durchlässiger. Wir schippern gleichzeitig auf mehreren Kanälen. Die Online-Welt wird dabei genauso intensiv und real wahrgenommen wie die Offline-Variante. Durch das Smartphone, durch Wearables wie Smart-Watches oder Tracker und durch das mobile Internet gibt es für viele Menschen zwischen diesen beiden Welten kaum noch Grenzen, kaum noch einen Unterschied. Egal, wo wir uns befinden, wir können hier vor Ort und online überall sein.
Für die Seelsorge bedeutet diese veränderte Lebens- und Wahrnehmungsweise neue Herausforderungen, mit denen sie umzugehen und worauf sie sich einzustellen hat.
Früher war es klar und unumstritten: Seelsorge findet im abgeschirmten Raum statt. Das »Unter-vier-Augen-Prinzip« (face to face) war leitend. Auf die Verschwiegenheit der Seelsorgerin oder des Seelsorgers konnte man sich verlassen, nichts würde je von dem Gespräch nach draußen dringen. Und selbst wenn man sich, wie im Gemeindealltag so oft geschehen, zwischen Tür und Angel traf und sprach, so war man doch irgendwie für sich, sorgte mit gedrehtem Rücken und flüsternder Stimme für einen dezenten Rahmen der Abgeschiedenheit, auch als Zeichen für andere: Bitte gerade nicht stören!
Und es war auch so, je länger das Gespräch dauerte, je ernster die Themen, je dichter die Atmosphäre, desto mehr Seelsorge geschah gefühlt gerade – egal, ob es tatsächlich so war. Wer wollte es auch beurteilen?
Tja, und dann kamen das Internet und die Digitalisierung. Die Frage, wer eigentlich beurteilen könnte, wann was schon oder noch Seelsorge sei, wurde – wie die Mediennutzung – ebenfalls immer diffuser. Sind es die Anliegen, die es definieren und mit ihnen die religiöse Bindung? Oder die Dauer des Gesprächs? Oder die Verschwiegenheit? Und kann ein Bild, ein Video, ein Podcast in einem der Social-Media-Kanäle schon ein seelsorgliches Angebot darstellen, kann das schon Seelsorge sein? Und wenn nicht, was braucht es dann noch und wer bestimmt diese Kriterien eigentlich?
Nur eines wurde immer klarer: Eins zu eins lässt sich Offline-Seelsorge nicht in den Online-Raum transportieren. Und: Wir können nicht mit unseren analogen Kriterien und Kategorien digitale Angebote angemessen beurteilen. Zwischen WhatsApp und Twitter muss Verschwiegenheit anders gedacht werden (Stichwort »Datenschutz«). Bei Facebook ist »face to face« anders definiert. Das Internet sorgt für eine neue Bewertung dessen, was wir unter Seelsorge formal und inhaltlich verstehen dürfen. Es sind eben zwei unterschiedliche Räume und Realitäten, in denen wir uns da (oft) gleichzeitig bewegen. Wer sie dennoch gleichsetzt und in beiden gleich agiert, wird weder den Räumen und ihren Angeboten gerecht noch den Menschen, die sie nutzen. Wir brauchen neue Definitionen. Digitalisierung ist umfassender und umwälzender als nur die Umwandlung von analogen Daten in digitale. Digitalisierung verändert, wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, und das, was bei unserer Arbeit und durch unsere Arbeit geschieht. Es verändert darum auch unsere Theologie und unser Dasein an sich. Wir brauchen darum Begriffe, die weiterreichen als das, was bisher Seelsorge beschrieben hat, denn auch der digitale Raum ist weiter, ja grenzenlos. Und das ist gut so, denn für die Seelsorge ergeben sich so ganz neue Möglichkeiten.
Was tut Seelsorge eigentlich? Nehmen wir nur einmal das Wort beim Wort, dann sorgt Seelsorge für die Seele. Wobei mit »Seele« nach biblischem Verständnis aber nicht nur ein Teil des Menschen benannt wird, der irgendwo im Körper liegt und immateriell, vergeistigt vorhanden ist. Unter Seele versteht die Bibel im Großen und Ganzen den Menschen in seinem vollen Personsein. Die Seele, das bin ich und das bist Du in der Gesamtheit. Das Verständnis der Bibel von »Seele« ist natürlich im Detail vielfältiger, besonders in den jüngeren Schriften. Trotzdem möchte ich den roten Faden von hebräisch »nefesch« und griechisch »psyche« im Kern so zusammenfassen: Der Mensch hat nicht nur eine Seele, er ist eine Seele (Gen 2,7).