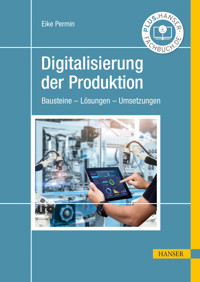
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses kompakte Einstiegswerk behandelt den Einsatz digitaler Systeme in produzierenden Unternehmen. Es unterstützt dabei, neue Technologien einzuordnen, Digitalisierungsbedarfe zu erkennen und digitale Anwendungen in der Produktion umzusetzen. Das Buch richtet sich an Studierende des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und des Wirtschaftsingenieurwesens, ist aufgrund seiner praktischen Ausrichtung aber auch für Mitarbeitende in Produktion und Fertigung geeignet. Zunächst erfolgt eine Einführung in die technischen Grundlagen und Bausteine der Produktionsdigitalisierung. Dies reicht vom Einsatz von Computern in industriellen Umgebungen über Datenaustausch und Vernetzung sowie Datenspeicherung und -verarbeitung bis hin zur Modellierung von Daten und zur Visualisierung von Informationen. Mit den eingesetzten Technologien, zu denen unter anderem Big Data, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie cyber-physische Systeme gehören, werden produktionstechnische Probleme gelöst. Das Buch stellt die wichtigsten Aufgaben digitaler Systeme in Produktionsstätten und Fabriken vor – von der Betriebsdatenerfassung über das Management von Maschinen und die Produktionsplanung bis zum Qualitäts- und Energiemanagement. Darüber hinaus liefert das Buch Werkzeuge und Methoden, die bei der Entwicklung eigener Ideen für digitale Anwendungen und bei der Umsetzung unternehmensspezifischer Lösungen helfen. Dazu gehören zum Beispiel Plattformen für Datenverarbeitung, maschinelles Lernen oder App-Entwicklung und je nach Aufgabenstellung klassische Projektmanagementfähigkeiten oder agile Arbeitsweisen. Am Ende jedes Kapitels sind Aufgaben zur Lernzielkontrolle und Weblinks zu weiterführenden Informationsangeboten zu finden. Auf plus.hanser-fachbuch.de stehen zusätzliche Arbeitshilfen und Vorlagen zum Projektmanagement und zu agilen Methoden bereit. Hinweise zu rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen und zur IT-Sicherheit sowie ein Ausblick auf Zukunftstechnologien wie das Quantencomputing runden den Inhalt ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eike Permin
Digitalisierung der Produktion
Bausteine – Lösungen – Umsetzungen
Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!
Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial.
Geben Sie auf plus.hanser-fachbuch.de einfach diesen Code ein:
plus-tk3u2-em5uu
Über den Autor:Prof. Dr.-Ing. Eike Permin, TH Köln
Print-ISBN: 978-3-446-48298-2E-Book-ISBN: 978-3-446-48337-8ePub-ISBN: 978-3-446-48358-3
Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen zusammengestellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen für Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor:innen, Herausgeber:innen und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.
Die endgültige Entscheidung über die Eignung der Informationen für die vorgesehene Verwendung in einer bestimmten Anwendung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 UrhG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Zwecke des Text- und Data Mining nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
© 2025 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Münchenwww.hanser-fachbuch.deLektorat: Julia SteppHerstellung: Melanie ZinslerCoverkonzept: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, MünchenCovergestaltung: Max KostopoulosTitelmotiv: © panuwat / AdobeStockSatz: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
1 Einführung
1.1 Herausforderungen durch die Digitalisierung der Arbeitswelt
1.2 Daten und Digitalisierung in produzierenden Unternehmen
1.3 Zielgruppen dieses Buches
1.4 Aufbau dieses Buches
2 Grundbegriffe
2.1 Die Automatisierungspyramide als Grundmodell
2.2 Veränderungen durch Industrie 4.0
2.3 Abgrenzung von Automatisierung und Digitalisierung
2.4 Ergänzungen durch Industrie 5.0
2.5 Lern- und Arbeitsmaterialien
3 Technische Grundlagen
3.1 Das Grundmodell eines Computers
3.2 Computer in der Produktion
3.3 Vernetzung und Datenaustausch
3.4 Datenspeicherung
3.5 Datenverarbeitung
3.6 Datenmodellierung
3.7 Visualisierung von Informationen
3.8 Lern- und Arbeitsmaterialien
4 Aufgaben digitaler Systeme in produzierenden Unternehmen
4.1 Maschinen und Anlagen überwachen
4.2 Maschinen und Anlagen reparieren und warten
4.3 Betriebsdaten erfassen, darstellen und auswerten
4.4 Material beschaffen und verwalten
4.5 Wertschöpfung orchestrieren
4.6 Qualitätsdaten managen
4.7 Prozesse und Abläufe strukturieren
4.8 Energieverbrauch messen und optimieren
4.9 Digitale Zwillinge erzeugen
4.10 Maschinen und Leistung mieten
4.11 Lern- und Arbeitsmaterialien
5 Digitale Systeme umsetzen und einführen
5.1 Entwicklung von Ideen
5.2 Ein Grundmodell der Komplexität
5.3 Klassisches Projektmanagement
5.4 Agile Arbeitsweisen
5.5 Plattformen einsetzen
5.6 Juristische Rahmenbedingungen
5.7 IT-Sicherheit
5.8 Lern- und Arbeitsmaterialien
6 Neue Technologien
6.1 Veränderung als Konstante
6.2 Künstliche Intelligenz
6.3 Blockchain
6.4 Quantencomputer
6.5 Lern- und Arbeitsmaterialien
7 Zusammenfassung und Ausblick
8 Lösungen zu den Aufgaben der Lern- und Arbeitsmaterialien
Ist Digitalisierung gut oder schlecht? Ist sie hilfreich oder böse? Wahrscheinlich ist die Frage falsch. Digitalisierung ist in vollem Gange. Sie verändert die Arbeitswelt, und damit auch moderne Fabriken und Produktionsstätten. Hieraus erwachsen neue Herausforderungen, vor allem aber auch Anforderungen, an Produktionsingenieur:innen. Dieses Buch soll dabei helfen, sich diesen Veränderungen nicht nur zu stellen, sondern sie, soweit möglich, zum Besten des Unternehmens sowie der eigenen Arbeitsumgebung zu gestalten.
1.1Herausforderungen durch die Digitalisierung der ArbeitsweltEines der am häufigsten zitierten historischen Beispiele für die Veränderungen der Arbeitswelt durch Computer und digitale Systeme stammt aus den 1980er-Jahren: Durch Einführung von Geldautomaten (englisch Automated Teller Machines, ATM) schien ein gesamter Berufszweig obsolet zu werden: Mitarbeitende an Bankschaltern hatten bislang vor allem die Aufgabe übernommen, Kund:innen Bargeld auszuzahlen. Da dies nun maschinell und somit schneller, fehlerfreier und günstiger umsetzbar war, erwarteten damals viele Menschen massive Entlassungen im Bankensektor. Rückblickend kann an den Mitarbeiterzahlen der größten Banken der USA aus den damaligen Jahren jedoch klar abgeleitet werden, dass eine solche Entlassungswelle trotz massiver Verbreitung der Geldautomaten nicht stattgefunden hat. Vielmehr hatten Mitarbeitende an Bankschaltern nun mehr Freiheiten, gewinnbringend auf ihre Kund:innen einzuwirken: Service, Hilfestellung und Beratung für Kredite und andere, komplexe Produkte nahmen stark zu. Diese wurden zu einem Differenzierungsmerkmal und schlussendlich zum Wettbewerbsvorteil. Anstatt Mitarbeitende an den Bankschaltern abzulösen, veränderte die Digitalisierung also Inhalte und Anforderungen an die Tätigkeiten dieser Menschen (Bild 1.1).
Bild 1.1Anzahl der Bankbeschäftigten und Anzahl der Bankautomaten in den USA (Quelle: Newport 2016)
Ähnliche Veränderungen stehen vielen Berufsgruppen erneut bevor. Andrew McAfee, Gründer des gleichnamigen erfolgreichen IT-Unternehmens, schrieb 2012 gemeinsam mit Erik Brynjolfsson, einem der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler der USA, Folgendes im Harvard Business Review (McAfee/Brynjolfsson 2012):
„Technologies like data visualization, analytics, high speed communications and rapid prototyping have augmented the contributions of more abstract and data-driven reasoning, increasing the values of these jobs.“
Hier wird klargestellt, dass die Digitalisierung sowie die Verarbeitung und Visualisierung von Daten also vor allem unterstützende Aufgaben für viele Berufe generieren werden und diese damit aufwerten. Cal Newport, US-amerikanischer Autor und Professor für Informatik, ging in seinem Buch Deep Work 2016 sogar noch weiter (Newport 2016):
„There are three groups of successful people. Those who are best at what they do, those with access to capital and those who can work well and creatively with intelligent machines […] Are you good at working with intelligent machines or not?“
Lässt man Zugang zu viel Kapital und guru-artigen Status einmal außen vor, stellt die Fähigkeit, gut und kreativ mit Computern umzugehen, zukünftig also den einen wesentlichen Erfolgsfaktor für viele Berufstätige dar. Gleichzeitig ist dies eine Fähigkeit, die erlernt, geübt und trainiert werden kann.
Die Welt der Produktion unterliegt den gleichen Randbedingungen. Computer und digitale Systeme werden bereits seit den 1980er-Jahren eingesetzt. Durch die technologischen Fortschritte und Veränderungen in den vergangenen Jahren, insbesondere unter der Überschrift „Industrie 4.0“, haben sich jedoch die Möglichkeiten und Potenziale exponentiell erhöht. Gleichzeitig nützt ein übereuphorischer, technologie- und fortschrittsgläubiger Umgang mit Digitalisierung wenig. Hype-Blasen wie jene rund um das Thema künstliche Intelligenz haben immer wieder gezeigt, dass einzelne digitale Technologien kontinuierlich auf ihre Potenziale, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen im Umfeld produzierender Unternehmen untersucht und bewertet werden müssen. Neben aller Begeisterung braucht es also auch immer ein Rahmenwerk, um dies zu bewerkstelligen. Neue Technologien, Trends und Begriffe zeichnen sich bereits heute am Horizont ab: Quantencomputer haben das Potenzial, klassische Rechner in einigen Leistungsbereichen um mehrere Größenordnungen zu schlagen. Die Europäische Union hat, in Anlehnung an Industrie 4.0, unlängst Industrie 5.0 eingefordert, und die jüngsten Erfolge von sogenannten Large Language Models wie ChatGPT haben gezeigt, dass auch innerhalb einzelner Technologiebereiche sprunghafte Innovationen immer wieder neue Anwendungsgebiete erschließen. Es braucht also für die Anwendung digitaler Technologien in der Produktion ein Rahmenwerk, das hilft, Veränderungen kontinuierlich zu beobachten und zu bewerten, Ideen für den Einsatz digitaler Technologien zu entwickeln und diese schließlich umzusetzen.
1.2Daten und Digitalisierung in produzierenden UnternehmenBitkom e. V., der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, erhebt regelmäßig Studien zu Aspekten der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft. Im Juni 2022 gaben in einer solchen Erhebung 89 % aller befragten Unternehmen an, bei der Digitalisierung auf eine Vielzahl unerwarteter Schwierigkeiten gestoßen zu sein (Berg 2022). Zwei Drittel der Befragten bezeichneten sich sogar selbst als „Nachzügler“ in diesem Bereich. Obgleich Digitalisierung als ein wesentlicher Faktor für Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit anerkannt wurde, gab über die Hälfte der befragten Unternehmen an, hier aufgrund von Fachkräftemangel nicht ausreichend aktiv zu sein. Die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten wird also eine wesentliche Aufgabe zukünftiger Fach- und Führungskräfte in deutschen Unternehmen sein. Produzierende Unternehmen, insbesondere der Maschinen- und Anlagenbau, spiegeln hierbei den allgemeinen Trend der Bitkom-Studie wider. Sich aktiv mit der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten zu beschäftigen, wird daher mehr und mehr zur Anforderung und zum Differenzierungsmerkmal für Ingenieur:innen im Produktionsumfeld.
Noch vor wenigen Jahren stellten einfache Programme zur Tabellenkalkulation die gängigsten Systeme für das Produktions- und Qualitätsmanagement dar. Marktstudien zeigten regelmäßig, dass über die Hälfte aller produzierenden Unternehmen diese Systeme einsetzt, um Arbeitsaufträge zu planen, Produktionsdaten auszuwerten, Ressourcen zu verwalten oder Entscheidungen zu treffen. Auch wenn der Markt für digitale Systeme in diesem Bereich in den vergangenen Jahren gestiegen ist, müssen wir davon ausgehen, dass bis heute die meisten Unternehmen nicht zeitgemäße Systeme und Lösungen einsetzen, um ihre Wertschöpfung zu steuern und zu optimieren. Dabei ergeben sich zwei zentrale Probleme:
1. Die meisten Tabellenkalkulationen und „Bastellösungen“ sind individuell aufgebaut und damit nicht auf andere Mitarbeitende, Kolleg:innen oder gar Abteilungen übertragbar.
2. Studien zeigen, dass jenseits einer bestimmen Größe eigentlich kein Tabellenblatt mehr frei von Fehlern ist.
Doch auch wenn Unternehmen sich für die Einführung professioneller Lösungen entscheiden, scheitern die meisten IT-Projekte an falschen Erwartungen, schlecht dokumentierten Anforderungen oder unerwarteten Hürden in der Implementierung. Dies gilt nicht nur, aber eben auch, für digitale Systeme in der Produktion. Ausreichend vorhandenes Fachwissen ist dabei stets eine essenzielle Komponente, um Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der Produktion bildet dabei keine Ausnahme. Ausreichend vorhandenes Fachwissen über grundlegende Technologien, Vorgehensweisen und Projektmanagement im digitalen Bereich ist damit längst ein wichtiger Baustein für Ingenieur:innen in der Produktion.
„Daten sind das neue Gold“ ist ein Satz, der so oder so ähnlich seit vielen Jahren im Umfeld von Big Data und Industrie 4.0 verwendet wird. Doch hat sich gezeigt, dass auch über zehn Jahre nach dem Aufkommen dieser Trendthemen nur ein Bruchteil aller Daten im Produktionsumfeld aktive Nutzung erfährt (Bild 1.2).
Bild 1.2Anteil aktiv genutzter Daten aus der Produktion (in Anlehnung an Beckschulte et al. 2023)
Auch wenn über immer günstigere Sensorik mehr und mehr Daten zumindest erfasst werden, ist der Weg zu einer aktiven Nutzung weit – sei es im Produktionsmanagement, im Qualitätsmanagement, in der Prozessauslegung oder in der Logistik. Denn hierfür braucht es wiederum Wissen über die Vernetzung von Systemen, über die Speicherung und Verarbeitung von Daten sowie über grundlegende Ansätze des maschinellen Lernens. Darüber hinaus bedarf es eines Grundverständnisses für die Rahmenbedingungen von digitalen Systemen und datenbasierten Entscheidungen. Die Aufgaben von Produktionsingenieur:innen enden also nicht im technischen Bereich. Im Projektmanagement erstrecken sie sich darüber hinaus auch auf die Beachtung und Einhaltung von juristischen Aspekten, normativen Rahmenbedingungen, IT-Sicherheit und vielem mehr.
1.3Zielgruppen dieses BuchesDie Digitalisierung der Produktion ist eine Aufgabe, die vor allem zwei Gruppen von Menschen zufällt: Zum einen sind dies Personen, die bereits heute in leitenden Funktionen die Wertschöpfung von Unternehmen verantworten und gestalten. Zum anderen sind dies Studierende, von denen beim Einstieg in die Berufswelt erwartet wird, neue Technologien und Methoden zu beherrschen und in ihre neue Arbeitsumgebung mit einzubringen.
Erste Zielgruppe dieses Buches sind daher Studierende des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und des Wirtschaftsingenieurwesens sowie artverwandter Studiengänge, die sich im Bereich der Produktion vertiefen wollen. Insbesondere sind dies solche Studierende, die für praxisbezogene Projekte und Abschlussarbeiten sowie für den Berufseinstieg in diesem Umfeld eine Übersicht benötigen und an vorhandene Kenntnisse aus Informatik, Fertigungstechnik oder Produktion und Logistik anknüpfen wollen.
Zweite Zielgruppe dieses Buches sind (leitende) Angestellte für Produktion und Fertigung, die einen Einstieg in das Thema suchen, bevor sie sich mit konkreten Anbietern oder Lösungen auseinandersetzen wollen. Die meisten dieser Personen arbeiten in mittelständischen Unternehmen. In meinen beruflichen Stationen durfte ich viele dieser Menschen kennenlernen. Die meisten haben, wie ich auch, vor vielen Jahren eine akademische Ausbildung durchlaufen und in diesem Zusammenhang natürlich auch Grundbegriffe der Informatik mitbekommen. Sie benötigen daher beim Einstieg in dieses Thema vor allem ein Update, welche Technologien und Systeme neu hinzugekommen sind oder sich weiterentwickelt haben. Auch rechtliche Rahmenbedingungen und Organisationsprinzipien haben eine Aktualisierung erfahren. Dieses Buch soll darüber hinaus helfen, bei der Vielfalt und Unübersichtlichkeit an Begriffen, Abkürzungen und Akronymen eine Übersicht zu vermitteln, die an eigene Aufgaben und Prozesse anknüpft.
1.4Aufbau dieses BuchesAutonome Systeme, die sich maschinellen Lernens bedienen, werden gern als Roboter bezeichnet. Wie also stellt man die Ausbildung im technischen Bereich „robot-proof“, also gewappnet gegen alle technischen Veränderungen im Bereich künstlicher Intelligenz, auf? Diese Frage beantwortete Joseph Aoun, Präsident der Northeastern University, USA, 2017 mit einem Dreiklang (Aoun 2017):
1. Verstehen, wie Daten entstehen und verarbeitet werden
2. Für spezielle Anwendungen und Domänen verstehen, was die Veränderungen im Bereich maschinellen Lernens, Big Data und künstlicher Intelligenz bedeuten
3. Lernen, die besonderen Stärken von uns Menschen – Kreativität, Schöpfungskraft, Fantasie – gewinnbringend einzusetzen
Dieses Buch folgt in seinem Aufbau genau diesem Dreiklang (Bild 1.3). Zunächst werden die wesentlichen Technologien erläutert, die im Bereich der Fabrikdigitalisierung relevant sind. Dies erstreckt sich vom Einsatz von Computern in industriellen Umgebungen über Datenaustausch und Vernetzung sowie Datenspeicherung und -verarbeitung bis hin zur Modellierung von Daten und der Darstellung von Informationen. All diese Technologien sind Bausteine, mit denen im zweiten Schritt spezifische Probleme im produzierenden Umfeld gelöst werden. Kapitel 4 widmet sich daher den wichtigsten Anwendungen für digitale Systeme in Fabriken – von der Betriebsdatenerfassung über das Management von Maschinen und die Produktionsplanung bis hin zu Qualitäts- und Energiemanagement. Kapitel 5 betrachtet darauf aufbauend die Entwicklung von Ideen und die Umsetzung von Lösungen für die Fabrikdigitalisierung. Dies umfasst, je nach Aufgabenstellung, entweder „klassische“ Projektmanagementfähigkeiten oder auch agile, also kurzzyklische und problemorientierte Arbeitsweisen.
Bild 1.3Der Aufbau dieses Buches
Alle Technologien und Systeme in diesem Buch unterliegen zwangsläufig permanenten Veränderungen und Neuerungen. In einem Ausblickkapitel (Kapitel 7) werden daher neue Technologien, wie z. B. Quantencomputer, und deren Auswirkungen auf die Fabrikdigitalisierung betrachtet. Wenn sich die Prognosen und Potenziale bewahrheiten, werden sicherlich einige dieser Technologien in ein paar Jahren in eines der vorderen Kapitel rücken.
Am Ende jedes Kapitels finden sich Lern- und Arbeitsmaterialien. Hierbei handelt es sich um Aufgaben zur Überprüfung des Verständnisses sowie Hinweise und Weblinks auf zusätzliche Materialien zu diesem Buch. Weitere Materialien können unter plus.hanser-fachbuch.de abgerufen werden.
Literatur
Aoun, Joseph E.: Robot Proof. Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/USA 2017
Beckschulte, Sebastian/Padrón Hinrichs, Marcos/Pirrone, Lorenzo/Grothkopp, Mark/Sohnius, Felix/Schmitt, Robert H./Friedli, Thomas: Manufacturing Data Analytics Study 2023. Empirical Industry Study. Apprimus, Aachen 2023
Berg, Achim: Digitalisierung der Wirtschaft. Studie des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Bitkom e. V., Berlin 2022
Bessen, James E.: How Computer Automation Affects Occupations. Technology, Jobs, and Skills. In: Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper 15–49, 2016
McAfee, Andrew/Brynjolfsson, Erik: Big Data. The Management Revolution. In: Harvard Business Review 90.10 (2012): 60–68
Newport, Cal: Deep Work. Rules for Focused Success in a Distracted World. Hachette UK 2016
Permin, Eike/Castillo Lina: Creating Data-driven Products and Services in Industry 4.0. A Case Study on Companies in the German Machine and Tool Industry. In: Discover Mechanical Engineering 3.1 (2024): 9.
Vor einem Einstieg in technische Bausteine oder auch konkrete datenbasierte Lösungen braucht es ein Grundmodell für die Organisation digitaler Systeme in der Produktion. Hier hat sich seit vielen Jahren die sogenannte Automatisierungspyramide etabliert, die zunächst vorgestellt werden soll. Diese Pyramide erfährt im Rahmen von Industrie 4.0 einige Änderungen, die anschließend im Fokus stehen. Diese vierte industrielle Revolution zielt vor allem auf Digitalisierung ab, die daher einmal vom Begriff der Automatisierung als Treiber der vorangegangenen dritten industriellen Revolution abgegrenzt werden muss. Schließlich postulieren einige Wissenschaftler und Vorausdenker bereits heute notwendige Anpassungen von Industrie 4.0, die unter dem daraus abgeleiteten Begriff Industrie 5.0 zum Schluss dieses Kapitels betrachtet werden.
2.1Die Automatisierungspyramide als GrundmodellSowohl der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) als auch viele Fachautoren verwenden als einfaches Modell für die Strukturierung von IT-Systemen in produzierenden Unternehmen eine Pyramide (VDI 2013, Meudt et al. 2017). Während einige Autor:innen abweichende Bezeichnungen für einzelne Ebenen (Siepmann 2016) eingeführt haben, hat sich im Laufe der Jahre die in Bild 2.1 dargestellte Variante in den meisten Fällen durchgesetzt.
Die einzelnen Ebenen bzw. Level leisten dabei unterschiedliche Aufgaben.
Level 1 – Steuerungsebene: Bereits in den 1980er-Jahren haben Regelungen und Steuercomputer im Rahmen der Automation und Elektrifizierung Einzug in die Fertigung gehalten. Sie dienen einer Vielzahl von Aufgaben in der Steuer- und Regelungstechnik und werden als Level 1 bezeichnet. Typischerweise beziehen diese speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS bzw. englisch Programmable Logic Control, PLC) Informationen aus einer Vielzahl von Sensoren und geben Befehle an Aktoren, also den physischen Teil eines Produktionssystems (Level 0).
Level 2 – Prozessleitrechner: Diese aggregieren die Daten aus den unteren Ebenen oder setzen neue Parameter als Zielfunktionen für das Level 1. Sie werden oft – je nach Industrie und Anwendung – als SCADA-System (Supervisory Control and Data Acquisition) bezeichnet. Typische Beispiele für die Ebene 2 sind HMI (Human Machine Interfaces), die Informationen zum Zustand einer komplexen Anlage für menschliche Bediener aggregieren.
Level 3 – Produktionsplanung und -steuerung: Oberhalb des Levels 2 zeichnen Systeme für die Planung, Steuerung und Regelung ganzer Produktionsaufträge verantwortlich. Diese werden im Deutschen oft als Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS) bezeichnet, im Englischen als Manufacturing Execution System (MES). Historisch waren in einigen Industrien Systeme zur Planung und Steuerung von Aufträgen gleichbedeutend mit dem Level 3. Die Bezeichnungen wurden synonym verwendet. In der Zwischenzeit übernehmen Systeme auf diesem Level jedoch eine Vielzahl von Aufgaben, etwa auch im Qualitäts- oder Energiemanagement.
Level 4 – Unternehmensleitebene: Auf der obersten Ebene der Pyramide, dem sogenannten Level 4, werden Unternehmensdaten geführt. Hier findet auch die kaufmännische Verwaltung statt. Diese Ebene wird in den meisten Fällen als Enterprise Resource Planning (ERP) bezeichnet. Der Adressatenkreis dieser Systeme geht daher weit über die Produktion hinaus. In vielen Unternehmen sind Systeme dieser Ebene darüber hinaus informationstechnisch privilegiert oder auch „führend“: Daten und Informationen dieser Ebene werden in widersprüchlichen Situationen als wahr bzw. verbindlich angenommen, da diese Systeme zum Teil externen Anforderungen an die gesetzlich geregelte externe Rechnungslegung unterliegen.
Bild 2.1Die Automatisierungspyramide
Die Automatisierungspyramide stellt ein Modell dar, welches die verschiedenen Aufgaben sowie die Hierarchisierung von IT-Systemen in produzierenden Unternehmen darstellen soll. Überlappungen in den Aufgaben zwischen einzelnen Ebenen sind in der Praxis dabei ebenso üblich wie das Wegfallen ganzer Ebenen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verzichten zum Teil auf komplexe Produktionsplanung der Ebene 3 und verfügen nur über kaufmännische Systeme zur Unternehmenssteuerung sowie maschinennahe Automatisierungslösungen. Da IT-Systeme in produzierenden Unternehmen einen stark umkämpften Markt darstellen, versuchen darüber hinaus Hersteller etablierter Systeme, ihre Ebene zu verlassen. Insbesondere im Bereich der ERP-Systeme gibt es immer wieder Komponenten, die eher einer Ebene 3 zugeordnet werden könnten.
Auf den vier Ebenen werden also unterschiedliche Aufgaben in der Planung, Steuerung und Regelung eines Produktionssystems wahrgenommen. Damit gehen auch unterschiedliche Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit sowie die Datenmenge des jeweiligen Systems einher. Brecher und Weck haben diese zusammengefasst (Brecher/Weck 2021, Tabelle 2.1). Aus der Übersicht wird klar, dass insbesondere auf den unteren Ebenen der Automatisierungspyramide hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Übertragung und rechtzeitigen Antwort durch IT-Systeme herrschen. Dies ergibt sich aus der Automatisierung von Prozessen und wird unter dem Begriff der Echtzeit in Kapitel 3 näher betrachtet. Auf den oberen Ebenen sind Menschen die Adressaten der IT-Systeme, sodass schnelle Reaktionszeiten hier eine weniger große Rolle spielen.
Tabelle 2.1 Die Ebenen der Automatisierungspyramide und ihre Rahmenbedingungen
Im Zuge der sogenannten vierten industriellen Revolution unterliegt die Automatisierungspyramide einem Wandel, den wir in Abschnitt 2.2 näher betrachten wollen.
2.2Veränderungen durch Industrie 4.0Der Ausdruck „Industrie 4.0“ wurde 2011 auf der Hannover Messe geprägt und hat seither sowohl viel mediale als auch politische und wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Der Begriff impliziert, dass es drei vorherige Stufen gegeben haben muss. Historisch wird in der Produktion daher von den sogenannten „vier industriellen Revolutionen“ gesprochen (Bild 2.2). Es handelt sich hierbei um jeweils grundlegende Veränderungen in der Art und Weise, wie produziert bzw. Produktion organisiert wurde. Im Groben sind dies die Mechanisierung, Arbeitsteilung, Automatisierung und Digitalisierung. In deren Schatten sind jedoch viele anderen Technologien, Methoden und Prinzipien entstanden, die bis heute das Produktionsmanagement prägen – vom Lean Management über das Total Quality Management bis hin zu Six Sigma.
Bild 2.2Die vier industriellen Revolutionen
Der erste Schritt hin zu einer industrialisierten Wirtschaft war die Einführung von externen Antrieben als Ersatz der menschlichen Muskelkraft (1. industrielle Revolution). Dies befeuerte gleichzeitig das Entstehen erster Fabriken als Standorte für eine hochkonzentrierte Art zu produzieren. Die Baumwollindustrie in England war hierbei Vorreiter. Physische Güter wurden trotzdem noch lange Zeit eher wie in Manufakturen hergestellt – jedes Teil war ein Einzelstück. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen jedoch erste Systeme auf, bei denen Güter produziert wurden, deren Bauteile untereinander austauschbar waren (2. industrielle Revolution). Ein erstes populäres Beispiel waren die Gewehre Typ 1841 der amerikanischen Armee. Revolutionär waren hierbei also die Präzision und orchestrierte Arbeitsteilung, die unter anderem die Automobilindustrie unter Henry Ford in die Lage versetzte, ehemals teure und individuelle „Motorkutschen“ der reichen Oberschicht nun einem breiten Massenmarkt zur Verfügung zu stellen. Einige Jahrzehnte später führte das Aufkommen der ersten echten Rechner schnell zu einer Veränderung der Prozesssteuerung in der Produktion: Computer übernahmen nun Aufgaben, die immer und immer wieder in hoher Genauigkeit wiederholt werden mussten (3. industrielle Revolution). Präzise mechanische Tragarme, gesteuert durch Computer und ausgestattet mit Werkzeugen, wurden schnell zu den heutigen Industrierobotern weiterentwickelt. Paradoxerweise verhinderte die Automation das massenhafte Abwandern vieler Produktionssysteme in Billiglohnländer, da nun wieder in großer Stückzahl bei wettbewerbsfähigeren Kosten hergestellt werde konnte. Gleichzeitig bedurfte es gut ausgebildeter Fachkräfte, um die komplexen Anlagen zu betreiben.
Die Kernthemen der vierten industriellen Revolution gehen über eine einfache Automatisierung hinaus: Durch massive Verbesserungen in der Digitalisierung und Vernetzung von Systemen verändert sich vor allem die Art, wie wir Produktion organisieren und orchestrieren. Im Gegensatz zur dritten industriellen Revolution geht es hier also um Datenverarbeitung oberhalb der Echtzeitebene. In der wissenschaftlichen Welt wurden digital unterstützte vernetzte Systeme oft als sogenannte cyber-physische Systeme (CPS) bezeichnet, zurückgehend auf eine Grundlagenveröffentlichung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, kurz acatech (Geisberger/Broy 2012). Cyber-physische Systeme meinten dabei also solche, die mittels Sensoren Prozesse und Anlagen der physikalischen Welt überwachen, analysieren und mittels Aktoren auf diese einwirken. Durch Vernetzung über das Internet der Dinge und Dienste entstehen so ganze Systemlandschaften, die wiederum neue Wertschöpfung möglich machen. Rückblickend ist jedoch festzustellen, dass der Begriff sich – im Gegensatz zu Industrie 4.0 – deutlich weniger stark durchgesetzt hat. Die beiden technischen Aspekte der softwareintensiven Systeme sowie der übergreifenden Vernetzung und Kommunikation hingegen sind wesentliche Grundlagen für eine Vielzahl neuer Lösungen, Angebote und Wertschöpfungen, die auch im Rahmen dieses Buches vorgestellt werden.
Die sogenannte vertikale Integration ist dabei das erste der fünf zentralen Paradigmen der Industrie 4.0. Dieser Begriff umfasst eine teilweise Auflösung der hierarchisch getrennten und über Aggregation arbeitenden Automatisierungspyramide hin zu mehr direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Dies wird durch bessere Kommunikationstechnologien und vor allem standardisierte Schnittstellen ermöglicht, die einen ebenen- und herstellerunabhängigen Datenaustausch erlauben. In einigen Publikationen wurde in diesem Zusammenhang der Begriff der Single Source of Truth geprägt: Menschen und Systeme greifen also bei Bedarf direkt auf den ursprünglichen Erzeuger einer Information zu. Die in der klassischen Automatisierungspyramide oft redundante Datenhaltung und -reproduktion entfallen dabei. Diese vertikale Integration hat in den letzten Jahren insbesondere durch die Veränderungen der Systeme der oberen Ebene hin zu cloudbasierter Infrastruktur und serviceorientierter Architektur zugenommen (Bild 2.3). Gleichzeitig müssen Daten auf den unteren Ebenen nach wie vor aggregiert werden, da sie in sehr hoher Frequenz, aber mit meist geringer Informationsdichte anfallen und somit als einzelnes Datum eher geringe Relevanz für die oberen Ebenen aufweisen. Eine lokale Vorverarbeitung hält unter dem Begriff des Edge Computing mehr und mehr Einzug.
Bild 2.3Vertikale Integration und Cloudumgebungen
Der zweite Teil dieses ersten Paradigmas der Industrie 4.0 stellt die sogenannte horizontale Integration dar (Bild 2.4). Sie leitet sich zum Teil aus der vertikalen Integration ab: Wenn Unternehmen intern in der Lage sind, durch standardisierte Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle Daten auszutauschen, so sollte dies im zweiten Schritt mittels der gleichen Technologien auch entlang einer Supply Chain möglich sein. Durch diesen direkten Datenaustausch über Wertschöpfungsnetzwerke hinweg können relevante Informationen wie der Status eines Auftrags, aber auch qualitätsrelevante Dokumentation, kurzfristige Änderungswünsche durch Abnehmer:innen oder verfügbare Kapazitäten bei Lieferant:innen geteilt werden. Konsequent weitergedacht, werden Daten somit Teil des (eigentlich physischen) Produkts.
Bild 2.4Horizontale Integration über Wertschöpfungsstufen hinweg
Das erste Paradigma der Industrie 4.0 leitet sich unmittelbar aus der verstärkten digitalen Vernetzung, also einer der beiden grundsätzlichen Technologien ab. Eine Verstärkung der lokalen Rechenleistung, zusammen mit technologischen Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens und der Datenverarbeitung, sorgt für das zweite Paradigma der Industrie 4.0: die dezentrale Intelligenz. Maschinen und Anlagen erhalten gegenüber der in der klassischen Automatisierungspyramide vorgesehenen starren Automation durch etwa SCADA und SPS nun mehr Freiheiten, auf sich verändernde Umgebungsbedingungen selbstständig zu reagieren und sich anzupassen.
Sind alle Elemente einer digital vernetzten Fabrik mit lokaler Intelligenz sowie der Fähigkeit zu Kommunikation und Datenaustausch ausgestattet, entfällt der Bedarf einer zentralen Steuerung aller Vorgänge und Entitäten und entwickelt sich hin zu einer dezentralen Steuerung. Dies wird als drittes Paradigma der Industrie 4.0 bezeichnet. Ähnliche Ansätze waren als agentenbasierte Steuerungen bereits seit den 1980er-Jahren bekannt. Durch die technologischen Fortschritte in den Bereichen der Vernetzung und des Datenaustauschs sowie des maschinellen Lernens und der Datenverarbeitung erhält das Thema nun neuen Schub.
Daten werden mehr und mehr Teil eines Produkts und ergänzen somit physische Güter. Sie sollten diese dann auch über den gesamten Lebenszyklus des Wirtschaftsguts hinweg begleiten und ergänzen. Dieses vierte Paradigma der Industrie 4.0 wird daher oft unter dem Begriff des durchgängigen digitalen Engineerings geführt und durch den sogenannten digitalen Zwilling technologisch ermöglicht. Während letzterer Ausdruck sich wissenschaftlich wie auch medial stark etabliert hat, ist ein holistischer digitaler Zwilling nach wie vor technologisch schwierig, da sehr viele unterschiedliche Daten und Modelle über den Lebenszyklus insbesondere komplexer Anlagen und Maschinen entstehen.
Das fünfte Paradigma stellt eine Zusammenführung der bisher aufgezählten Veränderungen dar. Cyber-physische Produktionssysteme (CPPS) werden damit zu den zentralen Dreh- und Angelpunkten digital vernetzter Wertschöpfung. Sie stellen die Übersetzung von CPS in die Domäne der Produktion dar und verdeutlichen somit die Integration der digitalen Sphäre in die realen Welt.
Sollen Maschinen und Anlagen verschiedener Hersteller im Sinne dieser fünf Paradigmen miteinander interagieren, wird schnell klar, dass eine einheitliche Nomenklatur Grundlage dieser Vernetzung ist. Aus diesem Grund wurde über die Plattform Industrie 4.0, einem durch diverse Ministerien, Branchenverbände, Hochschulen und Unternehmen getragenen Netzwerk, ein solcher Orientierungsrahmen erarbeitet. Die dabei entstandene Referenzarchitektur RAMI 4.0 ist mittlerweile in die nationale sowie die internationale Normung übergegangen. Sie dient vor allem einer branchenübergreifenden Standardisierung von Sprache, damit einhergehend aber auch einer Standardisierung von Kommunikationsstrukturen und Spielregeln.
RAMI 4.0 gibt in einem dreidimensionalen Raum Begriffe und Stufen für die Hierarchie in einem CPPS, die notwendige Architektur für ein digitales und physisches System sowie die Stationen im Produktlebenszyklus vor (Bild 2.5





























