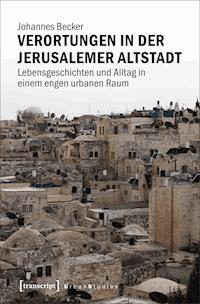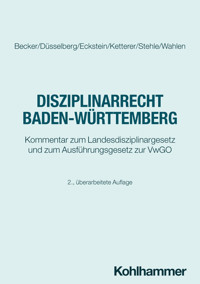
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Autorenteam, bestehend aus erfahrenen Praktikern aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der öffentlichen Verwaltung und der Anwaltschaft, gibt einen umfassenden Überblick über das formelle Disziplinarrecht mit Erläuterungen zum LDG und zum AGVwGO. Zudem wird das materielle Disziplinarrecht unter Orientierung an der aktuellsten einschlägigen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung dargestellt, entlang von Lebenssachverhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Disziplinarrecht Baden-Württemberg
Kommentar zum Landesdisziplinargesetz und zum Ausführungsgesetz zur VwGO
von
Johannes BeckerRichter am Verwaltungsgericht Freiburg
Jörg DüsselbergRechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Freiburg
Dr. Lena KettererRichterin am Verwaltungsgerichtshof Mannheim
Prof. Dr. Stefan StehleHochschullehrer an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl am Rhein
Stefan WahlenRechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Karlsruhe
Mitbegründet von
Prof. Christoph EcksteinHochschullehrer a. D. an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Mitautor der 1. Auflage
2., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
2. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 Verlag W. Kohlhammer GmbH Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-044832-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-044833-9
epub: ISBN 978-3-17-044834-6
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit dieses Buches wurde auf die explizite Verwendung von männlichen und weiblichen Personenbezeichnungen verzichtet. Alle verwendeten Begriffe gelten gleichermaßen für beide Geschlechter und schließen auch diverse Geschlechtsidentitäten ein.
Das Autorenteam, bestehend aus erfahrenen Praktikern aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der öffentlichen Verwaltung und der Anwaltschaft, gibt einen umfassenden Überblick über das formelle Disziplinarrecht mit Erläuterungen zum LDG und zum AGVwGO. Zudem wird das materielle Disziplinarrecht unter Orientierung an der aktuellsten einschlägigen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung dargestellt, entlang von Lebenssachverhalten.
Johannes, Becker, Richter, Verwaltungsgericht Freiburg; Jörg Düsselberg, Fachanwalt für Verwaltungsrecht; Dr. Lena Ketterer, Richterin, VGH Mannheim; Prof. Dr. Stefan Stehle, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl am Rhein; Stefan Wahlen, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht.
Inhaltsverzeichnis
VorwortAbkürzungsverzeichnisLiteraturverzeichnisDas materielle Disziplinarrecht (Dr. Ketterer)1. Zweck und Grundprinzipien des Disziplinarverfahrens2. Übersicht über die Disziplinarmaßnahmen3. Dienstvergehen als zentraler Begriff des Disziplinarrechtsa) Objektive Dienstpflichtverletzungaa) Dienstpflichtverletzungbb) Relevante Dienstpflichtencc) Dienstpflichtverletzung nach Beendigung des Beamtenverhältnissesb) Rechtfertigungsgründec) Subjektive Vorwerfbarkeitaa) Vorsatz oder Fahrlässigkeitbb) Schuldd) Einheit des Dienstvergehens4. Bestimmung der angemessenen Disziplinarmaßnahmea) Systematik der Maßnahmen nach dem LDGb) Bemessungsgrundsätzec) Bestimmung der Schwere des Dienstvergehensd) Vertrauensbeeinträchtigunge) Persönlichkeitsbildf) Milderungsgründe5. Maßnahmeverbote6. Nebenentscheidungen und Tenorierungsbeispielea) Nebenentscheidungenb) Tenorierungsbeispieleaa) Verweis (§ 27 LDG)bb) Geldbuße (§ 28 LDG)cc) Kürzung der Dienstbezüge (§ 29 LDG)dd) Zurückstufung (§ 30 LDG)ee) Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (§ 31 LDG)ff) Kürzung des Ruhegehalts (§ 32 LDG)gg) Aberkennung des Ruhegehalts (§ 33 LDG)7. Beispiele aus der Rechtsprechung zu Dienstpflichtverletzungena) Pflicht zur Neutralität, § 33 Abs. 1 Satz 1 und 2 BeamtStGb) Pflicht zur Mäßigung und Zurückhaltung, § 33 Abs. 2 BeamtStGc) Verfassungstreuepflicht, § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStGd) Pflicht zur vollen Hingabe, § 34 Abs. 1 Satz 1 BeamtStGe) Pflicht zur uneigennützigen Aufgabenwahrnehmung, § 34 Abs. 1 Satz 2 BeamtStGf) Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten, § 34 Abs. 1 Satz 3 BeamtStGg) Folgepflicht, § 35 Abs. 1 Satz 2 BeamtStGh) Verschwiegenheitspflicht, § 37 Abs. 1 Satz 1 BeamtStGi) Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Ausübung von NebentätigkeitenLandesdisziplinargesetz (LDG)ErläuterungenTeil 1 Allgemeine Bestimmungen (Prof. Dr. Stehle)§ 1 Geltungsbereich§ 2 Verfahren§ 3 Bezüge, RuhegehaltTeil 2 Disziplinarbehörden, Zuständigkeit (Prof. Dr. Stehle)§ 4 Beamte des Landes§ 5 Beamte der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts§ 6 Ruhestandsbeamte§ 7 ZuständigkeitTeil 3 Verfahren1. Abschnitt Einleitung, Gegenstand des Verfahrens (Prof. Dr. Stehle)§ 8 Einleitung von Amts wegen§ 9 Einleitung auf Antrag§ 10 Ausdehnung, Beschränkung, Wiedereinbeziehung2. Abschnitt Durchführung§ 11 Unterrichtung, Belehrung, Anhörung (Prof. Dr. Stehle)§ 12 Ermittlungen (Prof. Dr. Stehle)§ 13 Zusammentreffen mit anderen Verfahren, Aussetzung (Prof. Dr. Stehle)§ 14 Bindung an tatsächliche Feststellungen aus anderen Verfahren (Prof. Dr. Stehle)§ 15 Beweiserhebung (Düsselberg)§ 16 Zeugen und Sachverständige, Augenschein (Düsselberg)§ 17 Herausgabe von Beweisgegenständen, Beschlagnahmen, Durchsuchungen (Düsselberg)§ 18 Niederschriften (Düsselberg)§ 19 Innerdienstliche Informationen (Düsselberg)§ 20 Abschließende Anhörung (Wahlen)3. Abschnitt Vorläufige Maßnahmen (Wahlen)§ 21 Vorläufige, nicht amtsgemäße Verwendung§ 22 Vorläufige Dienstenthebung, Einbehaltung von Bezügen oder Ruhegehalt§ 23 Form, Rechtswirkungen§ 24 Verfall und Nachzahlung einbehaltener Beträge4. Abschnitt Disziplinarmaßnahmen (Becker)§ 25 Arten§ 26 Bemessung§ 27 Verweis§ 28 Geldbuße§ 29 Kürzung der Bezüge§ 30 Zurückstufung§ 31 Entfernung aus dem Beamtenverhältnis§ 32 Kürzung des Ruhegehalts§ 33 Aberkennung des Ruhegehalts§ 34 Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach Straf- oder Bußgeldverfahren§ 35 Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs5. Abschnitt Abschluss (Düsselberg)§ 36 Beendigung§ 37 Einstellung§ 38 Ausspruch von Disziplinarmaßnahmen§ 39 Kosten§ 40 Aufhebung der Abschlussverfügung§ 41 Ausschluss der Disziplinarbefugnis§ 42 Verwertungsverbot, Entfernung aus der PersonalakteTeil 4 Begnadigung (Wahlen)§ 43 Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO)Vorbemerkung (Becker)1. Anzuwendende Vorschriften2. Örtliche Zuständigkeit3. Verfahrensarten4. Klagefrist und -form5. Grundsatz der Mündlichkeit6. Kosten7. Rechtsmittel8. Gerichtliches Disziplinarverfahren gegen Richter und StaatsanwälteErläuterungen der nach dem Landesdisziplinargesetz betreffenden Vorschriften (Becker)§ 7 Disziplinarkammern§ 8 Disziplinarsenat§ 9 Beamtenbeisitzer§ 10 Bestellung der Beamtenbeisitzer§ 11 Ausschluss von der Ausübung des Richteramts§ 12 Nichtheranziehung eines Beamtenbeisitzers§ 13 Entbindung vom Amt des Beamtenbeisitzers§ 14 Zuständigkeit§ 15 Ausschluss des Vorverfahrens§ 19 Beweisaufnahme§ 20 Vergleich§ 21 Entscheidung über die Klage gegen die Abschlussverfügung§ 22 KostenAnlage (zu § 22) Gebührenverzeichnis in Angelegenheiten nach dem LandesdisziplinargesetzStichwortverzeichnisVorwort
Das neue Landesdisziplinargesetz Baden-Württemberg ist am 22.10.2008 in Kraft getreten und ersetzte die bisherige Landesdisziplinarordnung. Im Verhältnis zur vorher geltenden LDO wurde mit dem Landesdisziplinargesetz eine grundlegende Neuregelung und Reform des Disziplinarverfahrens in Baden-Württemberg umgesetzt.
Mit dem LDG wurde eine weitgehende Lösung des Disziplinarverfahrens vom Strafprozessrecht und seine Angleichung an das verwaltungsrechtliche Verfahren vorgenommen. Ein einheitliches Disziplinarverfahren wurde eingeführt und die bisherige Unterscheidung zwischen Vorermittlungen und förmlichem Verfahren mit unterschiedlichen Verteidigerrechten aufgegeben. Zudem wurden gesetzliche Bemessungstatbestände für die einzelnen Disziplinarmaßnahmen in das LDG aufgenommen und dem Dienstherrn das Recht eingeräumt, sämtliche Disziplinarmaßnahmen durch Disziplinarverfügung selbst zu erlassen. Sogar bei Verhängung der Höchstmaßnahme ist der Dienstherr nicht mehr auf die Erhebung einer Disziplinarklage gegen den Beamten angewiesen. Gegen alle Verfügungen der Disziplinarbehörde gewährt das LDG den Beamtinnen und Beamten Rechtsschutz durch die Möglichkeit, unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben. Bei leichten und mittelschweren Dienstvergehen besteht erstmals auch die Möglichkeit für die Disziplinarbehörde, das Verfahren mit Zustimmung des Beamten nach Erfüllung von Auflagen einzustellen. Zudem besteht mit Zustimmung des Gerichts in gerichtlichen Verfahren die Möglichkeit eines gerichtlichen Vergleichs über den Ausspruch einer Disziplinarmaßnahme oder die Einstellung des Disziplinarverfahrens.
Diese Neuordnung des Disziplinarverfahrens hat sich in der bisherigen Praxis bewährt. Durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.4.2016 – 2 C 4/15 wurde auch die Übertragung der gesamten Disziplinargewalt – einschließlich der Höchstmaßnahmen – auf die Disziplinarbehörde als verfassungsmäßig bestätigt, da nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes kein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums besteht, dass die Verhängung der Höchstmaßnahmen in einem Disziplinarverfahren unter einem Richtervorbehalt stehen. Die gegen dieses Urteil erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht durch Beschluss vom 14.1.2020 – 2 BvR 2055/16 zurückgewiesen und die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt.
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 20.12.2023, BGBl I Nr. 389 ist der Bund nunmehr dem Vorbild Baden-Württembergs gefolgt und hat ebenfalls auf die Disziplinarklage verzichtet und der Disziplinarbehörde das Recht eingeräumt, sämtliche Disziplinarmaßnahmen durch Disziplinarverfügung selbst zu erlassen.
Die disziplinarrechtliche Praxis seit Einführung des LDG zeigt, dass das LDG an Dienstvorgesetzte, Ermittlungsführer und alle anderen, die mit dem Ablauf eines Verfahrens befasst sind, nicht nur deshalb sehr hohe Anforderungen stellt, weil der Disziplinarbehörde nach der Neuordnung des Disziplinarverfahrens in Baden-Württemberg durch das LDG die gesamte Disziplinargewalt – einschließlich der Höchstmaßnahmen – übertragen worden ist. Hierfür möchte diese Kommentierung, welche von einem Autorenteam aus den Bereichen der Verwaltung, der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Hochschulen und der Anwaltschaft erstellt worden ist, eine Hilfe und Orientierung bieten. Hierzu wurde neben der Kommentierung des LDG und der für das Disziplinarverfahren einschlägigen Vorschriften der AGVwGO auch die für die Disziplinarverfahren wesentliche Thematik des materiellen Disziplinarrechts in die Kommentierung aufgenommen.
Wir wünschen der Kommentierung eine interessierte Leserschaft. Anregungen und Kritik an die Autoren sind jederzeit erwünscht.
Freiburg, Mannheim, Kehl, Karlsruhe, im Juni 2025
Johannes Becker
Jörg Düsselberg
Lena Ketterer
Stefan Stehle
Stefan Wahlen
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 8. Auflage 2021
Battis, Bundesbeamtengesetz, Kommentar, 6. Auflage 2022
Battis, Ende eines Jahrhundertstreits, ZBR 2024, 73
Bauschke/Weber, Bundesdisziplinargesetz, Kommentar, 2003
Behnke, Bundesdisziplinarordnung, Kommentar, 2. Auflage 1970
Bretschneider/Peter, Das Dienstrechtsänderungsgesetz 2023, NVwZ 2024, 16
Brinktrine/Hug, BeckOK Beamtenrecht Baden-Württemberg, Kommentar, 32. Edition 2025
Brinktrine/Schollendorf, BeckOK Beamtenrecht Bund, Kommentar, 2024
Claussen, Handbuch für Untersuchungsführer, 2. Auflage 1978
Claussen/Benneke/Schwandt, Das Disziplinarverfahren, 6. Auflage 2009
Claussen/Janzen, Bundesdisziplinarordnung, Kommentar, 8. Auflage 1996
Deutscher Bundestag, Wissenschaftlicher Dienst, Sachstand: Zur Zulässigkeit von Nebentätigkeiten von Richtern im Dienst des Bundes, 4.9.2024, WD 7 – 3000 – 057/24
Domgörgen/Heuschmid, Aktuelle Entwicklungen im Disziplinarrecht, NVwZ-RR 2025, 1
Eckstein, Beamten- und disziplinarrechtliche Konsequenzen von Alkoholmissbrauch, VBlBW 1999, 452
Eckstein/Kastner/Klein-Erwig/Vögt, Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg, Kommentar, 2016
Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, 3. Auflage 2024
Engel/Heilshorn, Kommunalrecht Baden-Württemberg, 12. Auflage 2021
Eyermann, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 16. Auflage 2022
Faiß, Das Kommunalabgabenrecht in Baden-Württemberg, Vorschriftensammlung und Kommentar zum Kommunalabgabengesetz, Loseblattwerk, 79. Aktualisierung 2024
Fürst, Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht (GKÖD), Band II, Disziplinarrecht des Bundes und der Länder, Loseblattwerk mit Aktualisierungen 02/2025
Fürst, Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht (GKÖD), Band V, Personalvertretungsrecht des Bundes und der Länder, Loseblattwerk mit Aktualisierungen
Gansen, Disziplinarrecht in Bund und Ländern, Kommentar, Loseblattwerk mit 69. Aktualisierung 2024
Gern, Kommunalrecht Baden-Württemberg, 9. Auflage 2005
Hebeler, Disziplinarrechtliche Beurteilung des außerdienstlichen Besitzes kinderpornografischer Videodateien bei Polizeibeamten
Herrmann/Sandkuhl, Beamtendisziplinarrecht, Beamtenstrarecht, 2. Auflage 2021
Hufen, Verschwiegenheitspflicht und Zurückhaltungsgebot bei Meinungsäußerung von Beamten, JuS 1993, 246
Jarass/Pieroth, Kommentar zum Grundgesetz, 18. Auflage 2024
Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 9. Auflage 2023
Kenntner, Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst?, NVwZ 2025, 9
Köhler/Baunck/Heun/Vogt, Bundesdisziplinargesetz und materielles Disziplinarrecht, Kommentar, 8. Auflage 2024
Köhler/Ratz, Bundesdisziplinarordnung, Kommentar, 2. Auflage 1994
Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 25. Auflage 2024
Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 30. Auflage 2024
Krebs/Nitschke/Noak/Steinhorst/Zenger, Chatgruppen und öffentlicher Dienst – ein beamten- und strafrechtlicher Überblick, 2024
Leuze/Wörz/Bieler, Das Personalvertretungsrecht in Baden-Württemberg, Kommentar, Loseblattwerk mit 33. Aktualisierung 2014
Louis/Glinder/Waßmer, Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung, 2020
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 67. Auflage 2024
Plog/Wiedow, Bundesbeamtengesetz, Kommentar, Loseblattwerk mit Aktualisierungen 2025
Redeker/von Oertzen, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 17. Auflage 2021
Reich/Masuch, Beamtenstatusgesetz Kommentar, 4. Auflage 2025
v. Roetteken/Rothländer, Beamtenstatusgesetz, Kommentar, Loseblattwerk mit 38. Aktualisierung 2024
Rooschüz/Bader, Landespersonalvertretungsgesetz für Baden-Württemberg, 17. Auflage 2023
Schmidt-Räntsch, Deutsches Richtergesetz, Kommentar, 6. Auflage 2009
Schnellenbach/Bodanowitz, Beamtenrecht in der Praxis, 11. Auflage 2024
Schoch/Schneider, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, Loseblattwerk mit 46. Aktualisierung 2024
Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes und der Länder, Kommentar, Loseblattwerk mit 221. Aktualisierung 2025
Schütz/Schmiemann, Disziplinarrecht des Bundes und der Länder, Loseblattwerk mit 19. Aktualisierung 2024
Sodan/Ziekow, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 5. Auflage 2018
Staats, Deutsches Richtergesetz, 1. Auflage 2012
Stehle, Beamtenrecht Baden-Württemberg, 5. Auflage 2023
Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2023
Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, Kommentar, 45. Auflage 2024
Urban/Wittkowski, Bundesdisziplinargesetz, Kommentar, 2. Auflage 2017
von Alberti/Burr/Düsselberg/Eckstein/Nonnenmacher/Wahlen, Landesdisziplinarrecht Baden-Württemberg, 2. Auflage 2012
von Alberti/Gayer/Roskamp, Landesdisziplinarordnung, Kommentar, 1994
von Roetteken/Rothländer, Beamtenstatusgesetz, Kommentar, Loseblattwertk mit 38. Aktualisierung 2024
von Münch/Kunig, Grundgesetz, Kommentar, 7. Auflage 2021
Voßkuhle, Extremismus im Öffentlichen Dienst – Was tun?, NVwZ 2022, 1841
Weiß, Das Dienstvergehen der Beamten, 1971
Wichmann/Langer, Öffentliches Dienstrecht, 8. Auflage 2017
Wilhelm, Abschied von der Disziplinarklage, DÖV 2009, 800
Wittkowski, Anmerkung zu einer Entscheidung des BVerwG, Urteil vom 18.6.2015 (2 C 19.14) – Zur Disziplinarwürdigkeit außerdienstlichen Besitzes kinderpornografischer Bild- und Videodateien
Zängl/Conrad/Pahlke, Bayerisches Disziplinarrecht, Kommentar, Loseblattwerk mit 49. Aktualisierung 2024
Zängl, Verwaltungsakt statt Disziplinarurteil, in Festschrift für Walther Fürst 2002
Zöller, Zivilprozessordnung, Kommentar, 35. Auflage 2024
Das materielle Disziplinarrecht
1.Zweck und Grundprinzipien des Disziplinarverfahrens
1Der Zweck des Disziplinarverfahrens ist es, das Vertrauen in die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der Beamten und damit die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sicherzustellen. Das Beamtenverhältnis wird auf Lebenszeit begründet und kann vom Dienstherrn nicht einseitig aufgelöst werden. Pflichtverletzungen des Beamten machen daher Reaktions- und Einwirkungsmöglichkeiten des Dienstherrn erforderlich. Das Disziplinarrecht stellt hierfür Maßnahmen zur Verfügung, um den Beamten im Falle eines Dienstvergehens zur Pflichterfüllung anzuhalten oder – wenn das notwendige Vertrauen endgültig verloren ist – ihn aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen. Nur so können die Integrität des Berufsbeamtentums und das Vertrauen in die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung der Beamten aufrechterhalten werden.1 Es geht mithin im Disziplinarrecht nicht um Vergeltung für begangenes Unrecht, sondern um die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Integrität des Berufsbeamtentums2.
2Demgegenüber ist das Strafrecht geprägt vom Vergeltungsprinzip mit dem Ziel der individuellen Sühne durch ein Unwerturteil über gemeinschaftswidriges Verhalten und strafrechtliche Sanktionen. Straf- und Disziplinarrecht verfolgen unterschiedliche Zwecke. Gegenstand der disziplinarrechtlichen Betrachtung und Wertung ist die Frage, welche Disziplinarmaßnahme in Ansehung der gesamten Persönlichkeit des Beamten geboten ist, um die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes und die Integrität des Berufsbeamtentums möglichst ungeschmälert aufrechtzuerhalten3.
3Disziplinarmaßnahmen unterhalb der Höchstmaßnahme haben in erster Linie die Funktion einer Pflichtenmahnung in dem Sinne, dass sie den betroffenen Beamten zu einem künftigen pflichtgemäßen Verhalten veranlassen sollen. Der Zweck von Disziplinarmaßnahmen erschöpft sich indes nicht darin. Vielmehr dienen diese Disziplinarmaßnahmen letztlich auch der allgemeinen Aufrechterhaltung der Integrität des Berufsbeamtentums.4 Das Disziplinarrecht zielt mithin zum einen darauf, auf den betroffenen Beamten mit dem Ziel einzuwirken, sich künftig pflichtgemäß zu verhalten (spezialpräventiv), und zum anderen darauf, die Vertrauenswürdigkeit des öffentlichen Dienstes und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung sicherzustellen (generalpräventiv).5 Eine Weiterverwendung im öffentlichen Dienst aus Gründen der Funktionssicherung kommt hingegen nicht mehr in Betracht, wenn das Vertrauensverhältnis zum Dienstherrn durch das Dienstvergehen endgültig zerstört ist oder wenn dieses einen so großen Ansehensverlust bewirkt hat, dass eine Weiterverwendung als Beamter die Integrität des Beamtentums unzumutbar belastet. Hiergegen bestehen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit keine verfassungsrechtlichen Bedenken.6 In beiden Fallgruppen ist der Beamte für den Dienstherrn objektiv untragbar und daher die Entfernung aus dem Dienst geboten. Wann ein derartiger endgültiger Vertrauens- und Ansehensverlust gegeben ist, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere der Schwere der Verfehlung, dem Ausmaß der Gefährdung dienstlicher Belange bei einer Weiterverwendung und dem Persönlichkeitsbild des Beamten.7 Bei Ruhestandsbeamten besteht für eine – zukunftsbezogene – Pflichtenmahnung, soweit sie die Erfüllung von Dienstpflichten betrifft, im Allgemeinen kein Bedürfnis, weil sie keinen Dienst mehr leisten. Hier ist neben dem Gesichtspunkt der Generalprävention und dem der gerechten Gleichbehandlung der Ruhestandsbeamten mit den aktiven Beamten auch der der Wahrung des Ansehens des öffentlichen Dienstes von Bedeutung.8
4Dem Disziplinarrecht kommt eine Schutzfunktion für den einzelnen Beamten zu. Indem der Gesetzgeber Art, Voraussetzungen und Folgen von Disziplinarmaßnahmen bestimmt sowie das Disziplinarverfahren regelt, begrenzt er die Disziplinarbefugnis der Disziplinarbehörde. Wegen des mit Disziplinarmaßnahmen verbundenen Eingriffs in Grundrechte des betroffenen Beamten (etwa die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG, aber ggf. auch spezielle Grundrechte wie etwa Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 9 Abs. 3 GG sowie grundrechtsgleiche Rechte) dient das LDG dem Vorbehalt des Gesetzes. Nach Art. 33 Abs. 5 GG sind nur solche Grundrechtsbeschränkungen zulässig, die durch Sinn und Zweck des konkreten Dienst- und Treueverhältnisses des Beamten gefordert werden.9 Das Disziplinarverfahren ermöglicht dem Dienstvorgesetzten nicht nur einen Sachverhalt aufzuklären, sondern verpflichtet ihn dazu, einen disziplinarrechtlich relevanten Sachverhalt vollständig zu ermitteln. Es enthält zahlreiche Sicherungen, um die Rechte des Beamten zu wahren. Insbesondere die Regelung zur Unterrichtung, Belehrung und Anhörung des Beamten in § 11 Abs. 1 bis 3 LDG, das Recht des Beamten auf Beweisteilnahme im Disziplinarverfahren (v. a. § 16 Abs. 2 LDG) sowie die begrenzende Wirkung von Einleitungs- und Ausdehnungsverfügung (vgl. §§ 8, 10 LDG)10 dienen auch dem Schutz des betroffenen Beamten. Sie sind Ausdruck des aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Anspruchs des Beamten auf ein faires Disziplinarverfahren.11 Es entspricht rechtsstaatlichen Grundsätzen, dem betroffenen Beamten zu eröffnen, welches Vergehen ihm zur Last gelegt wird, und ihn hierzu anzuhören. Auf diese Weise wird ihm eine wirksame Rechtsverteidigung ermöglicht.12
5Im Disziplinarverfahren gelten der im Rechtsstaatsprinzip verfassungsrechtlich verankerte Grundsatz derVerhältnismäßigkeit (Übermaßverbot) sowie das Schuldprinzip, das aus dem Zusammenspiel von Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip sowie der wertsetzenden Entscheidung des Art. 1 Abs. 1 GG folgt.13 Die gegen den Beamten ausgesprochene Disziplinarmaßnahme muss unter Berücksichtigung aller be- und entlastenden Umstände des Einzelfalls (vgl. § 12 LDG) in einem gerechten Verhältnis zur Schwere des Dienstvergehens und zum Verschulden des Beamten stehen.14 Insoweit deckt sich der Schuldgrundsatz in seinen die Strafe begrenzenden Auswirkungen mit dem Übermaßverbot.15 Die Anforderungen in § 26 LDG konkretisieren die Verfassungsgrundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Schuldprinzips.16
6Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist zudem im Rahmen von Ermessensentscheidungen der Disziplinarbehörde etwa bei der Bestimmung der angemessenen Disziplinarmaßnahme zu beachten. Danach muss die dem Einzelnen auferlegte Belastung geeignet und erforderlich sein, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Darüber hinaus darf der Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und zu den vom Betroffenen hinzunehmenden Einbußen stehen.17 Auch im Rahmen von sonstigen Ermessensentscheidungen der Disziplinarbehörde etwa bei verfahrensbezogenen Entscheidungen (z. B. Anordnung von Beschlagnahmen und Durchsuchungen nach § 17 LDG) sowie bei vorläufigen Maßnahmen (z. B. vorläufige, nicht amtsgemäße Verwendung gemäß § 21 LDG und vorläufige Dienstenthebung nach § 22 LDG) ist dem Grundsatz Rechnung zu tragen. Anordnungen von Beschlagnahmen und Durchsuchungen nach § 17 LDG dürfen nur ergehen, wenn sie verhältnismäßig sind. Hierbei sind insbesondere die Dringlichkeit des Verdachts gegen den Beamten, die Bedeutung der Sache, das zu erwartende Disziplinarmaß sowie die Schwere des Eingriffs zu berücksichtigen.18 Liegen die Voraussetzungen für eine vorläufige, nicht amtsgemäße Verwendung vor und kann durch diese Verwendung verhindert werden, dass der Dienstbetrieb beeinträchtigt wird, so scheidet eine vorläufige Dienstenthebung aus (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LDG). Denn ist die vorläufige, nicht amtsgemäße Verwendung als mildere Maßnahme möglich, wäre die vorläufige Dienstenthebung nicht erforderlich und daher unverhältnismäßig.19
7Weitere Ausprägungen der Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Disziplinarverfahren sind insbesondere
– das materiell-rechtliche Maßnahmeverbot gemäß § 34 Abs. 1 LDG. Danach dürfen dann, wenn gegen den Beamten eine Strafe, Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme unanfechtbar verhängt worden ist oder eine Tat nach § 153a Abs. 1 Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 StPO nach Erfüllung von Auflagen und Weisungen nicht mehr als Vergehen verfolgt werden kann, ein Verweis nicht (Nr. 1) und eine Geldbuße, eine Kürzung der Bezüge oder eine Kürzung des Ruhegehalts nur ausgesprochen werden, wenn dies zusätzlich erforderlich ist, um den Beamten zur Pflichterfüllung anzuhalten (Nr. 2).
– die zeitnahe disziplinarrechtliche Ahndung; zeitliche Grenzen für den Erlass einer Disziplinarmaßnahme sind in § 35 LDG geregelt. Eine disziplinarische Maßnahme kann unvereinbar mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit werden, wenn das Disziplinarverfahren unverhältnismäßig lange dauert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bereits die mit einem Disziplinarverfahren verbundenen wirtschaftlichen und dienstlichen Nachteile auf den Beamten einwirken können, mit der Folge, dass das durch das Dienstvergehen ausgelöste Sanktionsbedürfnis durch die Verfahrensdauer gemindert wird oder sogar ganz entfallen kann. Dementsprechend ist bei der Frage, welche Disziplinarmaßnahme zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes erforderlich ist, stets zu prüfen, ob und inwieweit bereits mit einem langen Disziplinarverfahren konkret verbundene Nachteile auf den Beamten positiv eingewirkt haben. Bei der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehalts kann eine lange Verfahrensdauer den eingetretenen Vertrauens- bzw. Ansehensverlust nicht beheben, weil der Beamte für den öffentlichen Dienst untragbar geworden ist.20
– die stufenweise Steigerung der Disziplinarmaßnahmen. Der Dienstherr muss bei zeitlich gestreckt auftretenden Dienstpflichtverletzungen, die nach ihrer Schwere für sich genommen keine höhere Disziplinarmaßnahme gebieten, in der Regel zunächst zeitnah nach den bekannt gewordenen Pflichtverletzungen mit niederschwelligen disziplinaren Maßnahmen auf den Beamten einwirken und diese bei fortgesetztem Fehlverhalten stufenweise steigern.21
8Die Geltung des Schuldprinzips kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme die Schuldfähigkeit des Beamten voraussetzt. Verletzt der Beamte eine Dienstpflicht im Zustand der Schuldunfähigkeit, fehlt es an der subjektiven Voraussetzung eines Dienstvergehens und es scheidet die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme aus. Ein eingeleitetes Disziplinarverfahren ist infolgedessen gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 LDG einzustellen. Ausprägungen des Schuldprinzips sind mithin insbesondere
– Schuldfähigkeit als subjektive Voraussetzung eines Dienstvergehens (vgl. § 47 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG),
– Schuldform (Vorsatz oder Fahrlässigkeit),
– der Überzeugungsgrundsatz. Daraus folgt unter anderem, dass eine Disziplinarmaßnahme nicht aufgrund eines bloßen Verdachts verhängt werden darf. Es muss zweifelsfrei geklärt sein, ob ein schuldhafter Pflichtverstoß vorliegt.
– die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung („in dubio pro reo“; dazu sogleich).
9Im Disziplinarrecht gilt insbesondere der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) folgende Grundsatz der Unschuldsvermutung,22 mit der Folge, dass von Verfassungs wegen jeder Beamte bis zum verfahrensgemäßen Abschluss eines Disziplinarverfahrens grundsätzlich als unschuldig anzusehen ist.23 Die Unschuldsvermutung schützt den betroffenen Beamten vor Nachteilen, die Schuldspruch oder Strafe gleichkommen, denen aber kein rechtsstaatliches und prozessordnungsgemäßes Verfahren zur Schuldfeststellung und Maßnahmebemessung vorausgegangen ist. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung prägt insbesondere die Beweiswürdigung. Zur Widerlegung der Unschuldsvermutung bedarf es der vollen Gewissheit über einen bestimmten Sachverhalt und der Schuld des Betroffenen. Erforderlich ist ein nach der Lebenserfahrung ausreichendes Maß an Sicherheit, demgegenüber vernünftige Zweifel nicht mehr aufkommen.24 Eine „mathematische“ Gewissheit ist nicht gefordert. Der Beweis muss mit lückenlosen, nachvollziehbaren und logischen Argumenten geführt werden. Die Beweiswürdigung muss auf einer tragfähigen, verstandesmäßig einsichtigen Tatsachengrundlage beruhen und erschöpfend sein.25 Bei belastenden Umständen, die nach erschöpfender Sachaufklärung im Ungewissen bleiben, findet der Grundsatz Anwendung, dass im Zweifel zugunsten des Beamten zu entscheiden ist („in dubio pro reo“).26 Zur Feststellung eines Dienstvergehens27 dürfen mithin nur solche belastenden Tatsachen berücksichtigt werden, die zur Überzeugung der Disziplinarbehörde bzw. des Gerichts feststehen. Entlastende Umstände sind hingegen nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ schon dann beachtlich, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für ihr Vorliegen gegeben sind und eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht möglich ist.28
10Im Disziplinarrecht gilt ferner der „nemo tenetur“-Grundsatz. Der Beamte darf nicht gezwungen werden, sich selbst zu belasten. Das Schweigen des Beamten darf grundsätzlich ebenso wenig wie sonstiges zulässiges Prozessverhalten, wozu auch das Bestreiten der Tat selbst und das Negieren oder Relativieren ihres Unrechtsgehalts gehört, zu Lasten des Beamten gewertet werden.29 Insoweit wird die dienstrechtliche Wahrheitspflicht (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG)30 im Disziplinarverfahren begrenzt. Die Grenze des dienstrechtlich Zulässigen wird regelmäßig erst überschritten, wenn der Beamte im Disziplinarverfahren wider besseren Wissens Dritte diffamiert oder sonst vorsätzlich gegen Strafbestimmungen verstößt.31 Wird dieser Rahmen gewahrt, ist es daher etwa nicht zulässig, das Ausbleiben einer inneren Einsicht und Aufarbeitung der dem Beamten vorgeworfenen Pflichtverstöße zu seinen Lasten zu berücksichtigen. Umgekehrt kann hingegen zu seinen Gunsten berücksichtigt werden, wenn der Beamte die von ihm eingeräumten Taten nachträglich aufgearbeitet hat und eine erneute Begehung entsprechender Dienstvergehen nicht mehr zu besorgen ist.32
11Das Disziplinarverfahren wird zudem durch den Beschleunigungsgrundsatz geprägt. Der Landesgesetzgeber hat bei Erlass des LDG zwar auf eine ausdrückliche Normierung des Beschleunigungsgebots im Sinne eines Programmsatzes verzichtet. Dieses liegt dem Disziplinarverfahren aber nach wie vor zugrunde.33 Aus Sicht des Landesgesetzgebers kommt es in der Gestaltung des Disziplinarverfahrens insgesamt sowie in zahlreichen Einzelvorschriften (z. B. in der Äußerungsfrist in § 11 Abs. 3 LDG oder im Ausschluss eines Anspruchs auf Terminverlegung bei Zeugenvernehmung in § 16 Abs. 2 Satz 2 LDG) zum Ausdruck.34 Damit trägt der Gesetzgeber auch Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK sowie der völkervertraglichen Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland Rechnung, sicherzustellen, dass die bundesdeutsche Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit mit der Konvention übereinstimmt.35 Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), dessen Rechtsprechung über den jeweils entschiedenen Fall hinaus Orientierungs- und Leitfunktion für die Auslegung der EMRK hat, entnimmt Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK einen Anspruch auf abschließende gerichtliche Entscheidung innerhalb angemessener Zeit. Die Angemessenheit der Dauer des Verfahrens ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des Verhaltens der Parteien, der Vorgehensweise der Behörden und Gerichte sowie der Bedeutung des Verfahrens für die Parteien zu beantworten. Dies gilt auch für Disziplinarverfahren. Sie müssen innerhalb angemessener Zeit, d. h. ohne schuldhafte Verzögerungen, unanfechtbar abgeschlossen sein. Dabei sind behördliches und gerichtliches Verfahren als Einheit zu betrachten.36
12Der Grundsatz der Beschleunigung bedeutet mithin vor allem, dass das Verfahren in einer effektiven und den Beschleunigungsgrundsatz berücksichtigenden Weise zu gestalten ist. Eine unangemessen lange Verfahrensdauer kann bei der Bestimmung der Disziplinarmaßnahme – mit Ausnahme der Höchstmaßnahme (Entfernung aus dem Beamtenverhältnis bzw. Aberkennung des Ruhegehalts)37 – aus Gründen der Verhältnismäßigkeit mildernd berücksichtigt werden.38 Das disziplinarrechtliche Sanktionsbedürfnis kann hier gemindert sein, wenn die mit dem Disziplinarverfahren verbundenen beruflichen und wirtschaftlichen Nachteile positiv auf den Beamten eingewirkt haben.39
13Ausdruck der Geltung des Beschleunigungsgrundsatzes im Disziplinarrecht ist insbesondere § 37 Abs. 3 Satz 1 LDG. Danach geht der Gesetzgeber typisierend davon aus, dass es unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgrundsatzes regelmäßig möglich ist, ein Disziplinarverfahren auch unter Erhebung der erforderlichen Beweise innerhalb von sechs Monaten abzuschließen.40 Dem hat der Gesetzgeber durch verschiedene Regelungen Rechnung getragen, die zum Teil zwingender Natur sind (vgl. etwa die Äußerungsfrist in § 11 Abs. 3 LDG) und zum Teil im Ermessen der Behörde stehen (vgl. etwa Ausdehnung oder Beschränkung gemäß § 11 Abs. 1 und 2 LDG). Auf die Beschleunigung der disziplinarrechtlichen Ermittlungen zielt etwa auch die in § 14 LDG vorgesehene Bindungswirkung der tatsächlichen Feststellungen bestimmter Entscheidungen.41 Die Disziplinarbehörde ist gehalten, dem Beschleunigungsgrundsatz durch eine effektive und zügige Verfahrensgestaltung Rechnung zu tragen. Dies kann etwa dadurch erfolgen, dass von einer Ausdehnung des Verfahrens auf etwaige weitere Verstöße abgesehen werden kann, wenn sich andernfalls das Disziplinarverfahren erheblich verzögern würde und eine rasche Einwirkung auf den Beamten geboten ist. Der Grundsatz der Einheit des Dienstvergehens wird in einem solchen Fall zugunsten einer Beschleunigung des Verfahrens durchbrochen. Der vom Gesetzgeber angestrebten Verfahrensbeschleunigung dient es ferner, einzelne Handlungen, die für die zu erwartende Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen, aus dem Verfahren auszuscheiden (vgl. § 11 Abs. 2 LDG).42 Schließlich sollen auch die Disziplinargerichte unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgrundsatzes und aus Gründen der Prozessökonomie in Ausübung ihres richterlichen Ermessens regelmäßig von der Möglichkeit des § 21 Satz 2 AGVwGO Gebrauch machen, wenn sich eine Abschlussverfügung als rechtswidrig erweist und die Rechtsverletzung mit der gerichtlichen Entscheidung beseitigt ist.43 Es ist jedoch fraglich, ob an dieser – überzeugenden – Rechtsprechung festgehalten werden kann. Denn das BVerwG44 hat jüngst die Auslegung des § 21 Satz 2 AGVwGO als Sollvorschrift beanstandet und die Auffassung vertreten, wonach § 21 Satz 1 AGVwGO im Fall der Rechtswidrigkeit der Disziplinarverfügung grundsätzlich ihre Aufhebung vorsehe und für die Inanspruchnahme des in § 21 Satz 2 AGVwGO ausnahmsweise vorgesehenen Ausspruchs einer Disziplinarmaßnahme durch Richterspruch daher besondere Gründe vorliegen müssten. Vor allem den Gerichten dürfte daher künftig obliegen, näher zu begründen, wenn sie von ihrer Abänderungsbefugnis Gebrauch machen.45
2.Übersicht über die Disziplinarmaßnahmen
14Die Disziplinarmaßnahmen werden in § 25 LDG – nach Eingriffsintensität gestuft – abschließend bestimmt.46 Grundsätzlich stehen dem Dienstherrn fünf Disziplinarmaßnahmen gegenüber aktiven Beamten zur Verfügung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 LDG): Verweis (§ 27 LDG), Geldbuße (§ 28 LDG), Kürzung der Bezüge (§ 29 LDG), Zurückstufung (§ 30 LDG) und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis (§ 31 LDG).47 Dabei wird zwischen drei Schweregraden von Dienstvergehen unterschieden: Verweis und Geldbuße erfordern ein leichtes Dienstvergehen. Kürzung der Bezüge und Zurückstufung setzen ein mittelschweres Dienstvergehen voraus. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist nur bei einem schweren Dienstvergehen möglich.48 Das Beamtenverhältnis endet zudem kraft Gesetzes, wenn ein Beamter wegen vorsätzlicher Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder bei bestimmten Delikten von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist (§ 24 Abs. 1 BeamtStG).
15Besonderheiten bestehen bei Beamten auf Probe und Beamten auf Widerruf. Bei diesen ist der Maßnahmenkatalog auf Verweis und Geldbuße beschränkt (§ 25 Abs. 1 Satz 2 LDG). Daneben gelten für diese Beamten die besonderen beamtenrechtlichen Entlassungstatbestände der § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 BeamtStG (§ 25 Abs. 1 Satz 3 LDG). Die Entlassung ist keine Disziplinarmaßnahme und setzt daher nicht die Durchführung eines Disziplinarverfahrens voraus; einzelne Vorschriften des Landesdisziplinargesetzes sind jedoch über die Verweise in § 13 Abs. 3 LBG entsprechend anwendbar. Nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG können Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe entlassen werden, wenn sie eine Handlung begehen, die im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass ein Beamter auf Probe, der bereits während seiner Probezeit derart schwerwiegende Verfehlungen begangen hat, insbesondere in charakterliche Hinsicht ungeeignet ist. Die Entlassung soll ungeeignete Personen von einer späteren Übernahme in ein Beamtenverhältnis fernhalten.49 Ähnliches gilt für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die nach § 23 Abs. 4 Satz 1 BeamtStG jederzeit entlassen werden können. Den notwendigen sachlichen Grund für eine Entlassung bildet auch hier das Fehlen der fachlichen und persönlichen, insbesondere charakterlichen Eignung. Insoweit genügen berechtigte Zweifel an der Eignung des Beamten auf Widerruf für das angestrebte Amt oder die angestrebte Laufbahn.50 Schließlich können gegenüber Ehrenbeamten (§ 5 BeamtStG), die keine Bezüge erhalten und nicht Laufbahnbeamte sind, wegen ihrer besonderen Stellung nur ein Verweis, eine Geldbuße und die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ausgesprochen werden (§ 25 Abs. 1 Satz 2 LDG).51
16Bei Ruhestandsbeamten sieht das Gesetz nur die Kürzung der Bezüge und die Aberkennung des Ruhegehalts vor (§ 25 Abs. 2 i. V. m. §§ 32 f. LDG). Ziel der Disziplinarmaßnahmen auch gegen Ruhestandsbeamte ist die Wahrung der Integrität des Berufsbeamtentums und damit die Sicherung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes.52 Im Hinblick auf diesen Zweck ist bei Ruhestandsbeamten neben dem Gesichtspunkt der Generalprävention und dem der gerechten Gleichbehandlung der Ruhestandsbeamten mit den aktiven Beamten auch derjenige der Wahrung des Ansehens des öffentlichen Dienstes von Bedeutung.53 Rückwirkungen auf das Vertrauen in die Integrität der Beamtenschaft wären zu erwarten, wenn ein Ruhestandsbeamter trotz eines erheblichen Dienstvergehens weiterhin sein Ruhegehalt (ungemindert) beziehen könnte. Zur Gleichbehandlung als Teil des allgemeinen Gerechtigkeitsprinzips gehört auch, dass ein Beamter, der nach Begehung einer nicht leichten Verfehlung in den Ruhestand tritt, grundsätzlich nicht bessergestellt werden soll als ein Beamter, der im aktiven Dienst verbleibt (vgl. § 32 Satz 2, § 33 Abs. 1 Satz 2 LDG). Auf diese Weise wird die disziplinare Erfassung nicht von dem mehr oder weniger zufälligen oder gar gesteuerten Ausscheiden aus dem aktiven Dienst abhängig gemacht.54 Ein Verlust der Rechte als Ruhestandsbeamter tritt zudem kraft Gesetzes ein, wenn der Ruhestandsbeamte wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer bestimmten Freiheitsstrafe verurteilt worden ist oder er aufgrund einer Entscheidung des BVerfG ein Grundrecht gemäß Art. 18 GG verwirkt hat (§ 6 Abs. 1 LBeamtVG).
17Das Gesetz bestimmt in den §§ 26 bis 33 LDG die materiellen Voraussetzungen für die Verhängung der einzelnen Disziplinarmaßnahmen.55 Dabei sind die Disziplinarmaßnahmen – mit Ausnahme der Höchstmaßnahme – nach pflichtgemäßem Ermessen festzusetzen (§ 2 LDG i. V. m. § 40 LVwVfG). Das Ermessen ist am gesetzlichen Zweck des Disziplinarrechts auszurichten. Den Tatbeständen der Disziplinarmaßnahmen lässt sich entnehmen, dass die Anhaltung des Beamten zur künftigen Pflichterfüllung ein wesentlicher Aspekt der Ermessensausübung ist. Daneben kommt insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entscheidende Bedeutung zu. Die Ermessenserwägungen sind in der Disziplinarverfügung darzulegen. Etwas anderes gilt bei der Verhängung der Höchstmaßnahme – Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und Aberkennung des Ruhegehalts –, die das Gesetz als gebundene Entscheidung ausgestaltet (vgl. § 31 Abs. 1 Satz 1 LDG „wird er aus dem Beamtenverhältnis entfernt“; § 33 Abs. 1 Satz 1 LDG „wird ihm das Ruhegehalt aberkannt“). Ergibt die disziplinarrechtliche Prüfung mithin, dass ein schweres Dienstvergehen vorliegt und dadurch ein endgültiger Vertrauens- oder Ansehensverlust eingetreten ist, ist der Beamte aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen bzw. ist ihm das Ruhegehalt abzuerkennen.
18Gesetzlich ausgeformt sind mit Blick auf den Vorbehalt des Gesetzes die Folgen der jeweiligen Disziplinarmaßnahme. Das Gesetz macht darüber hinaus zum Teil Vorgaben für die Ausgestaltung einzelner Disziplinarmaßnahmen. Demnach ist die Geldbuße gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 LDG grundsätzlich begrenzt auf die Höhe der monatlichen Bezüge (§ 3 Abs. 1 LDG). Bei einer Kürzung der monatlichen Bezüge bestimmt § 29 Abs. 1 Satz 1 LDG, dass diese um höchstens 20 Prozent für längstens drei Jahre vermindert werden können. Bei der Bestimmung des Anteils sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beamten zu berücksichtigen (§ 29 Abs. 1 Satz 2 LDG); er kann für verschieden lange Zeiträume verschieden hoch festgesetzt werden. Die Kürzung beginnt gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 LDG mit dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Verfügung folgt. Mit der Zurückstufung, d. h. der Versetzung des Beamten in ein anderes Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt, verliert der Beamte gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 und 2 LDG den Anspruch auf die Bezüge aus dem bisherigen Amt und das Recht, die bisherige Amtsbezeichnung zu führen. Mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis, die gemäß § 43 Abs. 1 LVwVfG mit der Zustellung der Verfügung wirksam wird, endet das Beamtenverhältnis (§ 31 Abs. 1 Satz 2 LDG). Der Beamte verliert gemäß § 31 Abs. 1 Satz 3 LDG den Anspruch auf Bezüge und Versorgung sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen und die Dienstkleidung zu tragen. Bezügekürzung und Zurückstufung lösen zudem ein Beförderungsverbot während der Dauer der Bezügekürzung bzw. für fünf Jahre nach Unanfechtbarkeit der Verfügung aus (§ 29 Abs. 4 Satz 1, § 30 Abs. 2 Satz 1 LDG), wobei der gesetzlich vorgesehene Zeitraum verkürzt werden kann (Satz 2). Verweis und Geldbuße bewirken hingegen keine Beförderungssperre.
19Für die Kürzung des monatlichen Ruhegehalts bestimmt § 31 Satz 1 LDG, dass die monatlichen Bezüge um höchstens ein Fünftel für längstens drei Jahre vermindert werden können. Wie bei der Bezügekürzung bei aktiven Beamten sind bei der Bestimmung des Anteils die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beamten zu berücksichtigen (§ 31 Satz 4 i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 2 LDG); jener kann für verschieden lange Zeiträume verschieden hoch festgesetzt werden. Die Kürzung beginnt gemäß § 31 Satz 4 i. V. m. § 29 Abs. 2 Satz 1 LDG ebenfalls mit dem Kalendermonat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Verfügung folgt. Mit der Aberkennung des Ruhegehalts, die gemäß § 43 Abs. 1 LVwVfG mit der Zustellung der Verfügung wirksam wird, verliert der Beamte gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 LDG den Anspruch auf Versorgung einschließlich der Hinterbliebenenversorgung und die Befugnis, die Amtsbezeichnung und die Titel zu führen, die im Zusammenhang mit dem früheren Amt verliehen wurden.
3.Dienstvergehen als zentraler Begriff des Disziplinarrechts
20Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme setzt ein Dienstvergehen sowie eine Beeinträchtigung des Vertrauens des Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung voraus. Der zentrale Begriff des Dienstvergehens wird in § 47 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG definiert.56 Danach begehen Beamte ein Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden Pflichten verletzen. Das Disziplinarverfahren dient dazu, zu ermitteln, ob der Beamte durch ein bestimmtes Verhalten eine ihm obliegende Pflicht verletzt hat (objektive Dienstpflichtverletzung). Ferner muss feststehen, dass der Beamte bei Begehung der Dienstpflichtverletzung schuldhaft gehandelt hat (subjektive Vorwerfbarkeit).
21a) Objektive Dienstpflichtverletzung. Der gesetzliche Begriff des Dienstvergehens (§ 47 Abs. 1 BeamtStG) umfasst alle disziplinarrechtlich bedeutsamen Dienstpflichtverletzungen des Beamten. Diese werden durch eine einheitliche Disziplinarmaßnahme geahndet, die aufgrund einer Gesamtwürdigung des Verhaltens und der Persönlichkeit des Beamten zu bestimmen ist.57 Im Disziplinarrecht finden sich von jeher nicht wie im Strafrecht einzelne Tatbestände mit entsprechenden Strafdrohungen, sondern Generalklauseln, wonach die schuldhafte Verletzung von Berufspflichten mit einer gesetzlich vorgesehenen Disziplinarmaßnahme geahndet wird.58
22aa) Dienstpflichtverletzung. Das Disziplinarrecht kann nicht auf einen abgeschlossenen Katalog von Verhaltensweisen zurückgreifen, die ein Dienstvergehen begründen.59 Entscheidend ist der Rückgriff auf beamtenrechtliche Dienstpflichten und deren Ausformung im Einzelfall. Welche Dienstpflichten den Beamten obliegen, ist nicht im Landesdisziplinargesetz geregelt, sondern folgt aus dem allgemeinen Dienst- und Treueverhältnis. Dienstpflichten sind vor allem in allgemeinen beamtenrechtlichen Gesetzen (v. a. §§ 33 ff. BeamtStG, LBG), spezialgesetzlichen Bestimmungen (z. B. LHG, GemO), innerdienstlichen Vorschriften und Anordnungen sowie allgemeinen Regelungen enthalten. Von zentraler Bedeutung sind insbesondere die beamtenrechtlichen Grundpflichten, wie sie in den §§ 33 ff. BeamtStG normiert sind.
23Die beamtenrechtlichen Dienstpflichten werden weitgehend generalklauselhaft formuliert und müssen nach Inhalt und Reichweite des Pflichtentatbestands anhand des Einzelfalls konkretisiert werden.60 Diese Generalklauseln sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts selbst unter dem strengen Maßstab des Art. 103 Abs. 2 GG nicht zu beanstanden, weil eine vollständige Aufzählung der mit dem Beruf verbundenen Pflichten nicht möglich ist.61 Es handelt sich um Normen, die nur den Kreis der Berufsangehörigen betreffen, sich aus der ihnen gestellten Aufgabe ergeben und daher für sie im Allgemeinen leicht erkennbar sind. In manchen Bereichen bestehen zudem konkretisierende Rechtsvorschriften und Weisungen. So konkretisieren etwa die Arbeitszeitvorschriften die Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG) in zeitlicher Hinsicht. Fehlen derartige konkretisierende Rechtsvorschriften oder Weisungen, ist der jeweilige Pflichtentatbestand im Lichte der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums und sich wandelnder gesellschaftlicher Anschauungen anhand der dem Beamten gestellten Aufgaben zu betrachten.62 Ein festgestelltes Verhalten kann mehrere Dienstpflichten verletzen.
24Zu beachten ist, dass sich der Inhalt der Dienstpflichten nicht gänzlich mit dem Inhalt der disziplinär zu ahndenden Pflichtverletzung des Beamten deckt, weil zum letztgenannten Tatbestand ein Minimum an Gewicht und an Evidenz der Pflichtverletzung gehört.63 Nicht jeder Pflichtenverstoß erfüllt mithin die objektiven Merkmale eines Dienstvergehens. Erforderlich ist vielmehr, dass die Schwelle des disziplinarisch Erheblichen überschritten ist. Gelegentlich auftretende Unzulänglichkeiten,64 z. B. in fachlicher Hinsicht oder bei Einhaltung der Arbeitszeiten, sind zwar nicht als dienstrechtlich belanglos anzusehen und können Anlass zu allgemeinen beamtenrechtlichen Maßnahmen (z. B. Personalgespräch, Hinweis auf Rechts-/Weisungslage, Aufforderung zur Pflichterfüllung, dienstliche Weisung) sein, haben jedoch keine disziplinarrechtliche Relevanz (sogenannte Bagatellverfehlung).65 Wann die Erheblichkeitsschwelle erreicht ist, lässt sich nicht allgemein festlegen, sondern ist im Einzelfall zu bestimmen.
25Dienstpflichten können durch aktives Tun oder Unterlassen einer durch die jeweiligen Dienstpflichten gebotenen Handlung verletzt werden.66 Beispielsweise kann die Verletzung der Verfassungstreuepflicht in einem Unterlassen bestehen, wenn etwa der Vorgesetzte verfassungsfeindliche Umtriebe innerhalb seines Verantwortungsbereichs geflissentlich übersieht und geschehen lässt.67 Beide Begehungsformen (aktives Tun/Unterlassen) sind in der abstrakten Gewichtung der Verfehlung gleichwertig. Im Einzelfall kann ein Unterlassen weniger schwer wiegen als ein aktives Handeln. Das wird angenommen, wenn die durch Unterlassen begangene Pflichtverletzung im konkreten Fall keine vergleichbar schwere Vertrauensverletzung gegenüber dem Dienstherrn darstellt wie ein aktives Handeln.68 Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur der Fall, wenn die gebotene Handlung dem Unterlassenden mehr abverlangt als den normalen Einsatz rechtstreuen Willens.69
26Für das Vorliegen einer disziplinarrechtlich relevanten Dienstpflichtverletzung ist unerheblich, ob der Beamte – im Sinne des Strafrechts – als Täter, Anstifter oder Tatgehilfe gehandelt hat.70 Entscheidend ist insoweit, dass der Beamte durch das persönlichkeitsbezogene eigene Verhalten schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt hat. Pflichtwidriges Verhalten kann nur die Pflichtwidrigkeit des eigenen Verhaltens und nicht etwa Beitrag zu einer fremden Pflichtwidrigkeit sein.71 Für das Vorliegen einer disziplinarrechtlich relevanten Dienstpflichtverletzung ist ebenso wenig von Relevanz, ob eine Straftat nur versucht oder bereits vollendet worden ist.72 Denn für die im Disziplinarrecht gebotene Persönlichkeitsbeurteilung kommt es vor allem auf den gezeigten Handlungswillen des Beamten an.73 Diese Aspekte (z. B. Gehilfenstellung, versuchte Straftat) können jedoch bei der Bemessung der Disziplinarmaßnahme eine Rolle spielen. So kann die individuelle Schuld geringer zu veranschlagen sein, wenn sich z. B. der Beamte als Gehilfe am Zugriffsdelikt eines anderen Beamten beteiligt oder aus freien Stücken von der Vollendung des Straftatbestands Abstand genommen hat.74
27Zu unterscheiden ist zwischen innerdienstlichen und außerdienstlichen Pflichtverletzungen. Ein Verhalten liegt außerhalb des Dienstes, wenn es weder formell in das Amt des Beamten noch materiell in die damit verbundene dienstliche Tätigkeit eingebunden ist. Die Unterscheidung zwischen inner- und außerdienstlicher Pflichtverletzung beruht nicht ausschließlich auf der formalen Zuordnung in räumlicher oder zeitlicher Beziehung zur Dienstausübung, denn diese ist von Zufälligkeiten abhängig. Das wesentliche Unterscheidungselement ist vielmehr funktionaler Natur. Entscheidend für die rechtliche Einordnung eines Verhaltens als innerdienstliche Pflichtverletzung ist dessen kausale und logische Einbindung in ein Amt und die damit verbundene dienstliche Tätigkeit. Maßgebliche Bedeutung kommt somit dem Umstand zu, ob das pflichtwidrige Verhalten in das Amt und in die damit verbundenen dienstlichen Pflichten eingebunden gewesen ist. Besteht diese Verknüpfung, kommt es nicht darauf an, ob das Dienstvergehen innerhalb oder außerhalb der Dienstzeit begangen wird. Ist eine solche Einordnung nicht möglich – insbesondere, wenn sich das Handeln als das einer Privatperson darstellt –, ist es als außerdienstliches (Fehl-)Verhalten zu qualifizieren.75
28Dass innerdienstliche Pflichtverletzungen zum Vorliegen eines Dienstvergehens führen können, liegt auf der Hand. Nach seinem eindeutigen Wortlaut knüpft § 47 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG im außerdienstlichen Bereich die Annahme eines Dienstvergehens an engere Voraussetzungen („nur dann“). Danach ist als Dienstvergehen das außerdienstliche Verhalten von Beamten nur zu qualifizieren, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.
29Früher ging die Rechtsprechung davon aus, der Beamte sei „niemals Privatmann“, sondern auch außerhalb des Dienstes Beamter, der in allen Lebenslagen auf seine Amtsstellung Rücksicht zu nehmen habe. Dies ist überholt. Der Gesetzgeber bringt durch die gesetzliche Regelung zum Ausdruck, dass von einem Beamten außerdienstlich grundsätzlich kein wesentlich anderes Sozialverhalten als von jedem anderen Bürger erwartet wird. Ein außerdienstliches Fehlverhalten kann daher nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Dienstvergehen begründen. Außerhalb seines Dienstes ist der Beamte grundsätzlich nur verpflichtet, der Achtung und dem Vertrauen gerecht zu werden, die sein Beruf erfordert (vgl. § 34 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG). Außerdienstliches Verhalten kann den Pflichtenkreis des Beamten nur berühren, wenn es die Achtungs- und Vertrauenswürdigkeit betrifft und dadurch mittelbar dienstrechtliche Relevanz erlangt. Das Vertrauen der Bürger, dass der Beamte dem Auftrag gerecht wird, als Repräsentant des demokratischen Rechtsstaates eine unabhängige, unparteiliche und gesetzestreue Verwaltung zu sichern, darf der Beamte auch durch sein außerdienstliches Verhalten nicht beeinträchtigen. Dabei reicht bei außerdienstlichen Verfehlungen nicht bereits die Pflichtverletzung selbst zur Annahme eines Dienstvergehens aus, und zwar auch dann nicht, wenn hierdurch eine Straftat begangen worden ist. Hinzutreten müssen weitere, auf die Eignung zur Vertrauensbeeinträchtigung bezogene Umstände.76 Nur soweit es um die Wahrung des Vertrauens der Bürger in die Integrität der Amtsführung und damit in die künftige Aufgabenwahrnehmung geht, vermag das durch Art. 33 Abs. 5 GG geschützte Interesse an der Funktionsfähigkeit des Berufsbeamtentums die im privaten Bereich des Beamten wirkenden Grundrechte einzuschränken.77 Unterhalb dieser Schwelle erwartet der Gesetzgeber kein wesentlich anderes Sozialverhalten mehr als von jedem anderen Bürger.78
30Ob und in welchem Umfang durch das außerdienstliche Verhalten eines Beamten das für sein Amt erforderliche Vertrauen beeinträchtigt wird, hängt in maßgeblicher Weise von Art und Intensität der jeweiligen Verfehlung ab.79 Dabei kommt vorsätzlichen (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG) Straftaten besondere Bedeutung zu.80 Zu einer erheblichen Vertrauensbeeinträchtigung führt in der Regel zudem eine Straftat im Sinne des ersten bis sechsten Abschnitts des Besonderen Teils des StGB (§§ 80–120 StGB), da damit die Stellung des Beamten als Repräsentant des demokratischen Rechtsstaates betroffen ist. Entsprechendes gilt für Straftaten, durch die das Vermögen des Staates betroffen ist, wie z. B. Steuer- und Abgabenhinterziehung. Eine Achtungs- und Vertrauensbeeinträchtigung liegt darüber hinaus in der Regel bei vorsätzlich begangenen schwerwiegenden Straftaten vor, die mit einer Freiheitsstrafe geahndet worden sind, wie die gesetzgeberische Wertung in § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG zeigt.81 Maßgeblich ist auch, ob der Pflichtenverstoß des Beamten einen Bezug zu seinem Amt aufweist.82 Bezugspunkt hierfür ist das dem Beamten verliehene Amt im statusrechtlichen Sinne.83 Aus dem sachlichen Bezug des Dienstvergehens zum konkreten Aufgabenbereich kann sich darüber hinaus eine Indizwirkung ergeben. Der Beamte wird mit dem ihm übertragenen konkreten Amt identifiziert; dieses hat er uneigennützig, nach bestem Gewissen und in voller persönlicher Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen wahrzunehmen. Je näher der Bezug des außerdienstlichen Fehlverhaltens des Beamten zu dem ihm übertragenen Aufgabenbereich ist, umso eher kann davon ausgegangen werden, dass sein Verhalten geeignet ist, das Vertrauen zu beeinträchtigen, das sein Beruf erfordert.84 So sind außerdienstliche Vermögensdelikte beispielsweise eher geeignet, Rückschlüsse auf die dienstliche Vertrauenswürdigkeit eines Kassenbeamten zu ziehen, als Straßenverkehrs- oder Ehrverletzungsdelikte.85
31Außerdienstliches Fehlverhalten kann nach seiner Typik geeignet sein, regelmäßig den erforderlichen Amtsbezug i. S. d. § 47 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG und damit die Disziplinarwürdigkeit entsprechender Verfehlungen zu begründen. In der Rechtsprechung haben sich insoweit Fallkonstellationen bei bestimmten Personengruppen herausgebildet. Ein hinreichender Amtsbezug wird etwa im Fall des außerdienstlichen Besitzes kinderpornographischer Schriften bei Lehrern aufgrund ihrer besonderen Aufgaben- und Vertrauensstellung gegenüber einer besonders verletzlichen Personengruppe – den ihnen anvertrauten Schülern – angenommen.86 Entsprechendes gilt bei außerdienstlich begangenen Straftaten von Polizeibeamten, deren Aufgabe gerade ist, Straftaten zu verhüten und zu verfolgen (vgl. § 1 Abs. 2 PolG, § 161 Abs. 1 Satz 2, § 163 StPO).87 Ferner wird bei Strafvollzugsbeamten im Fall des außerdienstlichen Besitzes von kinderpornographischem Bild- und Videomaterial, bei außerdienstlichen Betäubungsmitteldelikten, also Verstößen gegen die §§ 29 ff. BtMG und damit im Zusammenhang stehenden Straftaten, sowie bei außerdienstlich begangenen Straftaten, die mit einer Form von Gewaltanwendung verbunden sind, ein hinreichender Amtsbezug zu den statusgemäßen Dienstpflichten angenommen.88
32bb) Relevante Dienstpflichten. Zu den Dienstpflichten, die im Rahmen der Prüfung eines Dienstvergehens vor allem relevant sein können, zählen insbesondere die Grundpflichten der §§ 33 ff. BeamtStG. Deren wesentlicher Inhalt ist nachfolgend dargestellt. Ergänzend findet sich am Ende der Einführung (siehe unten 7.) eine Übersicht mit Beispielen aus der Rechtsprechung zu Dienstpflichtverletzungen.
33Dem Beamten obliegt die Pflicht zur Neutralität, § 33 Abs. 1 Satz 1 und 2 BeamtStG. Die Neutralitätspflicht ist eine spezielle Ausprägung der allgemeinen Treuepflicht des Beamten und Bestandteil der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG).89 Sie bildet eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen der Bürger in die Verwaltung des demokratischen Rechtsstaats.90 Bezugsobjekt der Treuepflicht des Beamten sind insoweit der Bürger und die Allgemeinheit, denen er Treue in Form strikter Neutralität schuldet.91 Darüber hinaus gilt die Neutralitätspflicht aber nicht nur im Verhältnis des Beamten zum Bürger, sondern auch im Verhältnis des Vorgesetzten zum Mitarbeiter. § 33 Abs. 1 Satz 1 und 2 BeamtStG gestalten die Neutralitätspflicht als parteiliche Neutralitätspflicht (Satz 1), Pflicht zur unparteiischen und gerechten Amtsführung (Satz 2 Alt. 1) und Gemeinwohlverpflichtung (Satz 2 Alt. 2) aus. Eine Verletzung der Neutralitätspflicht geht häufig mit einer Verletzung der Pflicht zur uneigennützigen Aufgabenerfüllung (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG) und der Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten (§ 34 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG) einher.
34Das Gebot, dem ganzen Volk und nicht einer Partei zu dienen (§ 33 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG),92 dient dem Beamten als Richtschnur für die Amtsführung. Er darf bei seiner Amtsführung nicht zugunsten einer Partei, politischen Vereinigung oder politischen Gruppierung handeln.93 Dem Beamten ist es verwehrt, Bürger oder Mitarbeiter, deren Anschauungen seiner politischen Meinung entsprechen, anderen gegenüber zu bevorzugen. Es steht ihm aber frei, sich außerhalb seines Amtes – unter Beachtung des Mäßigungsgebots und der Verfassungstreuepflicht – parteipolitisch oder in sonstigen politischen Gruppen zu betätigen. Bewirbt sich ein Beamter um ein politisches Mandat, darf er keinen Einrichtungen des Dienstherrn (etwa Maildienst des Dienstherrn) zu Wahlkampfzwecken in Anspruch nehmen und ist es ihm folglich auch untersagt, etwa auf Wahlkampfmitteilungen, seine dienstlichen Kontaktdaten anzugeben.94 Die Pflicht zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet den einzelnen Beamten zudem dazu, ungeachtet der persönlichen Verbundenheit zu einer bestimmten Partei oder einer bestimmten politischen Richtung jeder verfassungsmäßigen Regierung, unter deren Leitung er steht, entsprechend seiner Pflicht zu Treue und Gehorsam loyal zur Verfügung zu stehen.95
35Der Beamte hat gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und sein Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Die Pflicht zur unparteiischen Amtsführung bedeutet, dass sich der Beamte bei Wahrnehmung der seinem Amt obliegenden Aufgaben allein von sachlichen Umständen hat leiten zu lassen. Der Beamte muss allein nach sachlichen Gesichtspunkten handeln und entscheiden und darf niemanden ohne Grund bevorzugen oder benachteiligen.96 Die Unparteilichkeit, die ein wesentliches Element der in Art. 33 Abs. 5 GG gesicherten Strukturprinzipien der Institution des Berufsbeamtentums ist, bezieht sich mithin nicht nur – wie bei Satz 1 – auf politische Parteien, sondern stellt allgemein auf Interessengruppen ab. Das Gebot der unparteiischen Amtsführung untersagt dem Beamten insgesamt eine von persönlichen Interessen oder Beziehungen bzw. sachwidrigen Motiven geleitete Amtsführung. Damit inhaltlich eng verbunden ist die Pflicht zur gerechten Amtsführung, die vor allem eine dem Gleichheitssatz genügende Rechtsanwendung gebietet.97 Die Ausrichtung am Wohl der Allgemeinheit in § 33 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BeamtStG ist – wie die parteiliche Neutralität in Satz 1 – Leitziel der Amtsführung, das neben den unmittelbar geltenden Verhaltensregeln durch Gesetz, Rechtsverordnung oder innerdienstliche Weisung stets zu beachten ist.98 Die Einhaltung des Gebots einer gemeinwohlorientierten Amtsführung wird in erster Linie durch die unparteiische und gerechte Aufgabenerfüllung gewährleistet. Das Gebot untersagt dem Beamten auch, sich selbst oder bestimmten von ihm favorisierten Gruppen oder Organisationen im Rahmen des Amtes persönliche Vorteile zu verschaffen, da er die Aufgaben seines Amtes nicht zu seinem privaten Nutzen oder zum Nutzen bestimmter Gruppierungen, sondern allein zum Zwecke der Gemeinwohlverwirklichung wahrnehmen muss.99 Eine unparteiische Amtsführung erfordert es daher, Amtshandlungen zu unterlassen, durch die der Beamte sich selbst oder seinen Angehörigen im Sinne von § 20 LVwVfG einen Vorteil verschaffen würde.100 Der Beamte hat durch sein Verhalten jeden Anschein zu vermeiden, er werde sein Amt nicht unparteiisch und ausschließlich gemeinwohlorientiert wahrnehmen. Daher dürfen die Amtsführung sowie die politische Betätigung des Beamten nicht Formen annehmen, die aus der Sicht eines unvoreingenommenen Betrachters geeignet sind, Zweifel an einer politisch neutralen, nur dem Allgemeinwohl verpflichteten Amtsführung ohne Ansehen der Person hervorzurufen; es genügt insoweit der „böse Schein“101.
36Das Erfordernis der Ausrichtung am Wohl der Allgemeinheit und einer unparteiischen und gerechten Aufgabenwahrnehmung wird in einer Reihe weiterer Bestimmungen konkretisiert, wie etwa in dem Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und sonstiger Vorteile nach § 42 BeamtStG,102 aber auch in Beratungs- und Betreuungspflichten gegenüber den Bürgern103 (vgl. § 25 LVwVfG). Auch die Pflicht zur uneigennützigen Amtsführung (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG) dient der Sicherung der unparteiischen, gerechten und gemeinwohlorientierten Aufgabenwahrnehmung. Dies gilt ebenso für die verfahrensrechtlichen Vorschriften über den Ausschluss von Beamten von bestimmten Amtshandlungen (vgl. § 20 LVwVfG), auch wegen Besorgnis der Befangenheit (vgl. § 21 LVwVfG).104
37Nach § 33 Abs. 2 BeamtStG haben Beamte bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Es handelt sich hierbei um eine dem Grunde nach zulässige Einschränkung des Grundrechts der Meinungsfreiheit im Sinne von Art. 5 Abs. 2 GG.105 Das geforderte Maß an Mäßigung und Zurückhaltung folgt aus der Stellung des Beamten gegenüber der Allgemeinheit (allgemeiner Maßstab) sowie aus der dienstlichen Stellung des Beamten bezogen auf das jeweilige Amt im statusrechtlichen und funktionellen Sinne (individueller Maßstab).106
38Die Pflicht zur politischen Mäßigung verlangt von den Beamten im Dienst eine besondere Zurückhaltung.107 Grundsätzlich gilt, dass sich der Beamte einer politischen Betätigung im Dienst regelmäßig zu enthalten hat. Der damit verfolgte Schutzzweck besteht darin, die Funktionsfähigkeit des Beamtentums dadurch zu gewährleisten, dass zum einen im Rahmen des Dienstbetriebes störende politische Auseinandersetzungen vermieden werden, zum anderen die politische Neutralität der Amtsführung und das Vertrauen der Öffentlichkeit hierauf nicht gefährdet oder auch nur in Zweifel gezogen werden kann.108 Einen Verstoß gegen das Gebot der Mäßigung und Zurückhaltung stellt es etwa dar, wenn für den Eintritt in eine Partei während des Dienstes, vor allem als Vorgesetzter, geworben oder die eigene politische Meinung gegenüber Bürgern, die das Amtsgebäude aufsuchen, verbreitet wird.109 Gestattet ist es dem Beamten indes, in privaten Unterhaltungen mit Kollegen während der Dienstzeit, auch als Vorgesetzter, seine politische Meinung zu äußern und auch Kritik am politischen Verhalten von Verfassungsorganen oder an der Politik der die Regierung tragenden Parlamentsfraktionen zu üben.110 Seine politischen Meinungsäußerungen dürfen jedoch nicht Formen annehmen, die den Eindruck entstehen lassen könnten, der Beamte werde bei seiner Amtsführung nicht loyal gegenüber seinem Dienstherrn und nicht neutral gegenüber jedermann sein oder dienstlichen Anordnungen unter Umständen nicht Folge leisten. Ein Verstoß gegen das Mäßigungsgebot ist zudem anzunehmen, wenn die übrigen Beschäftigten oder die kollegiale Zusammenarbeit in der Dienststelle durch die politischen Äußerungen eines Kollegen erheblich beeinträchtigt werden. Die Schwelle, ab der solche Äußerungen einen Verstoß gegen das Gebot der Mäßigung und Zurückhaltung begründen, ist dabei nicht erst dann erreicht, wenn die Situation für die übrigen Mitarbeiter schlicht unerträglich wird und sie gezwungen sind, den Raum zu verlassen, um sich den politischen Ausführungen eines Kollegen zu entziehen. Auch die häufige und auch intensive Äußerung von politischen Ansichten im Dienst gegenüber Mitarbeitern im Rahmen von privaten Gesprächen, die als solche die Grenzen zulässiger politischer Meinungsäußerung von Beamten nicht überschreiten, kann eine Dienstpflichtverletzung begründen, wenn dies den Dienstbetrieb und die Erledigung der dienstlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungseinheit beeinträchtigt. Schließlich können sich aus dem jeweiligen Amt Anforderungen an das Maß an Mäßigung und Zurückhaltung ergeben. Besonderheiten ergeben sich etwa im Schulbereich bei Lehrern gegenüber den ihnen anvertrauten Schülern; insbesondere ist Lehrern eine einseitige Werbung politischer Art unter Ausnutzung ihrer dienstlichen Stellung und den damit eingeräumten Einflussmöglichkeiten auf die ihnen anvertrauten Schüler grundsätzlich untersagt.111
39Außerhalb des Dienstes darf sich der Beamte politisch betätigen, solange er keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen unterstützt und klar zwischen Amt und politischer Betätigung trennt. Er darf Einrichtungen des Dienstherrn (z. B. Diensttelefon oder dienstliche E-Mail-Adresse) nicht für seine politische Betätigung in Anspruch nehmen.112 Im außerdienstlichen Bereich hängt das erforderliche Maß der Mäßigung und Zurückhaltung davon ab, ob und inwieweit die politische Betätigung einen Bezug zur dienstlichen Stellung und zu den dienstlichen Aufgaben aufweist. Jedenfalls muss der Beamte auch außerhalb des Dienstes darauf bedacht sein, eine klare Trennung zwischen dem Amt und der Teilnahme am politischen Meinungskampf einzuhalten. Er darf bei seinen privaten Äußerungen nicht den Anschein einer amtlichen Stellungnahme erwecken. Einschränkungen ergeben sich auch für den Stil der politischen Betätigung und die Wortwahl politischer Meinungsäußerungen.113 Politische Meinungsäußerungen dürfen – wie bei innerdienstlichen Äußerungen – nicht Formen annehmen, die den Eindruck entstehen lassen könnten, der Beamte werde bei seiner Amtsführung nicht loyal gegenüber seinem Dienstherrn und nicht neutral gegenüber jedermann sein oder dienstlichen Anordnungen nicht Folge leisten.114 So darf etwa das Recht auf Kritik, auch an der Regierung, nicht in gehässiger, polemischer, agitatorischer oder aufhetzender Weise geschehen oder die Teilnahme am politischen Meinungskampf grundsätzlich nicht mit unangemessenen Kommunikationsformen (wie etwa übertriebener Polemik, manipulativen, beleidigenden, unwahren, unsachlichen oder diffamierenden Äußerungen) geführt werden.115 Unzulässig ist es im Regelfall, durch eine regelmäßig negative Darstellung von Maßnahmen oder Zielen des Dienstherrn bzw. der eigenen Behördenleitung in der Öffentlichkeit – ggf. unter Preisgabe von Dienstgeheimnissen – die öffentliche Meinung gegen den Dienstherrn oder die Behördenleitung zu mobilisieren, mit dem Ziel, zur Durchsetzung des eigenen Standpunkts öffentlichen Druck aufzubauen (sogenannte „Flucht in die Öffentlichkeit“).116 Im Einzelfall kann die Grenzziehung zwischen noch vertretbarem und dienstpflichtwidrigem Verhalten jedoch schwierig sein; typischerweise wird es auf eine Bewertung der Gesamtumstände einschließlich etwaiger situationsabhängiger Wechselwirkungen ankommen.117 Eine Dienstpflichtverletzung kann ferner darin liegen, dass das Amt und das mit diesem aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Ausgestaltung verbundene Ansehen und Vertrauen durch Hervorhebung dazu benutzt und eingesetzt wird, der Meinung des Amtsinhabers in der politischen Auseinandersetzung mehr Nachdruck zu verleihen und durch den Einsatz des Amtes politische Auffassungen des Amtsinhabers wirksamer durchzusetzen.118
40Nach § 33 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG müssen sich Beamte durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen (Alt. 1) und für deren Erhaltung eintreten (Alt. 2). Damit einher geht nicht nur das Verbot einer gegen die Verfassung gerichteten Verhaltensweise, sondern eine Pflicht zum aktiven Handeln (vgl. Verpflichtung zum Eintreten im Sinne von Alt. 2)119. Die Verpflichtung zur Verfassungstreue