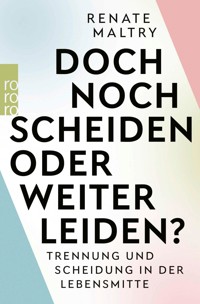
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein unverzichtbares Buch für alle, die bei späten Scheidungen nach fundierter Beratung suchen! Trennungen nach jahrzehntelanger Ehe sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Unterschiedliche Lebensvorstellungen, Krankheiten, das Verblassen der Gefühle oder ein spätes Coming-out können Gründe dafür sein. Eigentlich wollte man gemeinsam alt werden, nun will (oder muss) man sich unverhofft neu erfinden. Die erfahrene Juristin Renate Maltry und der Psychologe Heinz-Günter Andersch-Sattler erklären laienfreundlich anhand vierzehn lebensnaher Fallgeschichten rechtliche Fragen von Auskunftsanspruch bis Zugewinnausgleich und machen Betroffenen zugleich Mut, ihr Leben neu zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Renate Maltry
Doch noch scheiden oder weiter leiden?
Trennung und Scheidung in der Lebensmitte
Über dieses Buch
«Jetzt scheidet uns das Leben doch noch» – das sagen viele Betroffene jenseits der 45, 55 oder sogar 65, wenn sie den Weg zur Anwältin oder zum Anwalt gefunden haben. Die Scheidung nach jahrzehntelanger Ehe ist längst kein Tabu mehr. Auch die Statistik fördert Überraschendes zutage: Nach der Silberhochzeit werden in Deutschland fast dreimal so viele Ehen geschieden wie im angeblich verflixten siebten Jahr. Hinzu kommen sehr viele Paare, die sich trennen, aber nicht scheiden lassen. Unterschiedliche Vorstellungen über den gemeinsamen Lebensabend, Erkrankungen, der Verlust der Gefühle oder sogar ein spätes Coming-out können Ursache für die Trennung sein. In vierzehn Fallgeschichten zeigt die erfahrene Juristin Renate Maltry gemeinsam mit dem Psychologen Heinz-Günter Andersch-Sattler die besonderen Herausforderungen einer Scheidung nach einer langjährigen Ehe und leuchtet diese aus juristischer und psychologischer Perspektive aus. So entsteht ein informativer und lebensnaher Ratgeber, der eine laienfreundliche Erklärung juristischer Aspekte bietet und Betroffenen zugleich Mut macht, ihr Leben neu zu gestalten.
Vita
Renate Maltry ist erfahrene Rechtsanwältin und ausgewiesene Expertin für Familien- und Erbrecht. Sie war acht Jahre im Bundesvorstand des Deutschen Juristinnenbundes, 10 Jahre bis 2021 Mitglied der Kommission zum Familien- und Erbrecht des djb und viele Jahre Lehrbeauftragte für das Familienrecht an der Fachhochschule München. Als zertifizierte Unternehmensnachfolgeberaterin der Universität Mannheim, zentUma, betreut sie seit Jahren Familienunternehmen. Hier kommen ihr auch ihr BWL-Studium an der LMU München und ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau zugute. Daneben ist sie zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT).
Als ausgebildete Familien- und Wirtschaftsmediatorin war ihr frühzeitig der Blick über den Tellerrand sehr wichtig. Aus diesem Gedanken heraus gründete Renate Maltry 1986 den Verein TuSch (Trennung und Scheidung) e. V. in München und Ingolstadt, in dem sie sich bis heute mit Vorträgen engagiert (www.tusch.info). Alleinstellung des renommierten Vereins ist von Beginn an die interdisziplinäre Zusammenarbeit von PsychologInnen, JuristInnen und SteuerberaterInnen. Darüber hinaus ist Renate Maltry gefragte Vortragsrednerin auf Fachkonferenzen und Veranstaltungen für Betroffene.
Mit ihrer Münchener Kanzlei MALTRY Rechtsanwältinnen PartGmbB vertritt sie seit über 30 Jahren Betroffene in Scheidungsverfahren – mit fachlicher Kompetenz, aber auch mit Lebenserfahrung und einem klaren Blick für die persönlichen Nöte ihrer Mandantinnen und Mandanten. 2013 wurde ihr für ihre juristischen Verdienste und ihr ehrenamtliches Engagement der Bayerische Verdienstorden verliehen.
Mehr unter www.rechtsanwaeltinnen.com/de
Heinz-Günter Andersch-Sattler ist Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut. Seit vielen Jahren unterstützt er Menschen in Krisensituationen, als Familientherapeut, systemischer Coach, Managementtrainer und Berater. Er besitzt langjährige Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Psychotherapeuten und gründete gemeinsam mit seiner Frau Eva Sattler SynTraum, ein Institut für Psychotherapie, Aus- & Fortbildung und Supervision in Augsburg, das er bis heute leitet. Außerdem ist Heinz-Günter Andersch-Sattler Leiter und Inhaber der Firma SynCoaching, die Coaching und Training für Profit und Non-Profit-Organisationen anbietet, sowie Gründer und Betreiber der Plattform www.netzwerkstressundtrauma.com, die Therapeuten und Betroffene vernetzt. Seit Jahren führt er Kongresse im Bereich von Traumatherapie, systemischer Therapie und Beratung für das Fachpublikum durch. Er ist Mitarbeiter im Team Dr. Rosenkranz.
Mehr unter www.syntraum.de und www.team-rosenkranz.de
Renate Maltry und Heinz-Günter Andersch-Sattler kennen sich seit Jahrzehnten und arbeiten seit vielen Jahren zusammen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ana González y Fandiño
Covergestaltung zero-media.net, München
ISBN 978-3-644-02073-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Einführung: Scheidung als Neubeginn
Exkurs: Der Wandel von Ehe und Familie von 1900 bis heute
1. Klara und Heinz: «Corona? Alles gelogen!»
Juristische Infos: Was zu beachten ist, wenn Sie möglichst schnell geschieden werden wollen
Psychologische Aspekte: Verschiedene Trennungsphasen
2. Margot und Xaver: «Was soll ich im noblen Seniorenheim?»
Juristische Infos: Dauerhafte Trennung oder doch besser Scheidung?
Psychologische Aspekte: Fehlende gemeinsame Vision für den Lebensabend
3. Gudrun und Ernst: «Ich komme zurück, du musst mich pflegen.»
Juristische Infos: Die oft unbedachten Folgen einer Trennung ohne Scheidung
Psychologische Aspekte: Wenn ungeschriebene Beziehungsverträge zerbrechen
4. Véronique und Holger: «Was sind schon 21 Jahre?»
Juristische Infos: Warum Eheverträge nicht immer Bestand haben
Psychologische Aspekte: Unterschiedliche Lebensphasen bei großem Altersunterschied
5. Hanna und Rudi: «Wen interessiert schon, was du tust oder lässt?»
Juristische Infos: Was passiert bei einer gemeinsamen Mietwohnung?
Kontrollzwang und die Suche nach Sicherheit
6. Irene und Peter: «Handeln Sie, solange Sie noch können!»
Demenz und die Folgen für Scheidung und Erbe
Psychologische Aspekte: Krankheit und Persönlichkeitsveränderung
7. Christine und Martin: «Es war ein perfektes Leben, das wir führten.»
Juristische Infos: Die Situation des im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten, meist die Ehefrau
Besondere Probleme der Unternehmerehe
8. Ulrike und Jürgen: «Ich habe noch Chancen und will mein Leben leben!»
Untreue als Scheidungsgrund?
Autonomie versus Unabhängigkeit in einer Beziehung
9. Heidi und Werner: «Plötzlich bin ich Luft!»
Juristische Infos: Die Scheidung und die Folgesachen wie Unterhalt und Zugewinn
Abschneiden und Abgeschnittensein – die Leugnung von vielen Ehejahren
10. Maya und Anton: «Wir haben uns als Paar verloren, doch die gegenseitige Wertschätzung, die bleibt.»
Juristische Infos: Was Familien zusammenhält – der Familienpool
Psychologische Aspekte: Allein als Paar ohne Kinder – Was nun?
11. Erika und Hans: «Ich erkenne meine Frau nicht wieder.»
Gemeinsame Konten und krankheitsbedingter Unterhalt
Psychologische Aspekte: Alkoholismus und Co-Abhängigkeit
12. Beate und Georg: «Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe.»
Was tun bei häuslicher Gewalt?
Psychologische Aspekte: Die Eskalationsspirale der Gewalt
13. Anna und Jakob: «Ich funktionierte, aber die geheimen Sehnsüchte kamen immer wieder.»
Juristische Infos: Wie kann eine Scheidung einvernehmlich gelingen?
Psychologische Aspekte: Der Umgang mit einer neuen sexuellen Orientierung des Partners
14. Maria und Pino: «Scheidung auf Italienisch»
Juristische Infos: Welches nationale Recht gilt bei einer Scheidung in der EU?
Psychologische Aspekte: Integration und die Bindung an die Herkunftsfamilie
Die 10 wichtigsten Tipps für eine konfliktarme Scheidung
Glossar: Juristische Fachbegriffe von A bis Z
Anhang
Beratungsstellen für Frauen, Männer, Paare und Familien
Beispielberechnung für die Übertragung des Miteigentumsanteils an Immobilien
Musterschreiben für die Übernahme der gemeinsamen Mietwohnung
Formulierungsbeispiel für den Unterhaltsverzicht
Musterbeispiel: Zugewinnausgleichsberechnung
DANKE!
Einführung:Scheidung als Neubeginn
Doch noch scheiden oder weiter leiden? ist nicht nur der Titel dieses Buches. Es war auch die alles entscheidende Frage, die mich selbst herausforderte und letztlich zu der Frau machte, die ich heute bin. Als Anwältin, die sich auf Scheidungsrecht spezialisiert hat, glaubte ich, sowohl die Komplexität emotionaler Verstrickungen als auch die rechtlichen Fallstricke von Trennungen zu kennen. Doch als persönlich Betroffene erfuhr ich am eigenen Leib, dass zwischen Theorie und Praxis Welten liegen können. Mein Leben an der Seite eines Mannes, den ich in jungen Jahren geheiratet hatte und mit dem ich gemeinsam ein Kind großzog, war geprägt von einem ständigen Gefühl der Suche: nach mehr eigener Entfaltungsmöglichkeit, aber auch nach mehr Nähe und Geborgenheit. Lange kämpfte ich mit mir selbst, getrieben von der Angst vor der gesellschaftlichen Stigmatisierung, der Sorge um das Wohl unseres Kindes und der tiefen Verunsicherung, ob ich das Recht hatte, nach mehr zu streben. Die Entscheidung, diesen Weg der Unzufriedenheit zu verlassen, war kein plötzlicher Entschluss, sondern ein schmerzhafter Prozess des Erwachens. Es war die Erkenntnis, dass es mutiger ist loszulassen, als sich an Bestehendes zu ketten.
Die Frage, ob eine Ehe geschieden oder fortgesetzt werden sollte, ist eine bedeutende Entscheidung und immer schwierig zu treffen. Schließlich zieht sie komplexe emotionale, soziale und eben auch rechtliche Folgen nach sich. Eine Trennung in jungen Jahren fällt – zumindest allem Anschein nach – leichter als in einem späteren Lebensalter. Lange Zeit konnten junge Betroffene in der Regel auf mehr Verständnis hoffen als Paare, die sich nach Jahrzehnten trennten, womöglich erst nach der Silberhochzeit. Angesichts der gestiegenen Lebenserwartung hat sich die Sicht hierauf jedoch verändert. Eine späte Scheidung ist längst kein Tabu mehr und sie kommt viel häufiger vor, als es sich die meisten Menschen vorstellen können. Die rechtlichen, psychologischen, sozialen oder familiären Zusammenhänge zu erkennen, kann hierfür eine wichtige Entscheidungshilfe darstellen.
Mit professioneller therapeutischer Unterstützung habe ich gelernt, genau diese Zusammenhänge zu erkennen sowie Beziehungsmuster zu verstehen, die geprägt waren von meiner eigenen Familiengeschichte und mich gefangen hielten. Diese oft schmerzhaften Erkenntnisse haben Wunden heilen lassen und mir geholfen, mich selbst besser zu begreifen. Und darauf aufbauend konnte ich auch rechtliche Hürden leichter bewältigen.
Es ist mir damals gelungen, einen Weg zu finden, der für meinen Ex-Partner und mich, vor allem aber für unser Kind, gerecht war und auf gegenseitigem Respekt basierte. Seither gehört es für mich dazu, meine persönlichen Erfahrungen mit meinen Mandantinnen und Mandanten zu teilen. Es war und ist mir wichtig, auf die therapeutische Begleitung hinzuweisen und Verständnis für die Lösung eigener Probleme bzw. Verstrickungen zu wecken. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, die unterschiedlichen Sichtweisen von Männern und Frauen zu sehen und zu verstehen.
Die Entscheidung, (m)eine Scheidung als Neubeginn und nicht als Niederlage zu betrachten, hat es mir ermöglicht, mit Stärke voranzuschreiten. Die Scheidung war nicht das Ende, sondern der Anfang eines neuen Kapitels. Sie öffnete die Tür zu einem Leben, das ich mir selbst gestalten konnte, frei von den Schatten einer Liebe, die erloschen war.
In den Jahren nach meiner Scheidung fand ich nicht nur zu mir selbst, sondern auch mit meinem jetzigen Ehemann zu einer Partnerschaft, mit der das Leben eine unerwartete Wendung nahm. Zusammen mit ihm durfte ich erfahren, was es heißt, auf Augenhöhe geliebt zu werden. Gleichzeitig erzogen wir gemeinsam ein weiteres Kind und standen auch in Krisenzeiten füreinander ein. Heute, viele Jahre später, feiern wir unser 30-jähriges Ehejubiläum in einer lebendigen und erfüllten Ehe: ein Meilenstein, der mir einst unerreichbar schien.
Dieses Buch ist mein persönliches Zeugnis davon, dass es Wege aus der Dunkelheit gibt und dass das Glück oft jenseits der Angst liegt. Es soll Ihnen Mut machen, sich den schwierigen Fragen Ihres Lebens zu stellen und zu erkennen, dass eine Trennung, so schmerzhaft sie auch sein mag, der Schlüssel zu einem erfüllteren Dasein sein kann. Mit der richtigen Unterstützung, emotional wie rechtlich, kann der Prozess einer Scheidung nicht nur zu einer fairen Auflösung führen, sondern auch einen Neuanfang eröffnen, der von Hoffnung und Zuversicht geprägt ist.
In diesem Zusammenhang halte ich auch Beispiele von weiteren Menschen für hilfreich, die diesen Weg bereits gegangen sind und die Scheidung nach langer Ehe nicht gescheut haben. Daher erwartet Sie kein trockener juristischer Ratgeber, stattdessen teile ich in diesem Buch 14 Scheidungsfälle aus meiner langjährigen Praxis als Anwältin mit Ihnen. Natürlich sind all diese Fälle anonymisiert und mit ausgedachten Namen und teilweise auch fiktiven Berufen versehen. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind dennoch nicht zufällig, denn diese «Scheidungsgeschichten» komprimieren typische Umstände später Trennungen und Scheidungen, wie ich sie in über 40 Jahren als Anwältin immer wieder erlebt habe. Dazu zählen das Auseinanderleben im Laufe der Jahre ebenso wie unterschiedliche Vorstellungen für den Lebensabend, schwere Erkrankungen wie Demenz, die späteren Auswirkungen eines großen Altersunterschiedes, eine Krise des gemeinsam aufgebauten Unternehmens, Alkoholismus und Gewalt in der Ehe – um nur eine Auswahl zu nennen.
Anhand dieser lebenspraktischen Beispiele wird es Ihnen leichter fallen, juristische Zusammenhänge zu verstehen, die daran anschließend in Grundzügen erläutert werden, um Sie für besonnenes Handeln in Ihrer persönlichen Situation auszurüsten. Die wichtigsten juristischen Begriffe sind bei ihrer ersten Nennung im Kapitel mit einem Sternchen versehen. Die dazugehörige Erläuterung finden Sie im Glossar am Ende des Buchs. Psychologische Hintergründe verdeutlicht anschließend zu jedem Fall Heinz-Günter Andersch-Sattler. Er ist ein erfahrener Familientherapeut, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite.
Lassen Sie sich von meiner Geschichte und vom Vorbild anderer Menschen inspirieren, um den nötigen Mut zu finden, für Ihr eigenes Glück zu kämpfen. Denn manchmal ist es notwendig, sich von dem zu lösen, was war, um zu entdecken, was sein kann. Doch noch scheiden oder weiter leiden? – das ist mehr als eine Frage – es ist eine Einladung, Ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und mutig den ersten Schritt in Richtung einer hoffnungsvollen Zukunft zu wagen.
Dafür wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute!
Ihre Renate Maltry
Exkurs:Der Wandel von Ehe und Familie von 1900 bis heute
Eine Ehe einzugehen, ist eine sehr persönliche Entscheidung – und sie wieder aufzulösen, erst recht. Dadurch gerät leicht aus dem Blick, dass sowohl gesellschaftliche Normen und Werte als auch familiäre Traditionen und Erwartungen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Wen man heiratet, wie man diese Ehe gestaltet, ob und wie man diese Ehe wieder auflöst – all das entscheiden wir auch in Abhängigkeit von Rollenverständnissen, die wir – oft genug unbewusst – akzeptieren. Und als wenn das nicht reichen würde, hat auch noch der Gesetzgeber ein Wörtchen mitzureden.
Lassen Sie uns daher einen kurzen Ausflug in die Geschichte unternehmen und einen Blick auf die historischen, gesellschaftlichen und juristischen Entwicklungen werfen. Sie sind der Orientierungsrahmen für die Fallgeschichten und ermöglichen nicht nur eine bessere Einordnung, sondern eröffnen auch ein breiteres Verständnis auf allen Ebenen.
Im letzten Jahrhundert hat sich in unserer Gesellschaft viel verändert, besonders in Bezug auf Ehe und Familie. Früher gab es klare Rollenbilder, und die meisten Menschen folgten den traditionellen Vorstellungen ihrer Eltern und Großeltern. Und dazu gehörte es, den Schwur «bis dass der Tod uns scheidet» wörtlich zu nehmen. Heute, nach Jahrzehnten des Wandels, sehen wir hingegen, dass sich immer mehr Paare entscheiden, selbst nach vielen Ehejahren doch noch getrennte Wege zu gehen. Jede Familie, auch die eigene, ist und war eingebettet in geschichtliche und gesellschaftliche Traditionen und Entwicklungen. Wollen wir nachvollziehen, wie und wie sehr die gesellschaftliche Situation von Mann und Frau, von Ehe und Familie sich verändert hat, dann geht das nicht, ohne den Zeitgeist und die Einflüsse zu sehen und zu verstehen, die unsere Eltern und Großeltern geprägt haben. Keine Frage: Das waren noch andere Zeiten. Lassen Sie uns einen Rückblick in diese Zeiten werfen und gemeinsam durch das letzte Jahrhundert reisen.
Früher war die Ehefrau in der Regel dem Ehemann untergeordnet. Frauen hatten insgesamt weniger Rechte und waren sie verheiratet, dann waren sie hauptsächlich für Haushalt und Kinder zuständig. Lange war das ein «ungeschriebenes Gesetz», bis die privaten Beziehungen von Ehegatten im Jahr 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB*) geregelt wurden. Emanzipierte Frauen hatten zwar vehement dagegen protestiert, doch vergeblich. Die traditionelle Rollenverteilung und die damit einhergehende Unterordnung der Frau wurden gesetzlich festgeschrieben. Der Mann hatte nun als Oberhaupt der Familie, als Patriarch, ganz offiziell das Recht, alle Angelegenheiten, die das gemeinschaftliche eheliche Leben betrafen, alleine zu regeln. Er konnte allein über die Wohnung und den Wohnort entscheiden. Es stand ihm zu, das Vermögen der Ehefrau zu verwalten und sich nach Belieben daran zu bedienen. Wollte die Frau arbeiten gehen, durfte sie das nur, wenn ihr Ehemann zustimmte. Doch nicht nur das, er war auch berechtigt, das Arbeitsverhältnis der Ehefrau wieder zu kündigen. Kurzum: Es entstanden völlig absurde Situationen für Frauen. Seit 1900 durften sie ohne Sondergenehmigung studieren – die beiden ersten deutschen Universitäten, zu denen sie vollen Zugang erhielten, waren Heidelberg und Freiburg. Mit der entsprechenden Qualifikation konnten sie dann auch sogenannte Männerberufe ausüben, allerdings letztlich ohne hierüber selbst entscheiden zu dürfen. Hatte sie vor 1900 zum Beispiel in Preußen noch einiges selbst entscheiden können, war eine Frau nun mit ihrer Eheschließung quasi entmündigt. Die Hausfrauenehe und die ans Haus bzw. an den Haushalt gebundene Rolle der Frau war Gesetz.
Dieses Rollenverständnis wurzelte (unter anderem) in der bürgerlichen Kultur des Biedermeiers und stellte im Bürgertum zur Zeit der Jahrhundertwende ein kaum hinterfragtes Ideal dar. Zwar wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Jahr 1919, nach Ende des Ersten Weltkriegs, im Verfassungsrecht der Weimarer Republik verankert, jedoch ohne dass sich die Rolle der Frau im privaten Bereich auch nur ansatzweise geändert hätte. Die alleinige Entscheidungsbefugnis innerhalb der Ehe und der Familie verlieh Männern sehr viel Macht und Stärke. Und das wurde leider häufig missbraucht. Die Ausübung von Gewalt gegen Frauen und Kinder war oft an der Tagesordnung. Selbst schwere Formen von physischer, psychischer und sexueller Gewalt in der Familie wurden von der Gesellschaft wie vom Staat billigend in Kauf genommen. Das Gesetz regelte zwar die «Hausfrauenehe», sah aber «familiale Gewalt» als ein privates Problem an. Gewalt im häuslichen Bereich, also in der Ehe oder der Familie, unterlag daher nicht der Strafverfolgung. Die damaligen Gesetze und Traditionen spiegelten die vorherrschende Gesellschaftsstruktur und die geltenden Werte und Normen wider. Schon damals gab es Widerstand gegen dieses ungleiche Machtgefüge, wenn auch mit wenig Erfolg.
Viele Frauen schlossen sich aus diesem Grund in Vereinen und Verbänden zusammen wie dem Juristischen Damenclub, dem Verein für Fraueninteressen, dem Lehrerinnenverband, dem Deutschen Verband für Frauenstimmrecht, dem jüdischen Frauenbund oder dem Stadtbund Münchner Frauenverbände, der 1914 aus insgesamt 22 verschiedenen Verbänden entstand. Diese Organisationen nutzten eine Vielzahl von Strategien, Lobbyarbeit und Aufklärungskampagnen, bis hin zu öffentlichen Demonstrationen und Zusammenarbeit mit politischen Parteien, um ihre Ziele zu erreichen. Trotz Unterschieden in Strategie und Fokus teilten sie das gemeinsame Ziel, die Position der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern. Durch die Änderung des Reichsvereinsgesetzes vom 15. Mai 1908 durften sie auch politisch orientierte Vereine gründen. Diese «Blütezeit» dauerte aber nicht lange, denn im Anschluss an die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden viele Berufs- und Frauenorganisationen verboten oder aufgelöst. Die Frauenorganisationen passten nicht in das Frauenbild der Nationalsozialisten.
Mit dem Naziregime, das die «Gleichheit des Blutes» verherrlichte, fand die Idealisierung und Glorifizierung der Familie als die natürlichste, unmittelbarste und innigste Gemeinschaft einen neuen Höhepunkt. Nach Auffassung von Adolf Hitler hatte die Welt der Frau sich ausschließlich um die Sorge für die Familie und ihr Heim zu drehen. Die Frauen verloren kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten das passive Wahlrecht und wurden aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Beispielsweise wurden sie nicht mehr als Richterinnen und Rechtsanwältinnen zugelassen. Das Idealbild der Hausfrau und Mutter stand über allem. Im Ehegesetz von 1938 wurde das Zeugen von Kindern als Ziel und Zweck der Ehe festgelegt. Jede gute Ehe sollte mindestens vier Kinder haben, allerdings nur gesunde. Für erbkranke Menschen und Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen galt seit 1933 das Gesetz zur Verhütung, nach dem betroffene Männer und Frauen zwangssterilisiert wurden. Die «Heiligkeit» der Ehe endete bei sogenannten Mischehen, wenn etwa eine Arierin mit einem Juden verheiratet war. Diese Ehen waren nach dem Blutschutzgesetz verboten, das als eines der beiden Nürnberger Gesetze von 1935 auf der nationalsozialistischen «Rassenlehre» gründete. Derselben Logik folgend schrieb das Reichsbürgergesetz fest, dass nur arische Frauen, Männer und Kinder deutsche Staatsangehörige sein konnten.
Dass eine solche Denkweise jemals wieder in politischen Parteien und deren Programmen verankert sein könnte, wie dies erschreckenderweise heute der Fall ist, war nach dem Zweiten Weltkrieg völlig unvorstellbar. Das überhöhte Ideal der heilen Familienwelt erwies sich jedoch als erstaunlich stabil und wirkte unaufhaltsam weiter. In dieser Zeit der Fünfziger- und Sechzigerjahre sind viele aufgewachsen, die heute in langjährigen Ehen leben und mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht nach 25 oder 30 Ehejahren zu trennen. Ihre Erziehung folgte vielfach noch den alten Idealen, was die teils heftigen Gewissenskonflikte erklärt, die sie erleben, wenn sie sich später als Erwachsene im fortgeschrittenen Alter mit einer Trennung oder Scheidung konfrontiert sehen.
Obwohl der Gleichberechtigungsgrundsatz 1949 Eingang in das Grundgesetz der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland fand und das Gleichberechtigungsgesetz 1957 verabschiedet wurde, änderte die Gesellschaft ihre Werteauffassungen nur zögerlich. Inmitten des wirtschaftlichen Aufschwungs kamen die traditionellen Familienbilder dann allmählich ins Wanken. Langsam, aber sicher wurde die Rolle der Frau in der Familie und im Berufsleben neu definiert. Frauen kämpften für ihre Rechte, und nach und nach wurden Gesetze geändert, um eine Gleichberechtigung jenseits des Mindestmaßes zu erreichen.
Von einem Abschied von der Hausfrauenehe war aber noch lange nicht die Rede. Die tief verwurzelte Rollenverteilung innerhalb der Ehe blieb unangetastet. Sie war sogar im Gesetz verankert. Dort war nämlich in § 1356 Abs. 1 BGB geregelt, dass die Frau den Haushalt in eigener Verantwortung führt. Sie sei berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies, so hieß es, mit ihren ehelichen und familiären Pflichten vereinbar war.
In den Siebzigerjahren brachte die Neue Frauenbewegung gesellschaftliche Veränderungen ins Rollen und damit einen Schub in Richtung Gleichberechtigung. Das Scheidungsrecht wurde 1977 reformiert, was Scheidungen erleichterte und das Ideal einer lebenslangen Ehe infrage stellte. Das traditionelle Familienbild begann zu bröckeln, und neue Lebensformen wurden populärer. Dementsprechend stieg die Zahl der Scheidungen rasant an. Standen im Jahre 1900 in Deutschland nur 9152 Scheidungen 476.491 Eheschließungen gegenüber (vgl. Statistisches Bundesamt, www.theologische-links.de, Tabellen, Scheidungen und Eheschließungen in Deutschland), erreichte 1980 die Zahl der Scheidungen die Marke von 141.016 gegenüber 496.603 Eheschließungen; 2003 waren es 213.975 Scheidungen gegenüber 382.911 Eheschließungen (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.4, 2010). Heute haben sich die Zahlen eingependelt. Im Jahr 2022 wurden 390.700 Ehen geschlossen, vor dem Scheidungsrichter sahen sich 137.400 Ehepaare (vgl. Statistisches Bundesamt 2023, Eheschließungen, Ehescheidungen und Lebenspartnerschaften, destatis.de, 08.02.2024).
Erst durch die Reform des Ehe- und Familienrechts von 1977 wurde in § 1356 Abs. 1 BGB gesetzlich geregelt, dass Ehegatten die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen regeln konnten. Seither sind nunmehr beide Ehegatten berechtigt, erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung sind jeweils die Belange des anderen Ehegatten und der Familie zu berücksichtigen.
Dass Frauen einen Beruf ausüben, ist inzwischen völlig normal. Dadurch hat sich auch die Einstellung dazu geändert, dass sie während oder nach der Zeit der Kinderbetreuung arbeiten gehen. So gingen im Mai 2000 rund 63 Prozent der Frauen, deren jüngstes Kind unter 18 Jahre alt war, einer Erwerbstätigkeit nach, wenn auch größtenteils in Teilzeit (vgl. Statistisches Jahrbuch 2001 für die Bundesrepublik Deutschland, Seite 109, digizeitschriften.de). Es ist auf einen Blick zu erkennen: Die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts noch dominierende Hausfrauenehe ist allmählich einer Vorstellung gewichen, die auf die Vereinbarkeit von Ehe und Familie abzielt. Dies wurde in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH vom 13.06.2001, XIIZR 343/99, FamRZ 2001, S. 986) und des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG vom 05.02.2002, 1BvR 105/95, NJW 2002, S. 1185) bestätigt. Dort heißt es: Das frühere Ehebild der weiblichen Haushaltsführung sei inzwischen weitgehend überholt.
Heute geht man bei einer Ehe mit Kindern in der Regel von einer Doppelverdiener-Ehe aus, in der beide Ehegatten sowohl arbeiten als auch die Kinder betreuen, Juristen sprechen dann auch von einer Aneinanderreihung von Ehetypen. Dabei sollte nicht verkannt werden, dass Frauen bis heute vermehrt in Teilzeit arbeiten. Auch fallen sie schnell in «alte» Rollenbilder zurück, wie während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde. Alles in allem ist aber die Veränderung althergebrachter Rollenbilder und ein Wandel deutlich sichtbar.
Auch in Hinblick auf Gewalt in der Familie ist ein Umdenken in Gang gekommen. Als Meilenstein kann in diesem Zusammenhang das Jahr 2002 gelten, als das Gewaltschutzgesetz in Kraft trat. Wurde Gewalt bis dahin nur in Ausnahmefällen tatsächlich verfolgt, erhielten Opfer dadurch endlich Möglichkeiten, ihre Schutzinteressen schneller und effektiver durchzusetzen. Die Gesellschaft und auch der Gesetzgeber verschlossen nicht länger die Augen vor der Gewalt im sozialen Nahraum. 2011 wurde ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt geschlossen, auch als Istanbul-Konvention* bekannt, die zum 01.02.2018 in Deutschland in Kraft trat, wobei sie erst seit 01.02.2023 uneingeschränkt gilt. Bis dahin hatte es seitens der Bundesregierung noch Vorbehalte in einigen Bereichen gegeben. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention wird von GREVIO (eine Expertengruppe des Europarats für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) evaluiert. Hiernach lässt die Umsetzung in einigen Bereichen noch zu wünschen übrig. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat daraufhin in einer Entscheidung vom 10.11.2022 Italien zur Verbesserung vor allem bei Gewalt gegen Frauen in Verbindung mit Kindern und deren Umgang mit dem gewalttätigen Vater nach einer Trennung und Scheidung aufgerufen. Gleiches gilt auch für Deutschland. Was wir brauchen, ist eine effektivere Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen sowie ihren Kindern und insbesondere einen Blick auf die gewaltausübenden (Ex-)Partner und Väter, um der Gewaltspirale entgegenzutreten.
Sie sehen, es ist schon viel erreicht, aber längst noch nicht alles getan: Zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter ist noch viel zu tun. Immer wieder erleben wir auch Rückschritte in der Entwicklung. Nach einer repräsentativen Umfrage der Hilfsorganisation Plan International aus dem Jahr 2023 beispielsweise sorgen traditionelle Rollenbilder bei jungen Männern für eine hohe Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen. 33 Prozent der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren finden es «akzeptabel», wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich «die Hand ausrutscht». Dies macht deutlich, wie stark immer noch oder auch wieder tradierte Rollenbilder vorherrschen, die erschreckend sind und die dringend überwunden werden müssen. Denn Gewalt ist nie ein akzeptables Instrument der Auseinandersetzung – schon gar nicht in Paarbeziehungen und Familien.
Die Reformen im Familienrecht, insbesondere die Reform des Unterhaltsrechts aus dem Jahr 2008, stellen die Eigenverantwortung* der Ehegatten in den Mittelpunkt und spiegeln damit den gesellschaftlichen Wandel und die veränderten Vorstellungen von Ehe und Familie wider. Damit haben wir uns auch einigen europäischen Ländern wie Frankreich oder den Beneluxländern angeglichen, denen unser tradiertes Rollenverständnis grundsätzlich fremd ist. Im europäischen Vergleich war Deutschland bis dahin aufgrund der verfestigten Rollenbilder stets eines der Schlusslichter gewesen.
Die großen Fortschritte der Befreiung von Frauen aus diesen Rollenbildern können aber strukturell bedingt häufig nicht realisiert werden. Es fehlen Kitas und Kindergärten. Soweit ein guter Verdienst oder Vermögen vorhanden ist, können sich Paare Haushaltshilfen leisten. In manchen Fällen springen Eltern ein. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, bestehen die alten Probleme weiter. Inzwischen erkennen die Gesetze in Deutschland nun die Vielfalt der Familienstrukturen an, genauso wie die Bedeutung der Eigenverantwortung nach einer Trennung und Scheidung. Darüber hinaus sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes seit 01.08.2001 möglich. Die Eheschließung ist gleichgeschlechtlichen Partnern seit 01.10.2017 erlaubt.
Familie in Deutschland – das Konzept ist heute sehr viel bunter und vielfältiger geworden. Nichtkonventionelle Lebensformen, wie Regenbogenfamilien oder Patchworkfamilien, erregen immer weniger Aufsehen und gelten als normal. Der Wertewandel und die geänderten Familienstrukturen schaffen völlig neue Freiräume und ein neues Denken über das, was Familie bedeutet.
Nachdem jahrhundertelang strategische Überlegungen darüber entschieden, wer mit wem eine Ehe einging, stehen heute das Heiraten aus Liebe und der Wunsch nach einer erfüllten Beziehung im Vordergrund. Einerseits haben die persönlichen Ansprüche an die emotionale Qualität der Beziehung zugenommen. Andererseits sind nach der «Emotionalisierungsthese» der Familiensoziologin Rosemarie Nave-Herz emotionale Bande eine unsichere Basis für eine dauerhafte Beziehung (vgl. Huinink, Johannes [2009]: Wandel der Familienentwicklung: Ursachen und Folgen). Das tritt offensichtlich zutage, wenn mit zunehmender Beziehungsdauer die romantische Liebe einer nüchterneren Betrachtung des Partners Platz macht und ein tolerantes Verhalten ihm gegenüber abnimmt. In diesem Prozess nehmen Selbstbestimmung und persönliche Verwirklichung einen zunehmend wichtigeren Stellenwert ein.
Die beeindruckende Entwicklung von früheren Einschränkungen zu heutigen Freiräumen zeigt, dass die Traditionen und Rollenbilder unserer Vorfahren uns beeinflussen, dass aber gleichzeitig auch Veränderungen möglich sind. Der Mut, neue Wege zu gehen und sich von überholten Traditionen zu lösen, prägt den heutigen individuellen und gesellschaftlichen Umgang mit der Vorstellung von Ehe und Familie. Die folgenden Fallgeschichten zeugen davon.
1. Klara und Heinz:«Corona? Alles gelogen!»
Seit der COVID-19-Pandemie werden Extrempositionen immer salonfähiger. Fake News nehmen zu und verunsichern. Selbst unter Ehepaaren, die schon lange zusammen sind, entwickeln sich manchmal Weltanschauungen radikal auseinander. Festhalten an der Beziehung nach dem Motto «Es wird schon vorbeigehen» oder doch trennen – das ist dann die Frage. Aus Angst vor den finanziellen Folgen zögern viele und warten, manchmal zu lange. Klarheit über die Vermögenssituation zu gewinnen und damit eine Gesamtlösung zu finden, erleichtert den Schritt für den Weg in das eigene Leben. Ist das Finanzielle geregelt, ist eine Scheidung – fast – nur noch Formsache.
Heinz: Meine Rente hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. Ein Reisender wollte ich sein. Ein großer Traum von mir war, im Alter endlich einmal Goethes Orte zu bereisen. Wobei, was ist schon alt, bin ich das? Nein, ich fühle mich längst noch nicht alt. Auch wenn die Zahl 67 etwas anderes vermuten lässt.
Das Buch Mit Goethe reisen hatte ich verschlungen, kaum, dass es erschienen war. Der Dichter war ein Reisender sein Leben lang: von der Kutschfahrt als Sechzehnjähriger zum Studium nach Leipzig bis zur Abschiedswanderung auf den Kickelhahn mit 82 Jahren. Die Kutschfahrt wollte ich mir zwar sparen. Aber von Goethes vierzigtausend Kilometern zu Fuß oder zu Pferd, mit der Kalesche oder im Kahn wollte ich zumindest einen Teil tatsächlich zu Fuß zurücklegen. «Was der Wanderer wahrnimmt, wird ihm zur Dichtung», heißt es in dem Buch. Und ich wollte sehen, was sich in mir bewegt, was mir zur Dichtung wird, wenn ich Strecken zu Fuß zurücklege. Schon als junger Mensch hatte ich gerne geschrieben. Doch dann ging der Wunsch irgendwann und irgendwie verschütt.
Die Heirat mit Klara, die Kinder, die Versorgerrolle, die ich verantwortungsbewusst einnahm, all das ließ meine Kreativität unmerklich erstarren. Im Mittelpunkt standen nun mein Beruf, meine Karriere und die Kinder. Sie sollten ja alles haben und in ihren Fähigkeiten jederzeit gefördert werden: Gitarre spielen, reiten, Karate – alles, was ihnen einfiel, durften sie ausprobieren. Keine Chance sollte verpasst werden. Und natürlich sollten sie studieren können. Was das anging, waren Klara und ich uns immer einig: nur das Beste für unsere Kinder!
Beim Reisen hatten Klara und ich einen Kompromiss gefunden: Nicht die Wege von Goethe nach Leipzig oder Weimar sollten es sein, sondern unsere eigenen Wege, spannend und einzigartig. Vietnam. Kambodscha. Thailand. Mit dem Rucksack wollten wir unterwegs sein und all diese Länder erkunden.
Und dann saßen wir plötzlich in unserem Haus und gingen nirgendwohin, außer uns gegenseitig aus dem Weg. Die Reisen waren storniert. Eine Umbuchung machte keinen Sinn. Wir wussten nicht, wann und ob wir überhaupt wieder würden reisen können. Die Welt stand kopf. Die Nachrichten waren erschütternd. Zuerst hatte China dichtgemacht. Dann folgten die Todesfälle in Bergamo. Kurz darauf der Lockdown bei uns. Waren damit auch alle Träume, alle Sehnsüchte verflogen?
«Die Abwesenheit macht den Weltneugierigen frei», heißt es in dem Buch über Goethe. Meine Weltneugierde war jedenfalls erstickt, meine Freiheit dahin. Und meine Klara – ich verstand sie nicht mehr. Seit der Pandemie saß sie Tag und Nacht vor dem PC, chattete oder telefonierte stundenlang. Selbst das Essen war nicht mehr wichtig. Sie glaubte an all die wirren Erzählungen aus dem Netz. Sie glaubte nicht an COVID-19 oder das Corona-Virus. Das sei alles nur eine Mär, um uns einzusperren. Die Berichte über Bergamo waren ein Fake. Sich selbst bezeichnete sie als Querdenkerin. «Ich bin nicht so blöd wie du und lasse mich nicht vom Staat verarschen. Die machen doch, was sie wollen, nur um Geld zu verdienen. Und Bill Gates will uns mit der Impfung ja bloß einen Chip einsetzen. Wie blöd bist du eigentlich?», predigte sie mir jeden Morgen. Ich zeigte ihr Traueranzeigen von Menschen, die an COVID-19 gestorben waren. «Quatsch, es wird nur behauptet, dass das die Todesursache ist. Und zwar um uns unserer Freiheit zu berauben.»
Ich versuchte zu diskutieren, doch irgendwann gingen mir die Worte aus. Und je mehr ich diskutierte, umso überheblicher wurde sie. «Du wirst schon noch sehen», sagte sie dann.
Völlig uneinsichtig hatte sie die Wahrheit für sich gepachtet. Ich argumentierte, legte ihr Fakten vor. Doch diesen gesicherten medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen traute sie nicht, stattdessen verließ sie sich lieber auf sogenannte alternative Heilmethoden. Dank Vitamin C, Kurkuma, Ingwerwasser und einer speziellen Ernährungsweise war sie angeblich vor Corona geschützt. Urplötzlich misstraute sie sämtlichen Autoritäten, ohne jede Ausnahme. Expertenmeinungen nahm sie als «Propaganda der Elite» wahr. Für sie war alles Offizielle, egal ob es nun vonseiten der Wissenschaft, der Medien oder der Behörden kam, nur eins: automatisch gelogen. Das war wie ein Selbstläufer: Alles, was von offiziellen Institutionen kam, war ihrer Meinung nach falsch.
Ich war verzweifelt. So ein festgefahrenes Weltbild, diesen Starrsinn – das kannte ich gar nicht von ihr. Und was es noch schlimmer machte: Es gelang mir nicht, das alles zu durchbrechen. Früher war Klara für rationale Argumente zugänglich gewesen. Jetzt aber war sie durch nichts mehr zu überzeugen. Sie hatte sich völlig in der Welt der Verschwörungserzählungen verloren, sie hatte mich und uns verloren. Auch das schien ihr egal zu sein. «Bis dass der Tod euch scheidet», hatten wir uns einmal geschworen. Aber musste ich das aushalten, es tagtäglich ertragen? Es war ein Hin und Her, eine Achterbahn der Gefühle. Jeden Tag schwankte ich zwischen dem Glauben an uns, dem, was einmal gewesen war, und dem, was sich verändert hatte. Gab es ein Zurück, würde sie ihre Meinung jemals wieder ändern? Konnte es vielleicht einen Neuanfang geben?
Sie ging auf Demos, trug keine Maske und war nicht geimpft. Ich wiederum wollte mich nicht anstecken und kommunizierte nur noch per E-Mail mit ihr. Meine Versuche, sie zu überzeugen und von ihrem Weg abzubringen, waren nicht nur frustrierend, sondern auch vergeblich. Dann trat sie mit ihrem Namen, unserem Namen, an die Öffentlichkeit und nutzte dabei die Marke Q, also das Symbol der Gruppierung QAnon mit ihren ganzen Verschwörungstheorien. Offensichtlich hatte sie eine neue Organisation gegründet, die in direkter Verbindung mit unserem Namen stand und daher auch mich mit hineinzog. Damit war bei mir die Grenze des Erträglichen vollends erreicht. Und wenn einmal eine Entscheidung gefallen ist, muss es schnell gehen bei mir.
Ich machte einen Videokonferenz-Termin beim Anwalt und musste mir sagen lassen, dass ich das Trennungsjahr abzuwarten hätte, um mich scheiden lassen zu können. Noch ein Jahr Trennung im gemeinsamen Haus? Nicht zu fassen! Ein Jahr der Beleidigungen und Anfeindungen, weil ich ihre kruden Ansichten nicht teilte? Das war nicht auszuhalten. Ich erklärte ihr die Trennung und zog aus. Postwendend begann sie, um jeden Cent für ihre Organisation, ihre Idee zu kämpfen. Und weil sie Geld brauchte, war sie mit einer umgehenden Einreichung der Scheidung einverstanden. Wir gaben an, dass wir schon eine ganze Weile getrennt in unserem Haus gelebt hatten. Ich schummelte nur ungern, aber ich wollte nur noch weg. Als wir unsere Immobilien bewerten ließen, wurde klar, dass sie an der Wertsteigerung meines Erbes partizipieren würde. Wenn meine Eltern das wüssten, sie würden sich im Grabe umdrehen. Aber ich wollte nur noch frei sein. Währenddessen saß Klara mit einer Freundin zusammen und rechnete, was das Zeug hielt. Ihr Ansinnen war jetzt, möglichst viel aus mir rauszuholen. Aus ehemals Verbündeten waren wir zu erbitterten Gegnern geworden. Schließlich schritten die Kinder ein. Danach wurde sie nachgiebiger, denn die wollte sie nicht auch noch ganz verlieren. Mit Unterstützung der Kinder fanden wir schließlich eine Lösung. Der Zugewinn wurde errechnet und beim Wert des Hauses berücksichtigt. Das Haus behielt sie. Dort wollte ich unter gar keinen Umständen weiter wohnen. Ich wollte und brauchte etwas Neues. Ich sehe es so: Ich habe mich freigekauft und diese Freiheit war es auch, die mich beflügelt hat.
Juristische Infos:Was zu beachten ist, wenn Sie möglichst schnell geschieden werden wollen
Heinz wollte eine möglichst rasche Scheidung. Als er erkannte, dass Klara ihre Lebenseinstellung nicht ändern würde, wollte er nicht weiter leiden. Was das Finanzielle – die Aufteilung des Vermögens und den nachehelichen Unterhalt* – betraf, fanden er und Klara schnell eine Lösung. Denn was Heinz nun am allerwenigsten verlieren wollte, war Zeit. Sein Anwalt klärte ihn auf, dass eine Scheidung davon unabhängig erst nach Ablauf des sogenannten Trennungsjahres* eingereicht werden kann.
Trennung ist nicht gleich Trennung: juristisch betrachtet, hat sie «von Tisch und Bett» zu erfolgen. Am eindeutigsten ist eine Trennung* daher bei Auszug, da in diesem Fall die Meldebescheinigung als Nachweis vorliegt. Sie können sich aber auch in einer Wohnung trennen, wenn Sie getrennte Zimmer beziehen und sich nicht mehr gegenseitig versorgen. Sie ahnen es vermutlich schon: Das ist ein Punkt, bei dem viele Paare es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Beim Scheidungstermin vor Gericht werden beide Ehegatten persönlich und unabhängig voneinander nach dem Trennungszeitpunkt gefragt. Und um die Scheidung zu beschleunigen, geben manche Paare dann einen früheren als den tatsächlichen Trennungszeitpunkt an. So weit, so gut, eine Überprüfung durch das Gericht erfolgt dann nämlich nicht. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Denn wer den Trennungszeitpunkt wahrheitswidrig verkürzt, läuft Gefahr, dass der andere Ehegatte vor Gericht den Schwindel plötzlich aufdeckt und das Scheidungsverfahren sich verkompliziert.
Heinz vermied einen solchen Streit über den Zeitpunkt der Trennung. Stattdessen überzeugte er Klara, dass die Scheidung möglichst schnell erfolgen sollte. Seine Argumente: Geld, den Zugewinnausgleich* und das Haus als Absicherung, denn beides gewährte Heinz ihr erst bei rechtskräftiger Scheidung.
Selbst wenn der Scheidungsantrag eingereicht ist, werden Sie nicht so schnell geschieden. Wer ungeduldig ist – wie beispielsweise Heinz –, muss also vertröstet werden. Durchschnittlich dauert ein Scheidungsverfahren in Deutschland 8 bis 10 Monate: Dies liegt daran, dass zunächst der Versorgungsausgleich* durchgeführt werden muss. Nach Einreichung des Scheidungsverfahrens haben Sie beide dem Gericht in einem Fragebogen Ihre jeweils bestehenden Rentenanwartschaften* mitzuteilen. Danach holt das Gericht entsprechend Ihrer Angaben von den gesetzlichen und privaten Versorgungsträgern die einzelnen Berechnungen für die in der Ehezeit erworbenen Rentenanrechte ein. Wenn alle Auskünfte vorliegen, erstellt das zuständige Familiengericht eine Berechnung, aus der ersichtlich wird, wer von wem welche Rentenanwartschaften übertragen bekommt. Erst dann wird der Scheidungstermin bestimmt und das Gericht lädt dazu ein.
Tipp: Es empfiehlt sich, die offiziellen Rentenberechnungen von einem unabhängigen Rentenberater* oder einer unabhängigen Rentenberaterin* überprüfen zu lassen, da in den Berechnungen durchaus Fehler enthalten sein können.
Nur wenn der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt werden muss und alle finanziellen Angelegenheiten geregelt sind, können Sie die verhältnismäßig lange Dauer eines Scheidungsverfahrens entscheidend abkürzen. Die Scheidung erfolgt dann innerhalb weniger Monate. Zwingende Voraussetzung hierfür ist aber der Verzicht auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs. Dieser muss in einem notariellen Ehevertrag* oder in einer gerichtlich protokollierten Scheidungsfolgenvereinbarung* erklärt werden.
Achtung: Der Verzicht auf die Durchführung des Versorgungsausgleiches unterliegt der Inhaltskontrolle der Gerichte. Das bedeutet: Das Gericht überprüft die Wirksamkeit der Vereinbarung.
Tipp: Ist abzusehen, dass eine Vereinbarung über den Versorgungsausgleich abgeschlossen werden soll, kann man schon zu Beginn des Trennungsjahres bei den Versorgungsträgern die Auskunft zu den Rentenanwartschaften einholen. Sobald diese Auskünfte vorliegen, kann auch schon über einen eventuellen anderweitigen Ausgleich wie etwa die Übertragung von Immobilien oder sonstigen Vermögenswerten verhandelt werden.
Um sein Ziel einer schnellen Scheidung zu erreichen, hat Heinz sich mit Klara im Vorfeld über alles Finanzielle geeinigt. Das war die Voraussetzung für Klaras Zustimmung.





























