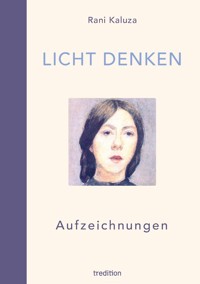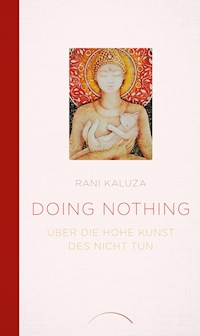
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: J. Kamphausen Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist wie ein scheues Tier. Nur wenn ich still bin und nichts tue, wird es ganz allmählich kommen und sich mir offenbaren. Nicht Tun ist keine Methode, das ist das Schöne daran. Es ist lebendig, es ist das Leben selbst, in seiner einfachsten und schönsten Form. Sich auf einen Stuhl setzen. Absichtslos, den Sinn und Zweck nicht hinterfragen. Nur horchen, sehen, fühlen, spüren, im Innen und im Außen. Sich dem Leben überlassen. Wahrnehmen, nichts verändern, nichts verbessern. So wie es in diesem Moment ist, ist es gut. Rani Kaluza erzählt Erstaunliches über die hohe Kunst des Nicht Tun. So kann Tiefe, Entwicklung, Transformation stattfinden. Einfach leben, einfach sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RANI KALUZA
DOING NOTHING
ÜBER DIE HOHE KUNSTDES NICHT TUN
IMPRESSUM
Rani Kaluza
DOING NOTHING
ÜBER DIE HOHE KUNSTDES NICHT TUN
© jkamphausen in Kamphausen Media GmbH, Bielefeld 2021
1. Auflage 2021
Coverabbildung: Meganne Forbes
Fotos: Rani Kaluza
Illlustrationen: Friedrich Mayer
Lektorat: Ina Kleinod
Buchgestaltung: Kerstin Fiebig [ad department]
ISBN 978-3-95883-535-1
ISBN eBook 978-3-95883-536-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Für diesen
von mir sehr geliebten
Planeten Erde
Das Leben ist ein scheues Tier. Wenn ich darauf zugehe, weicht es zurück und versteckt sich. Wenn ich es auffordere herauszukommen, lässt es sich nicht sehen. Wenn ich versuche es zu überlisten, um es einzufangen, bleibt es verborgen. Selbst wenn ich die allerschönsten Tänze aufführe und Lobreden halte, um es zu beeindrucken, wird es sich nicht zeigen. Nur wenn ich still bin und nichts tue, nichts, um es zu überreden, nichts, um es herzuholen, nichts, um es zu manipulieren, wird es sich ganz allmählich nähern und offenbaren. Es wird mir die Hand reichen, und ich werde in seinen Armen liegen wie ein geliebtes Kind.
INHALT
Einführung
Da sein
Geweihte Zeit
Das Lied des Nicht Tun
Äußeres Nicht Tun
Sitzen – Liegen – Gehen
Inneres Nicht Tun
Schweigen
Denken
Drei Schritte ins Nichts
Schritt 1 – Fühlen
Die Knochen des Nicht Tun
Nicht-Wollen
Nicht-Wissen
Die zehn Finger des Nicht Tun
Lücken
Nichts im Alltag entdecken
Die Kinder des Nicht Tun
Freundlichkeit – Hingabe – Glückseligkeit
Doing Nothing und Tiere
Doing Nothing im Retreat
Praktische Hinweise
Allein in der Wildnis
Das Herz des Nicht Tun
Stille
Der Altar des Nicht Tun
Raum
Drei Schritte ins Nichts
Schritt 2 – Sich öffnen und zeigen
Die Angst von dem Nichts
Ist Doing Nothing Meditation?
Die Früchte des Nicht Tun
Drei Schritte ins Nichts
Schritt 3 – Die Übung aufgeben
Nachwort
Danksagung
Anhang
Über die Autorin
EINFÜHRUNG
»Und dann muss man
ja auch noch Zeit haben,
einfach dazusitzen
und vor sich hinzuschauen.«
Pippi Langstrumpf
Tun und Nicht Tun sind zwei Seiten einer Medaille, könnte man sagen, wie Schlafen und Wachen, Sprechen und Schweigen. Aktives Tun gehört zum Leben ebenso wie passives Nicht Tun. Doch während die Beschäftigungen in unserer Kultur eine anerkannte und vorherrschende Rolle spielen, wird dem absichtslosen Nicht Tun weniger Aufmerksamkeit und Wert beigemessen. Und während die Angebote, aktiv zu sein, immer mannigfaltiger werden und das Absorbiert-Sein in virtuellen Welten den Rest der Zeit beansprucht, wirkt das reine Nicht Tun – verdrängt in den Hintergrund – auf viele Menschen wie ein sublimes Fehlen von etwas, wie eine unerfüllte Sehnsucht nach Stille, nach Zeit, nach Natur.
Ähnlich, wie der Schlaf sich als latente Müdigkeit in den Tag hineinschleicht, wenn er nachts vernachlässigt wird, wirkt das Einfach-da-Sein wie ein unbeachtetes Bedürfnis auf vielerlei Weise, um sich den ihm gebührenden Platz in unserem Leben zurückzuerobern.
Schlafen ist extrem wichtig für das Überleben des Körpes, außerdem findet unsere geistige Essenz, auch Seele genannt, im Tiefschlaf die besondere kosmische Nahrung, die sie braucht. Entzieht man einem Menschen den Schlaf über längere Zeit, wird er irgendwann wahnsinnig und verstirbt dann auch recht bald. Das gilt übrigens für alle Lebewesen dieser Erde. Ohne Schlaf, ohne Phasen tiefer Ruhe und Entspannung würde keines von ihnen überleben. Hunde sterben ohne Schlaf übrigens schon nach etwa vier Tagen.
Auch absichtsloses Da-Sein ist kein überflüssiger Luxus, sondern eine Quelle der Regeneration, der Intelligenz und der Freude. Es ermöglicht uns einzutauchen in den Urgrund des Seins, um danach gestärkt in die Welt der Aktivitäten zurückzukehren. Ein Mensch, der über einen längeren Zeitraum ununterbrochen aktiv ist und sein Bedürfnis nach innerer Ruhe missachtet, stirbt zwar nicht gleich, aber ein wenig seltsam wird er schon und nicht selten auch krank. In einer Zeit des Rastens versorgt uns das Leben mit wichtiger energetischer Nahrung. Ohne dass wir etwas dafür tun oder leisten müssten, verbindet es uns umstandslos mit jener Quelle, aus der alle Wesen, auch alle Pflanzen, selbst die Steine und die Sterne ihre Kraft schöpfen. In dieser beschaulichen, stillen Zeit, die noch nicht einmal sehr lang sein muss, wird unserem Organismus eine Verbundenheit gegeben, die es uns wieder leicht macht, das Leben in seiner Einfachheit zu lieben.
Da zu sein, sich von nichts ablenken zu lassen und direkt in die Langeweile hineinzuschauen, kann befreiend sein. Es ist wunderschön, diese Offenheit zu erfahren, sich zu erlauben, in diesen Moment zu fallen, und sich vertrauensvoll zu überlassen wie eine Wolke dem heiteren Himmel.
In diesem Buch erzähle ich von den Schätzen und Sternen, die es beim Nicht Tun zu entdecken gibt, aber auch von den Schwierigkeiten und Fallen, in die man geraten kann. Ich versuche überdies mit Verweisen auf westliche und östliche spirituelle Schulen zu zeigen, dass das offene Herz puren Da-Seins in allen mystischen Traditionen schlägt, und dass reines Nicht Tun, Doing Nothing – im Alltag, aber insbesondere im Retreat – eine Praxis ist, die es ermöglicht, eine direkte Begegnung mit der universellen Liebe zu erfahren. Mit anderen Worten, es geht mir darum, neugierig zu machen, zu inspirieren und den Lesern zu ermöglichen, eigene Entdeckungen zu machen. Dazu stelle ich meine über 30-jährige Meditationserfahrung zur Verfügung. Und ja, mitunter ist es ein Abenteuer, eine Reise ins Ungewisse. Ähnlich wie es einem Künstler ergeht, der vor einer weißen Leinwand steht und nicht weiß, welches Bild sich in Kürze ereignen wird, ist das Nicht Tun immer auch ein Tanz mit dem offenen Raum.
Darüber hinaus möchte ich mit diesem Buch dazu beitragen, jene innere Unrast besser zu verstehen, die für so viele Probleme in unserem Leben verantwortlich ist. Ich hole dafür das alltägliche Getrieben-Sein aus seinem Schattendasein heraus ans Licht, um es begreifbar zu machen und zu verwandeln. Beleuchtet wird dabei unweigerlich auch die Angst vor dem Leerlauf, die Angst, es könne, aus welchen Gründen auch immer, auf einmal kein Plan mehr da sein – vor Situationen, wenn die Reihe fortlaufender Beschäftigungen abreißt und alles offen ist. Kleine und große Augenblicke, durchaus alltäglich, in denen das namenlose Nichts dasteht wie ein Gespenst und wir oft genug nicht wissen, ob wir diese Einladung annehmen können. Dass es möglich ist, leere Zeiträume wertzuschätzen, und dass sie sogar höchst bezaubernd sein können, davon handelt dieses Buch, vor allem davon.
DA SEIN
Das ganze Unglück der Menschen
rührt allein da her, dass sie nicht
ruhig in einem Zimmer zu bleiben
vermögen.
Blaise Pascal
Als ich mich im Frühjahr 2014 für mehrere Tage dem Nicht Tun widmen wollte, wählte ich dafür ein Bungalow-Hotel in Tunesien, von dem ich wusste, dass es mir den nötigen Schutz und Service bieten würde. Wenngleich intensive Auszeit-Phasen nichts Ungewöhnliches mehr für mich bedeuteten und spirituelle Praxis schon lange zu meinem Leben gehörte – dieses Mal war es neu und anders. Fünf Tage lang wollte ich einfach nur da sein. Keinerlei Beschäftigung sollte mich ablenken, keine Pause mich unterbrechen. Ich wollte nicht sprechen, nicht lesen, keine Fotos machen, keine Musik hören, weder aufs Handy noch ins Internet schauen, aber vor allem wollte ich keinen Plan haben. Völlig ohne Strategie zu sein, auch ohne Meditationsmethode, war neu für mich. Ein Retreat ohne Meditationsplan! Noch vor einem Jahr hätte ich dies als völligen Unsinn abgetan. Doch das reine Nicht Tun, wie ich es nannte, das ich in kurzen Zeitperioden über die vergangenen Monate zu Hause getestet hatte, überzeugte mich inzwischen gleichermaßen wegen seiner Tiefgründigkeit und Einfachheit. Und es faszinierte mich auch, muss ich gestehen. Wie konnte etwas, das so mühelos ist, eine solch transformative Kraft entfalten?
Nun also wollte ich mich für länger darauf einlassen und war nicht einmal sicher, ob das überhaupt möglich sein würde. Kritische Gedanken belasteten die Wochen vor der Abreise. Phasenweise fürchtete ich, ein wenig verrückt zu sein mit meinem Vorhaben. An anderen Tagen befand ich mich in bester Stimmung und stellte mir vor, eine kühne Forscherin zu sein, die sich demnächst auf den Weg zu einem wichtigen Selbst-Experiment begibt. Neugierig, aufgeregt und auf eine berauschende Art unsicher saß ich schließlich im Flugzeug am Fenster und schaute hinaus.
Beim Landeanflug auf Djerba bei wolkenlosem Himmel entdeckte ich unten im Meer einen großen dunklen Fisch, der sich pfeilschnell durchs Wasser bewegte. Ich ließ ihn nicht aus den Augen, wissend, dass es der Schatten des Flugzeugs war und in diesem Sinne auch ein Teil von mir. Je näher wir der Landebahn kamen, desto größer wurde der Schattenfisch im Meer, und als die Räder des Fliegers den Boden berührten, feierte ich das innerlich als glückliche Wiedervereinigung. Die Treue eines Schattens ist doch beispiellos.
Djerba empfing mich mit wehenden Palmen, dem übersinnlichen Glanz tunesischen Lichts und den Motorgeräuschen der Busse, die auf die Touristen warteten, um sie in ihre Hotels zu bringen. Ein paar Stunden später, in der großen Empfangshalle des Hotel Sangho Club, nahm ich meinen Schlüssel entgegen. Doch schon am nächsten Morgen stand ich wieder an der Rezeption, mit der Bitte, mir einen anderen Bungalow zu geben. »Er liegt zu nah an einem Weg. Ich brauche mehr Abgeschiedenheit«, sagte ich. Mit fünf Schlüsseln in der Hand machte ich mich wieder auf den Weg in die weitläufige Gartenanlage, wo Vogelschwärme zwitscherten und Palmen im Wind knatterten.
Es dauerte etwas. Ich brauchte fast den ganzen Tag, bis ich die Bungalows einen nach dem anderen besucht und angefühlt hatte. Am Ende entschied ich mich für ein Haus, das etwas versteckt in der zweiten Reihe zum Strand lag. Von hier aus kann ich nachts das Meer hören, dachte ich.
Mit dem eigentlichen Retreat wollte ich erst am dritten Tag beginnen. Die Tage davor, wie auch eine Zeit danach, sollten die Übergänge bilden. Wie ein Sandwich würde das innere, strengere Retreat von zwei äußeren semi-strengen Phasen geschützt werden. Doch das Vorhaben, noch etwas zu warten, um erst mal anzukommen, wurde nicht verwirklicht. Kaum hatte ich meinen Wunsch-Bungalow bezogen und alles ausgepackt, fing mein Retreat an, ob ich wollte oder nicht. Eine angenehme samtweiche Müdigkeit überkam mich, hüllte – ja, lud mich ein und ließ mein Denken leiser werden. Dieses Gefühl, eine leichte Sedierung verabreicht zu bekommen, die mich entspannen lässt und mich allmählich der Ebene des Seins anvertraut, würde mir in späteren Retreats noch öfter begegnen. Ich nahm die Einladung an.
Wie ein Segelboot, das nach vielen Monaten auf dem Meer schließlich seinen Heimathafen erreicht und am Kai sicher angebunden wird, so fühlte ich mich: endlich von allem Machen und Tun befreit und gleichsam gebunden an das Schweigen und die anderen Regeln. Die Erlaubnis, kurze Notizen zu machen, gehörte dazu, aber auch andere, für Meditation-Retreats eher unübliche Freiheiten, wie nutzlos herumzuliegen, zu dösen und zu schlafen.
Wehmut steigt in mir auf, wenn ich jetzt an den ersten Morgen dieses Doing Nothing Retreats zurückdenke. Viele weitere folgten, doch das erste Mal bleibt wohl immer etwas Besonderes. Ich stellte einen Stuhl vor das Haus in die Sonne und setzte mich. Mit geschlossenen Augen spürte ich in mich hinein. Die Frage lautete: Wie geht es mir? Wie geht es diesem empfindsamen Wesen in diesem Körper in diesem Moment, an diesem Platz. Ganz ehrlich, Rani, wie fühlst du dich? Jede Regung, selbst die unangenehmste Empfindung erhielt die Einladung da zu sein und am Doing Nothing Retreat teilzunehmen. Nichts brauchte modifiziert oder abgewiesen zu werden.
Irgendwann breitete sich ein Gefühl von Ganz-Sein in mir aus, und als ich die Augen schließlich öffnete, nahm ich Kontakt zu meiner Umgebung auf. Die Frage lautete: Wie geht es dir? Dies war – und ist noch immer – meine persönliche Art, mich zu öffnen. Hinauszuschauen und mich gleichsam zu zeigen. Mich den Bäumen anzuvertrauen und den Blumen, den Wolken und der Luft, dem Universum, dem Göttlichen, einfach allem, was mich umgab. Hier bin ich und schaut, so fühle ich mich.
Entspannt, präsent und offen saß ich da. Ab jetzt gab es nichts mehr zu tun – keine Anweisung zu befolgen, keine Übung anzuwenden. Wenn andere Hotelgäste vorbeikamen, konnten sie nicht erkennen, dass ich in einem Retreat war. Ich sah nicht aus wie jemand, der meditierte. Kaum einer nahm Notiz von mir. Tatsächlich würde es in den kommenden Tagen öfter vorkommen, dass Feriengäste des Hotels ganz nah an mir vorübergingen, ohne mich zu sehen, als sei ich vollständig unsichtbar.
Den Vormittag verbrachte ich in der Nähe des Bungalows. Ab und zu schlossen sich meine Augen und ich spürte nach innen, dann wieder öffneten sie sich. Ohne etwas Bestimmtes zu fokussieren, zog ich es meist vor, die Umgebung in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Von Zeit zu Zeit stand ich auf, um etwas zum Trinken zu holen oder um den Stuhl ein wenig zu versetzen. Die Blickrichtung ändern zu können, ist ein schönes Privileg in Doing Nothing Retreats, auch weil man dadurch erfahren kann, wie und auf welche Weise das Betrachtete, Pflanzen und Dinge, auf den Geist und das Gemüt wirken.
Retreat-Notizbuch:Ich bemerkte, was ein Blick in eine bestimmte Richtung mit mir macht, und wandte mich dahin, wo ich Resonanz spürte. Ich probierte verschiedene Richtungen aus und fühlte: Was kommt zu mir, wenn ich in diese Richtung schaue, was, wenn ich in eine andere schaue? Wann ist es leicht, präsent zu sein, und wann merke ich, dass ich mich nach innen zurückziehe? Der Anblick bestimmter Szenarien schien mitunter eine Geschichte zu erzählen, obwohl gar nichts passierte. Eine halb offen stehende Terrassentür mit einem Stuhl davor konnte das sein. Andere Szenarien waren so leer von einer Geschichte, dass sie mich komplett auf mich selbst zurückwarfen. Der Blick aufs offene Meer bis zum Horizont beispielsweise enthielt für mich keine Geschichte, aber vielleicht für andere?
Nach dem Mittagessen im Hotel zog es mich zum Strand hinunter. Der Wind war kalt. Anfang Februar ist auch in Tunesien noch Winter. Ich hockte mich neben einen umgefallenen Sonnenschirm in den Windschatten und blinzelte aufs Meer. Gleißend hell und glatt wie eine Plane lag es da und schien ebenfalls einen Tag Nichtstun eingelegt zu haben. Zwei oder drei Stunden verweilte ich dort und ließ die Weite auf mich wirken. Später, als ich spazieren ging, antwortete mir die Erde bei jedem Schritt mit einem leichten Gegendruck von unten, so schien es zumindest.
Nur mein Verstand konnte dem Ganzen nicht viel abgewinnen. Seit der ersten Stunde sagte er in den verschiedensten Versionen eigentlich immer das Gleiche: »Und was soll ich jetzt machen?« »Einfach nichts«, kam es jedes Mal pragmatisch von mir zurück. Auch wenn es jetzt vielleicht überheblich klingt: Das reine Nicht Tun scheint schlichtweg zu hoch für den Verstand zu sein.
Die Qualität der Wahrnehmungen verfeinerte sich im Laufe dieses ersten Tages mehr und mehr. Farben wurde intensiver, Geräusche lebendiger, ein süßes Gefühl von Kostbarkeit lag in der Luft, wie an ersten Frühlingstagen. Wohin ich auch schaute, was ich auch hörte, es leuchtete, als ob ein Schleier verschwunden wäre. Später am Abend, als ich mich hinlegte und die Augen schloss, nahm ich ein interessantes Raumgefühl wahr: als wäre ich den ganzen Tag in riesigen Hallen und leeren Flughäfen unterwegs gewesen.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit dem Eindruck, jahrelang geschlafen zu haben. Körper und Geist vermittelten mir ein Erholt-Sein, das Seltenheitswert hatte. Ich begann den Tag mit ziellosem Umherwandern. Der schöne Ausdruck im Englischen dafür ist aimless wandering. Dabei verzichtet man bewusst darauf, im Voraus zu wissen, welchen Weg man nehmen will, und überlässt sich der inneren oder höheren Führung mit dem Ergebnis, an Orte und Plätze geleitet zu werden, die mitunter abenteuerlich sind. Während ich also durch den Hotelgarten schlenderte, geschah es, dass ich mich von bestimmten Plätzen angezogen fühlte. Einmal, weil ein zauberhaftes Licht dort ruhte, ein andermal, weil besondere Blumen dort wuchsen. Nicht immer gab es einen sichtbaren Grund, mich irgendwo hingezogen zu fühlen. Einmal gelangte ich zu einer Müllhalde. Eine kleine Ewigkeit lang saß ich auf einem Plastikstuhl vor einem verwaisten Bungalow und schaute auf Hauswände, Sträucher und Blumen, beobachtete Käfer und Ameisen, die ganz im Gegensatz zu mir eifrig ihren Beschäftigungen nachgingen. Ich warf einen Blick auf die französischen Touristen beim Boule-Spielen, verliebte mich in die Schatten der wehenden Palmen und segelte geradewegs ins Nichts. Einfachheit verbreitete sich wie ein erdiger Duft.
Irgendwann jedoch veränderte sich die Atmosphäre, wie das Wetter, wenn auf einmal Wolken aufziehen und das schwindende Licht den Himmel langsam verdüstert. Die klare Qualität meiner Sinneseindrücke nahm allmählich ab. Als hätte sich eine Wand aus Glas zwischen die lebendige Wirklichkeit und mich geschoben, fühlte ich mich getrennt und leicht benommen. Bei einem kleinen Spaziergang, vorbei an Touristen, die im Liegestuhl lagen, murrte es in mir: Die dürfen lesen und ich nicht. Frust und Langeweile begleiteten mich auch noch den Rest des Tages. Nur ab und zu, ohne erkennbare Ursache, stellte sich die zauberhafte Verbundenheit wieder her: Ein Vogel, der ganz nah über mir flog, als wollte er mir etwas sagen. Eine Sammlung alter Fischernetze, die grundlos mein Herz berührten. Eine alte Tunesierin, die mir zulächelte, als wüsste sie alles über mich. Die meiste Zeit aber nahm ich die Welt wie durch einen Nebel wahr. Mit anderen Worten, ich schien ›dichtgemacht‹ zu haben.
Später am Abend, als ich in den Spiegel schauen wollte, erwartete ich gemäß meiner Selbstwahrnehmung, eine zutiefst frustrierte Rani zu erblicken. Doch was ich sah, überraschte und berührte mich zugleich. Sterne. Ich konnte das Universum in meinen Augen sehen und einen Ausdruck von Stärke in meinem Gesicht, den ich so noch nicht kannte. Zugegeben, das wirkte paradox: schön und zugleich verwirrend. Und es machte mich nachdenklich. Hatten meine früheren buddhistischen Lehrer nicht gelegentlich darauf hingewiesen, dass Weisheit und Verwirrung zugleich auftauchen? Ich schöpfte neuen Mut.
Als ich am Morgen des dritten Retreat-Tages aufwachte, wusste ich genau, was ich tun wollte, nämlich nichts. Alles andere erschien mir auch schon fast zu anstrengend. Reglos, wie ein Modell, das für einen imaginären Maler Porträt sitzt, verbrachte ich viele Stunden auf der schilfüberdachten Terrasse am Strand, die ich bereits sehr liebte. Die Zeit verging, ab und zu spürte ich in mich hinein. Gefühle der Unsicherheit fand ich dort, inmitten eines weiten Raums. Neben friedlichen Phasen gab es immer wieder Zustände, in denen die bevorstehenden Stunden sich dramatisch vor mir auftürmten wie unsichtbare Gebirge, die zu überwinden sehr schwierig schien. »Kann ich so viel leere Zeit überhaupt bewältigen?«, fragte mein Verstand und suchte emsig nach Strategien, das Unfassbare zu managen.
Unterdessen ging ich am Strand entlang. Die Sonne lachte mir in die Augen, der kühle Wind berührte sanft meine Wangen, Traurigkeit stieg in mir auf. Irgendwann setzte ich mich auf einen Felsen und betrachtete die Wellen, die, genauso sinnentleert wie ich, so schien es, ans Ufer schlappten. Da nahm ich auf einmal einen Wink wahr, wie einen unendlich fernen Ruf! Ich folgte diesem Wink, stand wieder auf und ließ mich an anderer Stelle nieder. Kurz darauf bemerkte ich, dass sich etwas verändert hatte. Die Wellen, die mir soeben noch fad erschienen waren, glänzten geheimnisvoll im milden Licht. Die trockenen Algen am Ufer sahen aus wie Berge silberner Tonbänder. Freude kehrte zurück, Leichtigkeit umwehte mein Herz.