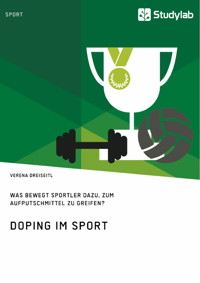
Doping im Sport. Was bewegt Sportler dazu, zum Aufputschmittel zu greifen? E-Book
Verena Dreiseitl
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Doping im Sport stellt einen komplexen Forschungsgegenstand dar. Als Problem hinter diesem Phänomen kann vor allem ein psychosozialer Kontext genannt werden, welcher im Dopinggeschehen der letzten Jahre weitgehend unbeachtet geblieben ist. Als zukünftiges Forschungsziel sollte somit die Untersuchung der multidimensionalen Problematik des Dopings und dopingäquivalenten Verhaltens gelten, wodurch eine adäquate Anti-Doping-Politik gewährleistet werden kann. Dieses Buch fasst zunächst die aktuelle Literatur zusammen und bietet eine Übersicht über die derzeitigen Forschungsgegenstände in der Dopingforschung. Zudem wird der bewertende Stand der Forschung kritisch hinterfragt und beurteilt, wodurch ein Beitrag für ein umfassenderes Verständnis der Anti-Doping-Prävention geleistet wird. Daraus kann geschlossen werden, dass die Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Erfolge verzeichnen konnte, zugleich jedoch noch in den Kinderschuhen steckt. Obwohl bereits validierte Forschungsmethoden existieren, müssen diese noch weiter ausgebaut werden, um die Problematik des multidimensionalen Netzwerks des Dopings weitgehend zu verstehen und Anti-Doping-Programme zielgerechter einsetzen zu können. Aus dem Inhalt: - Doping im Sport; - Doping-Prävention; - Doping-Motive; - Doping-Einstellung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Vorwort
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
1.3 Methodik
2 Grundlagen zum Doping
2.1 Der Doping Begriff
2.2 Die Entwicklung der Dopingdefinition
2.3 Die aktuelle Definition des Dopings
2.4 Die Kritik an der aktuellen Definition des Dopings
2.4.1 Rechtssicherheitsproblematik
2.4.2 Analyse- und Nachweisproblematik
2.4.3 Grenzwertproblematik
2.4.4 Sportsgeistproblematik
2.4.5 Erweiterung des Dopingbegriffes
2.4.6 Schlussfolgerung
3 Die Frage nach dem „Warum?“
3.1 Die motivationalen Aspekte des Dopings
3.1.1 Doping als (logische) Konsequenz des Sports
3.1.2 Doping als Reaktion auf den Dopingeinsatz von Mitbewerbern
3.1.3 Die geringe Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden
3.1.4 Das Netzwerk rund um die Athleten
3.1.5 Der Einstieg über Nahrungsergänzungsmittel und das Wissen über Doping
3.1.6 Kontextfaktoren – Der Einfluss der Sportkultur
3.1.7 Multivariate Modelle des Dopings
3.2 Die methodische Problematik der Wissenschaft
3.2.1 Die Entwicklung der psychosozialen Dopingforschung
3.2.2 Aktuelle Forschungsschwerpunkte und vorgeschlagene Richtungsänderungen
3.2.3 Prospektive Analysen und der Einbezug von anderen Untersuchungsfeldern in das Dopinggeschehen
3.2.4 Das Prävalenzphänomen
3.3 Der Ausblick in die Zukunft der Dopingprävention
3.3.1 Die Dopingbefürworter und die lukrative Dopingmaschinerie
3.3.2 Fehlender Glaube der Gesellschaft an die Anti-Doping-Programme
3.3.3 Gescheiterte Abschreckungsmanöver
3.3.4 Die empirische Basis für die Dopingprävention
3.3.5 Zielsetzungen
4 Zusammenfassung und Schlusswort
5 Literaturverzeichnis
5.1 Literaturquellen
Abstract
Doping im Sport stellt einen komplexen Forschungsgegenstand dar. Als Problem hinter diesem Phänomen kann vor allem ein psychosozialer Kontext genannt werden, welcher im Dopinggeschehen der letzten Jahre weitgehend unbeachtet geblieben ist. Als zukünftiges Forschungsziel sollte somit die Untersuchung der multidimensionalen Problematik des Dopings und dopingäquivalenten Verhaltens gelten, wodurch eine adäquate Anti-Doping-Politik gewährleistet werden kann.
Methode: Mit Hilfe von empirischer Untersuchung wurde die aktuelle Literatur zusammengefasst und eine Übersicht über die derzeitigen Forschungsgegenstände in der Dopingforschung aufgezeigt. Weiters wurde der bewertende Stand der Forschung kritisch hinterfragt und beurteilt, wodurch ein Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von der Anti-Doping-Prävention geleistet werden konnte.
Ergebnis: Die derzeitige Forschung konnte in den letzten 2 Jahrzehnten zunehmend Erfolge verzeichnen, steckt zugleich aber noch in den Kinderschuhen. Obwohl bereits validierte Forschungsmethoden existieren, müssen diese noch weiter ausgebaut werden, um die Problematik des multidimensionalen Netzwerks des Dopings weitgehend verstehen zu und Anti-Doping-Programme zielgerechter einsetzen zu können.
Vorwort
An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich tatkräftig während der Fertigstellung der vorliegenden Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.
Dazu gebührt mein Dank vor allem Dr. Ronald Newerkla, der meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Durch seine hilfreiche und konstruktive Kritik konnte die Arbeit erst in diesem Maße angefertigt werden.
Meiner besten Freundin Tanja danke ich besonders für den starken Rückhalt während des Verfassens. Ebenso gilt mein Dank meiner lieben Freundin Viktoria für das Korrekturlesen.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Juristische und moralische Einordnung des Dopings im Leistungssport (Quelle: Gabriel, 2013)
Abbildung 2: Gründe für das Nicht-Dopen (Quelle: Overbye et al., 2013)
Abbildung 3: Gründe für das Ausprobieren von Dopingmitteln (Quelle: Overbye et al., 2013)
Abbildung 4: Ursachen für das Fehlverhalten (Quelle: Breuer und Hallmann, 2013)
Abbildung 5: Das Gefangenen-Dilemma nach Tangen und Breivik (2001)
Abbildung 6: Einteilung der Nutzer und Wissen über andere Dopingnutzung (Quelle: Dunn et al., 2012)
Abbildung 7: Einschätzungen der Athleten über die Dopingprävalenz (Quelle: Dunn et al., 2012)
Abbildung 8: Meinungen über Dopingtests und Strafen (Quelle: Dunn et al., 2010)
Abbildung 9: Charakteristiken und Erfahrungen mit Dopingtestungen (Quelle: Overbye et al., 2014)
Abbildung 10: Meinungen zu verschiedenen Typen von Sanktionen (Quelle: Overbye et al., 2014)
Abbildung 11: Wirkung von Druckverhältnisse auf Einstellungen zum Doping (Quelle: Madigan et al., 2016).
Abbildung 12: Einstellungen zur Einnahme von NEM (Quelle: Dascombe et al., 2010)
Abbildung 13: Einflussfaktoren von Doping (Quelle: Petroczi und Aidman, 2008)
Abbildung 14: Das Life-Cycle-Model (Quelle: Petróczi und Aidman, 2008)
Abbildung 15: SDCM-Model (Quelle: Gucciardi et al., 2011)
Abbildung 16: Items des PEAS (Quelle: Petróczi und Aidman, 2009)
Abbildung 17: Szenarien von Dopingnutzern und sauberen Athleten (Quelle: Petróczi et al., 2015)
Abbildung 18: Dopinganalysen im Laufe der Zeit (Quelle: Catlin et al., 2008)
Abbildung 19: Ergebnisse der Dopingtests von 2011-2015 (Quelle: WADA, 2015b)
Abbildung 20: Vergleich von SQ und RRT (Striegel et al., 2010)
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Entwicklung des Sports ist in den letzten Jahrzehnten nicht zu übersehen. Vor allem die Entfaltung einer mannigfachen Sportkultur hat sich über eine lange Zeitachse herausgebildet. Solches Wachstum bringt aber nicht nur positive Eigenschaften mit sich. Hier vor allem zu erwähnen ist die Dopingproblematik, welche besonders hervorsticht und eine ebenso große, parallele Entwicklungsgeschichte hinter sich hat.
Gibt man den bloßen Suchbegriff „Doping“ in der Google Suchmaschine ein, so liefert dies aktuell 41,2 Millionen Ergebnisse binnen einer Suchzeit von 0,71 Sekunden. Wird der Suchbegriff um „Doping im Sport“ erweitert, erscheinen immer noch 28,6 Millionen Treffer in 0,54 Sekunden (Stand: 2.2.2017). Allein die hohe Anzahl an Internetauftritten zeigt die immense Bedeutung des Dopings (im Sport), welche sich in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verstärkt hat (Google-Suche, 2017).
Dopingfälle spielen sich heutzutage, wie viele vermuten, nicht nur im Sporthochleistungsmilieu ab, sondern treten auch bei Hobby- und Breitensportlern in hohem Maße auf (Henning und Dimeo, 2015). Selbst im Behindertensport wird die Einnahme von pharmakologischen Substanzen und Anwendung von illegalen Methoden im Sport immer häufiger verzeichnet (Thevis et al., 2009). Es zieht sich infolgedessen durch alle Personenschichten, Sportarten von A bis Z und somit über den gesamten Globus. Der olympische Grundgedanke „Dabei sein ist alles“ scheint immer mehr an Gültigkeit zu verlieren und wird durch „schneller, höher, weiter“ ersetzt – mit allen (illegalen) notwendigen Mitteln versteht sich.
Demzufolge ist es nicht verwunderlich, dass die allgemeine Bevölkerung dem aktuellen Doping-Management der internationalen Verbände aufgrund der ständig auftreten Doping-Fälle wenig Vertrauen schenkt (Wagner und Pedersen, 2014). Eine Studie des Bundesinstituts für Sportwissenschaft in Deutschland aus dem Jahr 2013 konnte feststellen, dass 29% der deutschen Spitzensportler regelmäßig zu Dopingmittel greifen (Breuer und Hallmann, 2013). Hohe Summen an Geldbeträgen werden jährlich ausgegeben, um Maßnahmen zur Vermeidung von Doping zu ermitteln und diese auch umzusetzen. Um das Vertrauen der Bevölkerung, aber auch der Athleten in Zukunft erhöhen zu können, ist die Identifizierung von Prozessen, welche zum Dopingverhalten führen, ein wichtiger Faktor. Präventionsstrategien, die auf wissenschaftlichen Beweisen beruhen sollten, können somit zur Reduzierung des Vertrauensmangels beitragen.
Dabei auch erwähnt werden sollte die Rolle des Sports bezogen auf die wachsende Leistungsgesellschaft. Schimank beschreibt Sport als gesellschaftlichen Teilbereich, der die Prinzipien der Leistungsgesellschaft in idealer Weise zum Ausdruck bringt (Schimank, 2005). Demgemäß kann man den steigenden Druck hinsichtlich des Leistungsgedankens durchaus auf den Sport übertragen und als „Ausschlachtung des Sports“ bewerten. Die Basis dafür wird in der allgemeinen Doping-Mentalität der Gesellschaft gebildet, wo es mittlerweile normal zu sein scheint, Substanzen einzunehmen, um die Alltag besser und leistungsfähiger überstehen zu können. Während in der Forschung dabei von „Gehirn-Doping und „Neuro-Enhancement“ gesprochen wird, werden die Mittel der Pharmaindustrie zumeist als positiv mit „Brain- Booster“ oder „IQ-Doping“ vermarktet und als einfache Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht, was die Hemmschwelle für die Einnahme von tatsächlich unerlaubten Substanzen gegebenenfalls fördern könnte. Somit fordert das aus der Leistungsgesellschaft abstammende Publikum deshalb weitere Zeitrekorde, atemberaubende Höhen und unmenschliche Leistungen, die neue Dimensionen des Sports eröffnen sollen. Dass der menschliche Körper aber irgendwann keine Leistung mehr erbringen kann, wird dabei nur selten bedacht.
So stellt Doping ein bekanntes Phänomen dar, welches bis dato vor allem aus biomedizinischer Sicht untersucht wurde, obwohl psychosoziale Ansätze als Schlüsselfaktoren für den Kampf gegen Doping einzuordnen sind (Morente-Sánchez und Zabala, 2013). Obwohl die Forschung aktuell noch begrenzt ist, wird infolgedessen ein großes Augenmerk der aktuellen Untersuchungen auf die Einstellungen der Athleten zum Doping-Verhalten gelegt und die individuellen und sozialen Mechanismen durchleuchtet, die Sportler anfälliger und toleranter gegenüber Doping-Verhalten machen (Bloodworth und McNamee, 2010). Dass hier noch hoher Bedarf besteht, demonstrieren die gegenwärtig aktuellen Meta-Analysen (Blank et al., 2016; Morente-Sánchez und Zabala, 2013; Ntoumanis et al., 2014).
Gelingt es der Forschung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Bereitstellung von nützlichen Informationen und Hintergrundwissen hinsichtlich des psychosozialen Problems des Dopings darzustellen, kann somit eine Beschleunigung der Entwicklung von zukünftigen Präventionsstrategien erzielt werden.
1.2 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
Abseits der gegenwärtigen Zahlen und Fakten zum Dopingmissbrauch stellt sich die Frage, warum unsere Gesellschaft im Sportbereich so ein enormes Wachstum an Dopingfällen zu verzeichnen hat.
Während man am Beginn der Entstehung der Dopingproblematik rein den Grad zwischen Dopingverbot und Anti-Doping-Arbeit fokussiert hat, haben sich folgend auch verschiedene Wissenschaften sowohl im positiven als auch im negativen Sinne der Charakterisierung dieses Phänomens des Dopings sowie dopingäquivalentem Verhalten gewidmet. So zielt die Forschung in den letzten Jahren nicht nur mehr auf die medizinische, biochemische und analytische Wissensaneignung ab, sondern legt den Fokus vermehrt auf psychologische, pädagogische, sportethische und soziologische Ansätze.
Daraus entstanden stellen sich Forschung und Wissenschaft immer mehr die Frage nach dem „Warum“ in der Dopingproblematik. Warum greifen Personen zu illegalen Substanzen? Welche Faktoren spielen eine konkrete Rolle beim Konsum von Dopingmitteln? Gehen die aktuellen Präventionsmaßnahmen in eine Richtung, die den aktuellen Forschungsstand der motivationalen Aspekte inkludiert? Diese Fragen und mehr sollen in der vorgelegten Arbeit beantwortet werden.
Ziel ist es dahingehend am Beginn der Arbeit, einen zugänglichen Überblick über die Dopingproblematik und dessen Hindernisse, vor allem auf die Schwierigkeit der Dopingdefinition, darzustellen. Anschließend wird auf die Thematik des sportsoziologischen und sportpsychologischen Hintergrunds des Dopings eingegangen. Mit Hilfe von empirischer Untersuchung wird die aktuelle Literatur zusammengefasst und eine Übersicht über die derzeitigen Forschungsgegenstände in der Dopingforschung aufgezeigt. Weiters soll der bewertende Stand der Forschung kritisch hinterfragt und beurteilt werden, wodurch ein Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von der Anti-Doping-Prävention geleistet werden soll. Gegenstand der Untersuchungen und Literaturrecherchen stellt sowohl der Leistungssport als auch der Freizeit- und Breitensport dar.
1.3 Methodik
Um die Grundlagen und den derzeitigen Wissensstand bezüglich Doping-Verhalten im Sport darzustellen, wurde vorwiegend in wissenschaftlichen Datenbanken wie „Pubmed“ oder „Sciene Direct“ recherchiert. Dafür wurden zum Beispiel Begriffe wie „doping“, „doping in sports“ und „doping behavior“, „performance enhancing drugs“ in Kombination mit „attitudes“, „beliefs“, „predictors“, „prevention“ und „intentions“ in die Suchfunktion der jeweiligen Datenbank eingegeben. Weiters wurde Literatur in gegenwärtigen Büchern herangezogen.
Anhand zahlreicher Überblicksarbeiten konnten durch deren Literaturverzeichnisse weitere Veröffentlichungen zum Thema dieser Masterthesis gefunden werden. Somit führten die am Anfang analysierten Reviews im Verlauf der Recherche zu genaueren Untersuchungen spezifischer Themenbereiche.
2Grundlagen zum Doping
2.1 Der Doping Begriff
Um sich einen Überblick über die Thematik des Dopingproblems verschaffen zu können, ist es wichtig, die Grundlagen des Dopings vorab zu verstehen. Auch wenn der Begriff „Doping“ für jedermann verständlich ist, so treten bei genaueren Definitionen auch in der Wissenschaft immer wieder große Unterschiede auf.
Die Benützung von Dopingmitteln trat bereits in der vorchristlichen Zeit auf, wobei Überlieferungen existieren, dass Stierhoden bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. als Leistungssteigerungsmittel eingesetzt wurden (Gutheil, 1996).
Der Ursprung des Begriffes unterliegt der Erklärung des Wortes „Dop“ als selbstgebrannten, schweren Schnaps, bestehend aus Weintraubenschalen und Cola- Bestandteile, der Bantu-Sprache der Ureinwohner von Südostafrika, welcher als Stimulanzium für religiöse Zeremonien diente. Niederländische Einwanderer sollen „Dop“ später in ihre eigene Sprache Afrikaans aufgenommen haben, wobei der Begriff bis heute von den Buren als generelle Bezeichnung für Getränke mit stimulierender Wirkung steht und somit auch in Europa verbreitet wurde (Lünsch, 1991).
Darüber hinaus beschreibt ein weiterer Ansatz die Abstammung des Wortes direkt aus dem Niederländischen, wo „doppen“ als „tauchen“ oder „tunken“ übersetzt und „doop“ als dickflüssige Mixtur beschrieben wird. Durch niederländische Einwanderer nach Amerika wurde „doop“ verwendet, um die Bauarbeiter für die Siedlung Niew Amsterdam (New York) mit Ausdauer und Kraft auszustatten (Nickel und Rous, 2007).
Der erste niedergeschriebene Eintrag als allumfassendes Wort „Doping“ lässt sich 1889 in einem englischen Wörterbuch nachweisen. Doping wurde dabei als Mischung von Opium und Narkotika beschrieben, welche vor allem an Pferde bei Rennen verabreicht wurde (Lünsch, 1991). Weitere Einträge in unterschiedlichen Lexika bestätigten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass der Begriff in den allgemeinen Sprachgebrauch um die Erweiterung auf weitere Substanzen als Dopingmittel übernommen wurde (Spitzer, 2011a, S. 53).
2.2 Die Entwicklung der Dopingdefinition
David Müller, Leiter für Information und Prävention bei der Nationalen Anti-Doping- Agentur Austria GmbH (NADA Austria), beschreibt die Evolution der Dopingdefinition als Grad zwischen „der starken Beeinflussung von den jeweils dominanten Argumentationsweisen für ein Dopingverbot (Fairness, Gesundheit, etc.)“ und der „neuen Entwicklung in der Anti-Doping-Arbeit“, wodurch „ein Dopingverbot immer als notwendige und hinreichend Bedingung eine passende Dopingdefinition mit sich trug“ (Müller, 2015, S. 15). Auch Pawlenka sieht die Schwierigkeit der Dopingdefinition folgendermaßen: „Doping wird nicht wertfrei definiert, sondern tritt immer nur als präskriptiver Begriff bzw. als Verbotsdefinition in Erscheinung.“ (Pawlenka, 2010, S. 146).
Während sich die Anti-Doping-Arbeit ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vermehrt entwickelte, wurden die Definitionen von Doping im Laufe der Jahre ständig weiter ausgebaut, verändert und angepasst. Über Statements des „deutschen Ärztebundes“ (1927, 1952), der IAAF (= International Association of Athletics Federations)-Definition von 1928, „Beckmanns Sport-Lexikon 1933“ bis hin zur Definition von Doping des Europarates 1963 gelang es 1967 dem IOC nach der Gründung einer medizinischen Kommission eine Verbotsliste zu erstellen, welche als erste Basisliste für verbotene Substanzen für die olympischen Sommer- und Winterspiele 1968 für mehrere Sportarten dienen sollte (Müller, 2015, S. 29).
Diese Verbotsliste wurde in den Folgejahren kontinuierlich weitergeführt, sodass die ebenfalls steigernde Entwicklung von Dopingsubstanzen eingedämmt werden konnte. Vor allem aber das Übereinkommen des Europarates 1989 ging als besondere Bedeutung für die Evolution des Dopingbegriffes in die Geschichte ein. So stellte die Präambel nicht nur eine Weiterführung der Listen-Politik des IOC dar, sondern machte ebenso auf den hohen Stellenwert des Sports für die Erhaltung der Gesundheit, die geistige und körperliche Erziehung und die Förderung der internationalen Verständigung aufmerksam. Mit den Vorgaben des IOC an alle zugehörigen Sportverbänden, die Bestimmungen des Europarates und der UNESCO, welche 2005 eine Konvektion zur Harmonisierung in den Mitgliedstaaten erwirkte, wurde das Basisdokument für eine allgemein gültige, internationale Dopingdefinition erschaffen (Müller, 2015, S. 27f).
Einen kurzen Einblick über die Entwicklung der Verbotslisten gibt die Auflistung der Weiterentwicklung der NADA (Nationale Anti-Doping Agentur Österreich). Die erste Liste enthielt dabei nur Stimulanzien und Narkotika. Eine Weiterentwicklung erfolgte in den nachstehenden Jahren (NADA, 2017):
1974: Aufnahme von Synthetischen Anabolika
1984: Aufnahme von Testosteron und Koffein (seit 2004 nicht mehr auf der Liste)
1988: Aufnahme von Blutdoping, Diuretika und Beta-Blocker
1989: Aufnahme von Peptidhormonen (EPO)
1993: Aufnahme von Beta-2-Agonisten
1999 wurde schlussendlich die Verantwortung des IOC auf die neu gegründete Welt- Anti-Doping-Organisation (WADA) übergeben, womit erstmalig am 1.Jänner 2004 für alle Unterzeichner des Welt-Anti-Doping-Codes (WADC) die jährlich neu aktualisierte Verbotsliste der WADA als internationaler Standard und Teil des Welt-Anti-Doping- Programms galt (Müller, 2015, S.33).
2.3 Die aktuelle Definition des Dopings
Der Welt-Anti-Doping-Code definiert folgende Verstöße gegen die Anti-Doping Bestimmungen (WADA, 2015a):
1. Vorhandensein eines verbotenen Stoffs, seiner Metaboliten oder Marker in der Probe eines Athleten
2. (Versuchte) Anwendung eines verbotenen Stoffs oder einer verbotenen Methode seitens eines Athleten
3. Umgehung der Probenahme bzw. Weigerung oder Versäumnis, eine Probe abzugeben
4. Meldepflichtverstöße
5. (Versuchte) unzulässige Einflussnahme auf einen Teil des Doping-Kontroll- Verfahrens
6. Besitz einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode
7. Das (versuchte) Inverkehrbringen von verbotenen Substanzen oder verbotenen Methoden
8. Die (versuchte) Verabreichung von verbotenen Stoffen oder verbotenen Methoden bei Athleten bei Wettkämpfen oder die (versuchte) Verabreichung von Stoffen oder Methoden, die außerhalb von Wettkämpfen verboten sind, bei Athleten außerhalb von Wettkämpfen
9. Beihilfe (z.B.: Anleitung, Verschleierung, Anstiftung, Ermutigung, Hilfe)
10. Verbotener Umgang mit einer gesperrten Betreuungsperson
Die derzeit gültige Dopingdefinition, basierend auf dem WADC, lautet somit wie folgt:
„Doping wird definiert als das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend in Artikel 2.1 bis 2.10 festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen." (WADA, 2015a)
Als kurzer Überblick der verbotenen Substanzen eingeteilt in Substanzklassen, dient nachstehende Auflistung. Eine detaillierte Erklärung sowie die Wirkungsweisen und Nebenwirkungen können, jährlich aktualisiert, auf der Website der WADA (WADA, 2017) nachgelesen werden.
Substanzen und Methoden, die jederzeit (in und außerhalb von Wettkämpfen) verboten sind:
S0. Nicht zugelassene Substanzen
S1. Anabole Substanzen
S2. Peptidhormone, Wachstumsfaktoren, verwandte Substanzen und Mimetika
S3. Beta-2-Agonisten
S4. Hormone und Stoffwechsel-Modulatoren
S5. Diuretika und Maskierungsmittel
M1. Erhöhung des Sauerstofftransfers
M2. Chemische und physikalische Manipulation
M3. Gendoping
Substanzen, die im Wettkampf verboten sind:
S6. Stimulanzien
S7. Narkotika
S8. Cannabinoide
S9. Glukokortikoide
Substanzen, die nur bei bestimmten Sportarten verboten sind:
P1. Alkohol
P2. Beta-Blocker
2.4 Die Kritik an der aktuellen Definition des Dopings
2.4.1 Rechtssicherheitsproblematik
Die aktuelle, rechtsgültige WADA-Definition ist nach wie vor großer Kritik ausgesetzt. So blicken die verschiedenen Sportverbände auf eine lange Entstehungsgeschichte zurück. Im Wandel der Zeit wurde auch ein Wandel der Richtung hingehend der Definition beobachtet: Während vor den 60er Jahren noch mit ethisch-abstrakten Begriffen versucht wurde, den Dopingbegriff klar darzustellen (deutscher Sportbund 1952: „Die Einnahme eines jeden Medikaments – ob es wirksam ist oder nicht – mit der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist als Doping zu bezeichnen.“) (Spitzer, 2011a, S. 57), strebte man mit der Entwicklung des Medical Codes des IOC eine Verrechtlichung der Definition an („Doping besteht aus: 1. der Verwendung von Substanzen aus den verbotenen pharmakologischen Wirkstoffgruppen und/oder 2. der Anwendung verbotener Methoden.“).
Tanja Haug beschreibt in ihrem Buch „Doping. Dilemma des Leistungssports“ diese Tatsache als bahnbrechend in der Geschichte, wodurch Doping erstmals nicht mehr als abstrakt, sondern als Summe von verbotenen Wirkstoffen und Methoden definiert wurde (Haug, 2006, S. 26). Figura erklärt den Wandel durch den Gewinn von Rechtssicherheit, sodass der Schritt von entscheidender Bedeutung angesehen werden konnte, da durch die bis dato ethischen Definitionen das Bestimmtheitsgebot des Rechts nicht erfüllt wurde (Figura, 2012, S. 110).
Gabriel vereint das moral-juristisches System und stellt den WADA-Code als juristisch und moralisch normativ dar. Das Handeln im Leistungssport kann als juristisch richtig und falsch eingeordnet werden, während auch der Wertmaßstab aus moralischer Sicht für gutes oder schlechtes Handeln vorgegeben wird. Aufgrund dieser Einteilung wird davon ausgegangen, dass Sportausübung ohne Doping zugleich juristisch richtig und moralisch gut ist, während Zuhilfenahme von Dopingmitteln juristisch falsch und zugleich auch moralisch schlecht sei (Gabriel, 2013, S. 69).
Abbildung 1: Juristische und moralische Einordnung des Dopings im Leistungssport (Quelle: Gabriel, 2013)





























