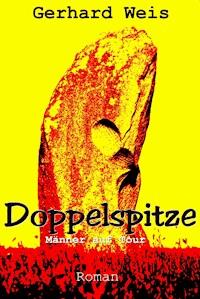
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der wortgewaltige und Frauen striezende Lebenskünstler Giselher Finger benötigt Hilfe. Ausgerechnet zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft plagen ihn seine Hämorrhoiden. Als der Onkel Doktor an ihm herumfuhrwerkt, fällt er in Ohnmacht und erlebt einen absonderlichen Traum. Darin wird ihm geweissagt, eines Tages für ein über die Maßen lauteres Tun königlich belohnt zu werden. Ein knappes Jahr später ist der Genesene auf Herrentour. In einer Allgäuer Kneipe gerät seine Clique ins Visier schamloser Weibsbilder. Giselher wehrt die unmoralische Attacke eiskalt ab und hat – aus heiterem Himmel – "Poldi" an der Hand. Ein Prachtstück, absolut ladylike! Der Novize steht "Klose" – wie er seinen Schniedel Frauen gegenüber benamst – fortan hilfreich zur Seite. Was Madame wohl dazu sagen wird? Seine Kameraden jedenfalls sind begeistert. Sie wollen auch in die Champions-League! Aber leider taugen ihre Knipser nicht für die Königsklasse. Auf der Suche nach einer Lösung für vier kleine Problemchen erlebt das honorige Männerquintett ein unglaubliches Abenteuer ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Weis
Doppelspitze
Männer auf Tour
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Januar 2013
Im letzten Jahrtausend
Zweieinhalb Jahre später
Ellmau, Teil eins
Das Maß aller DINGSE
Der Bierbudentester
Donnerklitchen, Teil eins
Ronald Regen (Ronny, der Wurm)
Donnerklitchen, Teil zwei
Ellmau, Teil zwei
Donnerklitchen, Teil drei
Klose und Poldi
Konstanz
Ingo Kleinschmitt (Hoss)
Addirn oder Summirn?
Das Erstemahl
Der Mumme-Köder
Kofi Addo
Das Duell
Bodo Panzer
Die Wünschelroute
Den Spatz im Silbersee
Finale grande
Epilog
Quellenhinweise
Danksagung
Impressum neobooks
Januar 2013
Oje, ojemine – nicht schon wieder! Mit Entsetzen erkannte ich, dass alles Lamentieren für die Katz sein würde. Das Geld war futsch, unwiderruflich weg, mit kanadischen Aktien verzockt. Ach du lieber Gott! Wie soll ich das bloß Madame beibringen?
Darum tötet, was irdisch an euch ist: die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Kolosser 3.5-6
Ich ging mit mir in Klausur, entsann mich meiner wenigen Stärken und fasste den Entschluss, ein lange gehegtes Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen. Wer weiß, für was die neuerliche Lektion an der Börse gut war.
In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn!
Im letzten Jahrtausend
Saarlandhalle Saarbrücken,
Donnerstag, 9. Dezember 1999, kurz nach zwanzig Uhr.
Innenraum, Reihe 17, Plätze 10 und 11: Hein und Finger.
BAP – TONFILM
… Dat soll dann alles jewääse sinn, dat bessje Fußball un Führersching, dat woor dann dat donnernde Lääve … Jewääse
Zweieinhalb Jahre später
»WAS FÜR EINE GOTTVERDAMMTE SCHEISSE!« Ich schrie meinen Frust jählings gegen die picobello gestrichene Zimmerdecke. Erst wenige Tage zuvor hatte ich der guten Stube auf wochenlanges Drängen von Madame einen neuen Anstrich verpasst. Mein Fluch kam dermaßen wütend und schrill, dass unsere Schäferhündin Daisy, die neben mir auf dem kuscheligen Nepalteppich friedlich schlummerte, erschrocken aus der Waagerechten ins Sitz schoss. Es war ein Frühlingsnachmittag, wie er schöner kaum sein konnte. Draußen herrschte Bilderbuchwetter und drinnen war der belebende Duft frischer Farbe noch immer gegenwärtig. Durch die nahezu transparenten Vorhänge drang die Sonne in unser Wohnzimmer. Daisy wurde von dem goldfarbenen Licht zauberhaft in Szene gesetzt. Eigentlich war ich ja ein romantisch veranlagter Zeitgenosse, der solcherart optischen Reizen gewöhnlich nur zu gern die Seelentür öffnete. Aber heute stand mir dafür nicht der Sinn. Stattdessen lag ich schon eine geschlagene Stunde wie das Leiden Christi rücklings auf der Couch und stierte zur Decke. Die Schmerzen hatten noch immer nicht nachgelassen, jedenfalls nicht in nennenswertem Maße. Ich fühlte mich beschissen. Dermaßen hundeelend, als wäre ich in Sing Sing Opfer einer »prison rape« geworden. So oder so ähnlich wird man sich wohl fühlen, wenn man von einer kernigen Niggergang vergewaltigt wird, sinnierte ich, um mich auch gleich wieder für meine Gedanken zu schämen.
Niggergang? Derartige Kraftausdrücke gehörten nicht zu meinem Standardvokabular. Zumindest wenn ich – bis auf die wenigen ungestümen, meist aus einer Laune des Augenblicks resultierenden Ausnahmen – nüchtern war. Auf keinen Fall hätte ich Farbige im Beisein anderer abwertend tituliert. Ich machte keine Unterschiede wenn ich mit Menschen zu tun hatte. Bei mir im Sportstudio hätte Frau Merkel die gleiche Behandlung wie Heidi Dumm erfahren:
»Nix da mit Promi-Bonus, Angela! Wir sind hier bei Fingers. Bei uns wird sich nicht vorgedrängelt! Runter auf den Boden, zehn Liegestütze – aber dalli, dalli! Das nächste Mal stellst du dich wie alle andern hinten an! Klaro?«
Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn zeichnete mich aus. Dazu gehörte die strikte Wahrung des Gleichbehandlungsprinzips, und zwar ohne Wenn und Aber. Mir ging nicht die Muffe, wenn ich es mit den oberen Zehntausend oder, früher in meinem Leben, einem diktatorischen Vorgesetzten zu tun hatte. Während meiner Karriere als Schutzmann, mit dieser ersparte ich mir nach einer bewegten Schulzeit den Barras, hatte ich mit einigen Exemplaren zu tun, die man allem Anschein nach bei der Entnazifizierung der Republik vergessen hatte. Der Gerechtigkeit halber sollte ich erwähnen, dass man bei der Bewertung solcher Dinge die Umstände nicht aus den Augen verlieren darf. Adenauer zog den Vergleich mit schmutzigem Wasser, welches man auch nicht wegschüttet, solange noch kein frisches vorhanden ist. Man vermutete die Ursache für mein Revoluzzertum in meiner Erziehung und behauptete, insbesondere mein Vater hätte mir als Vorbild gedient.
Ja, mein Papa. Wäre er doch nur ein paar Jahre früher auf diese gottlose Welt gekommen! Alfons Finger hätte »das uns teuerste aller Leben, das wir auf Erden kennen«, wie Joseph Goebbels, des Abgotts fanatischster Mundlanger, nach der missglückten Operation Walküre voller Pathos formulierte, bestimmt auf die ein oder andere Weise abgemurkst. Getrieben von einer tiefen Verachtung des Nazihäuptlings und dessen Vasallen hätte Papa entweder den Zeitzünder im Münchener Bürgerbräukeller eine Viertelstunde vorgestellt oder, mit Braunhemd und Hakenkreuzschürze maskiert, dem stimmgewaltigen Vegetarier am Rednerpult eine leckere Portion Nazi-Goreng zum Malzbier serviert. Und hätte das Amatoxin der nach Schafchampignons ausschauenden Knollenblätterpilze die Braunauer Leber nicht ausreichend attackiert, hätte er Stauffenberg fünf Jahre später halt zwei Finger seiner linken Hand ausgeliehen.
Vielleicht wäre er auch – frech wie Rust! – höchstpersönlich auf dem »Braunen Platz« gelandet, um sich ungeniert eine der Lagerbaracken der Wolfsschanze vorzunehmen. Ein Furz nur, und die Bude wäre zur Gaskammer erblüht. Bruno Gesche, Kommandant des Führerbegleitkommandos und bekennender Alkoholiker, hätte den jungen Mann mit der über die Nase reichenden Vollvisierbrille passieren lassen, Papas Knicks bei dessen gekonnter Telemark-Landung als eine neue, durchaus interessante Form der Respektbezeugung vor seinem Arbeitgeber interpretiert. Der schielende Herr Sturmbannführer wäre gewiss der Auffassung gewesen, der Uraufführung des Deutschen Knickses, einer längst überfälligen Erweiterung des Grußes aller Grüße, beizuwohnen. Dass bei Papas Version des mit flacher Hand auf Augenhöhe schräg nach oben gestreckten rechten Arms nur der mittlere seiner fünf Finger salutiert hätte, wäre Bruno vermutlich entgangen. Den gewaltigen Knick in des Leibwächters Optik hätte auch ein ausgiebiger Frühschoppen nicht korrigieren können.
Folgerichtig wäre von einem unverdorbenen Jungspund Geschichte gepupst worden. Der einer aufrechten Bäuerin entsprungene Gegenentwurf zum Hitlerjungen hätte im Führerhauptquartier den brutalst möglichen Stinke-Finger fahren lassen – ohne Rücksicht auf Verluste! Geräuschlos und alles Organische ringsum in Sekundenschnelle vernichtend. Der blutjunge Exekutant hätte gewiss kein Aktentäschchen unter den Tisch gestellt, sondern … mitten in den Raum gekoffert! Papas Faulgasbombe, ein Produkt heimischer Hausmannskost (Dünnbier, Korn und ein Potpourri aus Zwiebelkuchen, Sauerkraut und »Löffelches Bohnesupp«), wäre zwar nicht krachend detoniert, aber dennoch das krasse Gegenteil eines Blindgängers geworden. Eine einzige seiner selbstproduzierten Bio-Waffen hätte genügt, und dem Wahnsinn wäre der Garaus durch die Nase gekrochen.
»Um 12:42 Uhr wird zurückgefurzt! Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten! Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft!«, wären die drei letzten Sätze gewesen, die zwei Dutzend Arier zu hören bekommen hätten. Freilich auf saarländische Mundart. Statt: »Es ist etwas Furchtbares passiert, der Führer lebt!«, hätte der Nachrichtenoffizier Erich Fellgiebel General Thiele im Bendlerblock »Operation Walküre, der Führer ist tot!«, mitteilen können. Über die Goebbels-Schnauze, wie der für läppische sechsundsiebzig Reichsmark erhältliche Volksempfänger in dessen Munde genannt wurde, hätte sich das vermutlich so angehört: »Das Herz unseres tapferen Führers hat aufgehört zu schlagen. Adolf Hitler und dreiundzwanzig seiner engsten militärischen Mitarbeiter sind heute Mittag durch ein feiges Giftgas-Attentat eines abgrundtief bösen und verworfenen Untermenschen grausam ums Leben gekommen. Paul Joseph Goebbels, Leiter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, wollte den Führer in seiner schwersten Stunde nicht alleine lassen und folgte ihm mit einer großdeutschen Portion Zyankali in den Heldentod. Gott schütze das deutsche Volk!« Für einen Kretin wie Goebbels war es bekanntermaßen ein Leichtes, persönlich von einer Welt ohne Führer Abschied zu nehmen.
Keinesfalls aber hätte Papa, wäre er schon flügge gewesen, amerikanische Panzer in die Luft jagen wollen. Kluge Köpfe konnten den erzürnten Knaben gerade noch eben von seinem waghalsigen Vorhaben abhalten. Der naive Pimpf glaubte, sich unbedingt gegen die GI's zur Wehr setzen zu müssen. Papas Köpfchen wuchs in der Folge recht schnell selbst zu einem klugen heran und konnte Gut von Böse präzise unterscheiden. Als Erwachsener sprach er dann jeden mit Du an und machte unmissverständlich klar, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Nicht selten zum Missfallen seiner Leute.
»Du bist ein sturer Bock, Alfons!«, war ein häufig gesprochener Satz, der nicht nur meiner Mutter regelmäßig über die Lippen kam. Von ihr hatte ich meine kompromisslose Einstellung jedenfalls nicht geerbt. Maria Finger wäre in vielen Situationen diplomatischer vorgegangen. Sie hätte den Gleichheitsgrundsatz, wenn es sich nach landläufiger Ansicht geschickt hätte, schon einmal zurechtgebogen und vor der Queen einen Knicks gemacht. Mama hatte viel zu oft Angst um mich, befürchtete schon beizeiten, ihr Erstgeborener könne durch seinen ausgeprägten Eigenwillen Nachteile erleiden. Ihre Furcht war fast immer unbegründet. Selbst als ich die georgischstämmige Frau Dr. Dr. Anastasja Ichmachwasichwilli als Mittdreißiger mehr hart als zart am Arm packte, ihr zeigte, wo der Zimmermann das passende Loch für sie ließ, und zum Abschied höflich aber bestimmt: »Auf Nimmerwiedersehen, Anastasja!«, wünschte, konnte man anschließend nur Vorteilhaftes als Konsequenz dieser dringend gebotenen Maßnahme feststellen. Die Dame mit den beiden Doktortiteln war um eine wichtige Erfahrung reicher und die überschaubare Gruppe bösartiger Biester an meinem Arbeitsplatz um ein Exemplar ärmer geworden. Irgendwann würde ich diese Sorte draußen haben und die allseits respektierte Begegnungsstätte für leibeserzieherische Maßnahmen am bedürftigen Weibe hexenfrei sein. Davon war ich überzeugt. Der von meiner Mutter befürchtete Aderlass unter den Intelligenzbolzen unserer Kundschaft war wieder einmal ausgeblieben.
Ich besuchte auch keine Konferenzen, um mich der Gesinnung anderer zu vergewissern. Berlin und der Wannsee konnten mich mal. Sonderbehandlungen für die Hautvolee hätte schon mein bisweilen überbordender Stolz nicht zugelassen. Und natürlich mein Glaube. Als Christ empfand ich es als schmählich, ja sogar als Sünde, vor den »schVIPs« einen Diener zu machen. Statt eines:
»Schönen guten Tag, Frau Professor. Hach, sind das aber schicke Leggings, die Sie heut tragen. Das pinklilane Blümchenmuster steht Ihnen ja so was von gut! Escada?«,
oder:
»Gertrud, sei doch bitte so lieb und trage unserer verehrten Frau Bürgermeister die Sporttasche hoch in die Umkleide!«,
haben die Damen die Wahrheit:
»Menschenskind, Frau Prof. Dr. Dralle-Schenkel, wie sehen Sie denn aus? Furchtbar, wie in die Wurst gepellt! Wer hat Ihnen denn den Fummel aufgeschwatzt? Eine ziemlich beste Freundin vielleicht? Die Person gehört in den Knast! Mal ehrlich, hat es lange gedauert, bis Ihre strammen Beinchen in diesen Schlauch gepresst waren? Hier, ziehen Sie das drüber! Sie wollen sich doch nicht vor den andern lächerlich machen, oder?«,
und nichts als die Wahrheit gehört:
»Hallöchen, Frau Bürgermeister, wenn man vom Teufel spricht … Seien sie doch so nett und nehmen die Rolle Klopapier mit hoch auf Toilette. Sie wissen ja: Nie leer gehen!«
Meinen in Sachen Disziplinarmaßnahmen weniger erfahrenen Freunden erteilte ich von Zeit zu Zeit bei einer Runde Stubbis kostenlosen Nachhilfeunterricht.
»Wer, wie diese dralle Privat-Dozentin für Plastische Chirurgie, selbst gerne austeilt, muss auch mal was einstecken und die Wahrheit vertragen können. Diese dumme Gans hat sogar die Unverschämtheit besessen, die Selbstbeherrschung eines Standesbeamten aufs Äußerste zu strapazieren. Dralle-Schenkel, wer heißt schon freiwillig Dralle-Schenkel? Nicht einmal ein Schimpanse, nur eine feiste Emanze – Paarreim, Saardéros! Ich als Standesbeamter hätte mich auf den Boden geschmissen und gekringelt vor Lachen. Und noch etwas: Wenn eine Dame der feinen Gesellschaft meint, nur weil ihr Herr Gemahl im Rathaus Regie führt und seine tranfunseligen Amtswalter auf ihren faulen Ärschen sitzen und fett werden lässt, müsse der Gemahlin des Herrn Gemahl beim Turnunterricht das Gleiche widerfahren, ist bei Giselher Finger an der falschen Adresse. ICH komme meiner Fürsorgepflicht nach! ICH kläre die Damen über ihren unseligen Irrtum auf! Hin und wieder ein Tritt in den Arsch hat noch keinem geschadet. Wie ihr wisst, kann auch der meine ein Lied davon singen. Habt ihr verstanden, Saardéros? Ich bin der Giselher, nicht irgendwer!«
Ich konnte fuchsteufelswild werden, wenn einer meiner besten Freunde meine Grundüberzeugungen in Frage stellte. Spontan entworfene Wortkonstrukte wie »schVIPs« konnten mir schon einmal aus dem Mund flutschen und die nicht selten beleidigten Adressaten derselben den Buckel runterrutschen. Insbesondere dann, wenn ich selbst ein bisschen beschwipst war. Das konnte bei einem Sportsmann wie mir recht schnell der Fall sein. Mein Schwellenwert lag, ganz im Gegensatz zu dem meines Kumpels Hoss, deutlich unterhalb einer Kiste Stubbis. Im Falle der »schVIPs« legte ich Wert auf die Feststellung, dass die feinen Leute das »sch« meist nur zuhause, dann aber gerne inflationär in den Mund nehmen.
»SCHEISSE, SCHEISSE, SCHEISSE!« Dieses Mal war ich es, der daheim den Worthahn aufdrehte.
Der Grund für meinen Wutausbruch waren die höllischen Schmerzen ein Stück weit unterhalb meines Os coccygis. Sie schienen nicht wie sonst einfach wieder verschwinden zu wollen. Als die Quälerei nach mehreren Dutzend Vater unser und fast ebenso vielen Gegrüßet seist du Maria schließlich doch noch ein – vorläufiges – Ende gefunden hatte, bat ich den Herrgott für all die üblen Gedanken, die mir während meiner gut zweieinhalbstündigen Pein durch den Kopf geschossen waren, um Vergebung. So schlimm wie dieses Mal waren die bösartigen Attacken auf mein Wohlergehen aber auch nie zuvor gewesen. Ich hatte mich auf nichts mehr konzentrieren, nicht einmal mit wachen Sinnen lesen oder fernsehen können. Bei all dem Missgeschick befiel mich wegen meiner unfreiwilligen Faulenzia obendrein ein schlechtes Gewissen. Eigentlich wollte ich an diesem Nachmittag mit Daisy durch den Wald joggen und anschließend einigen Damen in ihrem begrüßenswerten Bemühen, Bauch, Beine und Po wieder in Form zu bekommen, behilflich sein. Daisy und ich drehten fast jeden Tag unsere Runden. Was andere als Sauwetter bezeichneten, konnte uns nicht hindern. Regen, Schnee und Kälte hatten zudem den Vorteil, dass die Heerscharen verweichlichter Frauenleiber, die neuerdings an zwei Krücken lahmarschig durch die Gegend geschoben wurden, der Natur fernblieben.
»Ja gehts noch, du Hirni? Lebst du hinterm Mond? Wir ›worken nordisch‹, das verbraucht viel mehr Kalorien als dein blödes ›Tschoggen‹ und trainiert außerdem den Rücken!« So ungefähr lautete die entrüstet vorgetragene Replik zweier pummeliger Gestalten, als ich im Erbacher Forst beim Überholen kurz anhielt und höflich fragte: »Ja sagt mal, ihr zwei Hübschen, warum geht ihr im Hochsommer mit Skistöcken – aber ohne Helm – spazieren?«
Nordic-Walking! Die größte Erfindung der Leibeserziehung seit Callanetics ward zum Volkssport ausgerufen. Leistungsfähige junge Frauen, sogar das ein oder andere verweichlichte Mannsbild, waren zu jämmerlichen Memmen mutiert. Dass die sich nicht schämten! Ich hätte diesen Schlappschwänzen nur zu gern einen Termin bei Felix Magath gemacht.
»Mensch, Hoss, stell dir mal vor, die Gold-Rosi hätte schon in den Siebzigern ›nordisch geworkt‹, heimlich womöglich. Dann wär sie in Innsbruck auch im Skilanglauf unschlagbar gewesen. Ich lach mich gleich tot. Neureuther-Mittermaier, die nordische Kombination gekünstelten Perma-Lächelns. Eher hat der Rote Baron in der Besenkammer nach Nutella gekramt, als dass die beiden tatsächlich glauben, was sie der Nation über Nordic-Walking verklickern.«
»Die Rosi ›workt nordisch‹, weil es ihr Freud macht, Finger.«
»Von wegen Freud macht, Hoss. Alles nur Show! Bei der läuft außer dem Ski nix. Die ist längst durchschaut. Weißt du was ein Düsseldorfer Werbefuzzi unmittelbar nach Innsbruck über das weibsgewordene Frohlocken von der Winklmoosalm gesagt hat?«
»Nein, schieß los, Finger!«
»Die Gold-Rosi sei werbepsychologisch eine absolut heiße Type, könne Millionen verdienen, habe Muhammad-Ali-Format. Sie lache andauernd und die ganze Welt möge sie. Die Rosi würde sich für alles eignen. Von der Tiefkühlkost bis zur Zahnpasta und Fremdenverkehrswerbung, von Kuwait bis zum Sunset Boulevard. Nur mit dem Sex-Appeal hapere es ein bisserl. Stand alles im Spiegel. Recht hat er gehabt, der Herr Wilp. Dieser Nordic-Walking-Quatsch dient doch nur dem Fremdenverkehr und dem Portemonnaie einiger Leute!«
Ich vermutete, dass die meisten dieser neuen Sportskanonen über schlechtes Wetter nicht besonders traurig waren und stattdessen die Gelegenheit nutzten, sich leckere Buttercremetörtchen in ihre austrainierten Plappermäulchen zu schieben. Ohne Punkt und Komma quasseln, die armen Tiere im Wald mit einem Dauerfeuer verbaler Dumm-Dumm-Geschosse verschrecken. Das, aber keine Spur sportlicher Würde, zeichnete die »Nordisch-Worker« aus. Von wenigen löblichen Ausnahmen abgesehen: Menschen, die eine Alternative zum Rollator suchten. Nicht einmal ein schlechtes Gewissen mussten sie haben. Schließlich wurde diesen Schlaffis von allen Seiten eingetrichtert, ein von Skistöcken flankiertes Schneckentempo benötige mehr Kalorien als Joggen. Die Brigitte, die Tina, die Petra, die Lisa, selbst die Freundin der Bunten wusste Bescheid. Sollte das Bild der cosmopoliten Frau im Spiegel vital, en vogue, maximal glamour sein, dann gab es FürSie nur eins: Nordic Walking!
Gespült wurden die für die nächste Trainingseinheit benötigten Energiespender aus der Konditorei mit Latte. Wahrscheinlich der einzigen, deren Konsistenz in der Gegenwart solcher Amazonen überhaupt möglich war. Latte war schwer angesagt, nicht nur bei den Watschelentchen. Eine stinknormale Tasse Kaffee tranken nur noch die wenigsten: Kerle wie die Saardéros. Die Gala- und Bella-Leserinnen wollten unbedingt eine Latte, den Milchschaum derselben von ihren aufgespritzten Lippen züngeln. Auch diejenigen unter ihnen, welche selbst in der Rentnerklause von Latten nur so umzingelt gewesen wären. Obwohl es dort nur Stubbis und Malzbier im Ausschank gab.
Als verantwortungsbewusstes Herrchen hatte ich in der letzten Zeit unser Laufpensum merklich reduziert. Daisy zuliebe. Und, wenn ich ehrlich sein soll, auch ein kleines bisschen mir. Die vielen Kilometer schienen mir nicht mehr gut zu bekommen, warum auch immer. Der Arzt hatte dafür keine Erklärung. Er war der Ansicht, Joggen könne in meinem Fall keineswegs schaden. Die arme Daisy dagegen hatte nicht nur zeitlebens Probleme mit ihrem Verdauungstrakt, sondern auch mit den Hüften. Das war typisch für Deutsche Schäferhunde. Durch ein idiotisches Zuchtverhalten vermeintlicher Tierfreunde wurden sie zum Zwecke eines schwachsinnigen Schönheitsideals hintenrum tiefergelegt und somit im Laufe ihres – oft viel zu kurzen – Lebens unnütz gequält. Madame und ich hatten Daisy nach einem Sonntagsspaziergang behalten. Ihr sichtlich erleichterter Vorbesitzer wurde ausbezahlt. Die neun Monate alte Hündin bereicherte fortan unser Leben. Auch wenn ihre Anatomie den beknackten Ansprüchen mancher Hundesportler nicht genügte.
Statt mit Daisy leichtfüßig durch den Wald zu flitzen, lag ich schwer gebeutelt auf dem Sofa. Der bumsfidele Lebenskünstler Giselher Finger war zu einem Häufchen Elend mutiert und hatte die Faxen dick. Wars das wirklich schon jewääse, das donnernde Lääve? Waren die schönen Zeiten etwa ein für allemal vorbei? Jetzt schon? Ich war doch erst Anfang vierzig, gut trainiert und, wie ich annahm, auch in der Birne bestens in Schuss.
Dieser Nachmittag war noch qualvoller verlaufen, als ich es wegen meiner Beschwerden je für möglich gehalten hätte. Gott sei Dank hatte ich nichts Schlimmeres, Darmkrebs oder so. Das hatte der Arzt nach einer Darmspiegelung ausgeschlossen. Aber meine Lebensqualität hatte ganz schön Federn gelassen. Wenigstens wusste ich jetzt, wie sich ein Einlauf anfühlt. Ich war tagelang am Überlegen gewesen, ob es der meinem Dings abgewandten Seite dieses Jahr vielleicht besser täte, wenn ich zu Hause bliebe. Die Wandertour mit meinen Freunden stand gewaltig auf der Kippe. Seit geraumer Zeit hatte ich mit den Folgen eines völlig überflüssigen Gebarens zu kämpfen. Etwas, worüber man nicht gerne spricht, was einem hochnotpeinlich ist. Wer über Jahrzehnte – wohlgemerkt ohne Not! – auf einen permanent leeren Verdauungstrakt besteht, bekommt irgendwann die Quittung. Manchen Ballast sollte man keinesfalls überhastet loswerden wollen. Probleme mit den arteriovenösen Gefäßpolstern könnten die unangenehme Folge dieses Bedürfnisses sein. Intelligente Menschen vermeiden Druck. Zu denen zählte ich nicht! Ich war ein Klugscheißer, der sein Leben lang gepresst und jetzt die Konsequenzen am Arsch hatte. Selber Schuld!
Die nötig gewordenen Behandlungen beim Proktologen konnten mir gar nicht gefallen. Bei der ersten fiel ich sogar in Ohnmacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, Giselher Finger, Steelball und Senior Member der Saardéros, angeblich härter als jeder US-Navy-Seal, kippte einfach so um. Nur weil etwas Fremdartiges in meinem Hintern Einzug gehalten hatte. Das war mir ausgesprochen peinlich. Dabei meinte es der Onkel Doktor bestimmt nur gut, als er seinem Neuzugang rektal eine Überraschung bereitete.
»So, Herr Finger, dann ziehen Sie bitte mal Hose und Eierbecher aus, krabbeln auf die Liege und gehen in den Vierfüßlerstand!«
Gesagt, entblößt, gekrabbelt. Während sich der grobe Kerl die Bescherung betrachtete, hielt mir eine Arzthelferin die Arschbacken auseinander.
»Mensch, Herr Finger, es wird höchste Zeit, dass wir Ihnen helfen. Das sieht wirklich nicht schön aus, fast schon nach Lepra. Fürwahr, Sie haben immer feste gedrückt. Ich mach Ihnen jetzt ein Gummiband um das Wehwehchen. Keine Angst, es wird nicht wehtun.«
Von wegen! Was hatte sich dieser Sadist dabei nur gedacht? Sollte so ein eiskaltes, grässliches Instrument wirklich diagnostischen oder gar therapeutischen Zwecken dienen? Das konnte ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Aber wer weiß, vielleicht hatte ja des Proktologen Gemahlin eine dieser neuerdings so populären Partys veranstaltet und ihr Gatte im Eifer des späteren Gefechts versehentlich die Waffen vertauscht, waren meine Gedanken. Die Zeiten hatten sich nun einmal geändert. Als ich noch ein Kind war, besuchte die Avon-Beraterin gebührlich keusche Frauen – beispielsweise meine Mutter. Später begeisterten die Super-Tuppers wohlerzogene deutsche Hausfrauen in der Küche. Wenn ich mich nicht irre, widmete ABBA denen sogar einen Schlager. Aber mittlerweile ging es im Wohnzimmer mit Zielrichtung Schlafzimmer ganz anders zur Sache. Spätestens nach dem zweiten Glas Rotkäppchensekt. Voll im Trend waren konspirative Treffs, bei denen ultrabraven Heimchen ultrascharfe Wäschestücke schmackhaft gemacht wurden. Gegen derart Spitzfindiges gab es im Grunde nichts einzuwenden. Im Gegenteil! Mit Straps und Spitzenhöschen getunt, durfte sich manche graue Maus auf etwas gefasst machen. Vorausgesetzt, Frau Birkenstock war zu einer appetitlichen Präsentation frivoler Stofffetzen in der Lage und trug vernünftiges Schuhwerk – auf keinen Fall aber Lockenwickler. Und wenn der Postmann am Wochenende gleich mehrmals klingeln sollte, durfte das provozierende Klack-Klack der schwarz lackierten Stilettos natürlich nicht zur Unzeit, zur Sportschau oder so, zu hören sein.
Richtig pathologisch wurde es aber erst dann, wenn den Säuischsten der feuchtfröhlichen Damenrunde entartete Plastikprodukte eindeutiger Bauart aufgeschwatzt wurden. Bei einer unserer Sitzungen im Dorfbrunnen hatten wir uns über dieses höchst primitive Phänomen unterhalten:
»Das sind ganz raffinierte Weibsbilder. Die machen mit dem feuchten Trieb der vielen Doofchen im Land ihr Geschäft. Eigentlich gehört denen das Handwerk gelegt. Meinst du nicht auch, Finger?«
»Genau, Heiner. Wer sonst, als eine von Sinnen geratene Frau, kommt schon auf die Idee, solch ein klobiges Ding zu erwerben? Wo es doch so schöne, filigrane Originale gibt, die meist sogar kostenlos ihren Dienst verrichten, nicht wahr? Man muss deren Besitzer bloß höflich fragen. Stimmts oder hab ich recht, Saardéros?«
»Stimmt, Finger, du hast wieder mal recht! Stattdessen wählt die coole Jule neuerdings ein Dings aus Glas oder, noch schlimmer, aus Edelstahl. Die spinnen, die Weiber!«
»Mensch, Bodo, gab es nicht jüngst Gerüchte, dass diese schamlosen Dildofeen jetzt auch bei uns ihre feurigen Mitbringsel feilbieten?« …
So etwas ähnliches wie ein Dings aus Edelstahl einverleibt zu bekommen, war dann aber des Gutgemeinten zu viel. Ich reagierte reflexartig auf diesen für mich völlig ungewohnten Stimulus und fiel tief in Ohnmacht. Gleichsam einem Kind, das instinktiv die Augen schließt, wenn der Bi-Ba-Butzemann nachts neben seinem Bettchen steht. Glücklicherweise krachte ich nicht auf den Fußboden, sondern lediglich … auf dem Therapietisch zusammen. Die Zeit meiner kognitiven Abkehr war herrlich. Es müssen Minuten gewesen sein. Da ich nur recht widerwillig wach werden wollte, wurde ich mit Leitungswasser (mein Hemd war patschnass!) geweckt. Hatte ich doch eben noch so angenehm geträumt:
Im Zauberwald von Brocéliande saßen König Artus, der Druide Merlin und der furchtlose Jäger Giselher Finger auf einer geheimnisvollen, moosbewachsenen Lichtung früh abends zu Tisch. Derselbe war Jahrzehnte zuvor von Torquil McFadden, einem blinden keltischen Bildhauer, aus einem Block schwarzen Granits – in der Form eines der Länge nach durchschnittenen Apfels – meisterlich gemeißelt worden. Zu jener Zeit galt der Apfel als ein Symbol sinnlicher Lust und Begierde. Seine Form wurde mit den weiblichen Brüsten, das Kerngehäuse mit der Vulva verglichen. Die Oberfläche der Tafel war fein poliert und glänzte wie Speck. Ein würdiger Platz für dieses erlesene Trio, das mit großem Appetit ein am offenen Feuer gebratenes Wildschwein verspeiste. Finger hatte den Keiler mit dem königlichen Schwert vor Tau und Tag tollkühn erlegt. Artus selbst hatte ihm Excalibur zu eben jenem Zweck überlassen. Als Beilage gab es ein Püree aus Artischocken und ofenfrisches Baguette.
Musikalisch begleitet wurde die Tafelrunde von Hugo Lindenzwerg und Elfi Pirelli. Während der kurzwüchsige Barde mit zarter Stimme Minne sang, vertrieb die vollbusige Elfi mit ihrem Schmettergesang Wotan. Zwischendurch servierte sie Eierlikör. Hugos verschlissene Stimmbänder gehörten regelmäßig geölt. Im Verlaufe dieser Serenade sprachen Artus und Merlin mit Hingabe einem Château Pétrus zu, wohingegen der mit der Flasche großgezogene Jäger lieber zu einem Stubbi griff.
Die Sonnenstrahlen, welche den Zauberwald an diesem lauschigen Flecken breit gefächert durchdrangen, verursachten auf der Tischoberfläche – insbesondere aber auf dem im Zentrum der Lichtung majestätisch thronenden Menhir – prismatische Reflexe unbeschreiblicher Art. Der phallusförmige Hinkelstein kam mir wie ein mittelalterlicher Kernreaktor vor. Er spendete der Gesellschaft eine wohltuende Wärme und dem Gelände ein schwarz-rot-goldenes Antlitz. Um ihn herum schien der Boden zu brennen, wenn seine knisternde Spitze wieder einmal rhythmisch pulsierte. Dieser visuelle Reiz, gepaart mit dem Duft erlesener Gaumenfreuden und der Kakophonie bizarrer Nachtmusik, erzeugte eine erlauchte Atmosphäre unter den Anwesenden.
Inspiriert durch die auf Liebreiz getrimmten Texte des Panikbarden tauchte, wie aus dem Nichts, die ohnegleichen weißhäutige Fee Viviane unter der Tafel auf. Nur mit einem Feigenblatt höchst despektierlich bekleidet, verführte sie Merlin – der sich dies nur zu gern gefallen ließ! – nach allen Regeln der französischen Kunst. Derweil flocht der mit der Schnute scharfgemachte Druide das feuerrote Haar Vivianes mit flinken Fingern zu einem entzückenden Rapunzelzopf und schickte sich seinerseits an, seiner mit bretonischem Dialekt dozierenden Französischlehrerin Griechisch-Unterricht erteilen zu wollen. Finger, schamhaft und keusch erzogen, konnte einen solchen Affront vor den Augen des Königs unmöglich dulden. Er beendete den Sprachunterricht mit einem Kübel eiskalten Wassers aus der nebenan befindlichen Quelle von Barenton.
Lancelot, des Königstreuer Ritter, beobachtete die Schweinerei mit dem Periskop seines auf dem Grunde des Sees von Comper befindlichen Schlosses. Pflichtbewusst berichtete er der Fee Morgane, die gerade im Tal ohne Wiederkehr einen ihrer untreuen Liebhaber mit der Gerte maßregelte, von dem Fauxpas Vivianes und dem hoffähigen Verhalten des sittsamen Jägers. Morgane veranlasste daraufhin ein Sippentreffen im königlichen Lustgarten. Dort bekam die Jungfee Donnerklitchen die Order, Giselher Finger eines Tages für sein besonders schickliches Tun mit der Erfüllung eines Herzenswunsches zu belohnen. Ihre Kollegin Viviane erhielt im Gegenzug einen Tag Bubenarrest.
Just in dem Moment, als der Minnezwerg einen Eierlikör und der Rest der Gesellschaft zur besseren Verdauung einen Kümmerling kippten, schüttete mir die Arzthelferin ein letztes Glas Wasser ins Gesicht.
Wer mich kannte, konnte auch nachvollziehen, dass ein gewalttätiges Fuhrwerken in der engen Höhle zwischen meinen Gesäßbacken nicht ohne Folgen bleiben würde. Zumal ich diese Folter mehrfach über mich ergehen lassen musste. Wenn Madame damals in unserem Sportstudio gefragt wurde, warum ihr Gatte Giselher plötzlich so sanft mit den Leuten umging (manche Athletinnen vertraten tatsächlich die Ansicht, ich sei ein hundsgemeiner Schinder), bekam die Fragende zu hören:
»Du, das hat nichts mit Altersmilde zu tun. Auch euer Trainer hat eine Problemzone und bei der Beseitigung dieser durch das Werk seines Arschäologen einen Knacks erlitten. Macht euch keine Sorgen, das geht bestimmt bald vorüber. Seine Sitzungen auf'm Klo werden kürzer und kürzer.«
Man verschrieb mir eine Menge Medikamente, um die seelischen Folgen der Gewalteinwirkung zu beseitigen. Glücklicherweise halfen die. Schnell hatte ich mein Trauma überwunden. Aber leider auch eine bleibende Nebenwirkung am Arsch: In meinem Bewusstsein begannen sich Realität und Hirngespinste immer häufiger und zunehmend intensiv zu vermischen. Das eigentlich Erstaunliche aber war, dass dies nicht nur für mein gegenwärtiges Erleben, sondern auch für meinen Blick in die Vergangenheit galt. Der Leser sollte sich diesen Umstand immer vor Augen halten!
Donnerlittchen, dachte ich mir, das war aber jetzt mal ein geiler Traum – und so realistisch! Ich nahm mir vor, bei Gelegenheit am anderen Ufer nachzufragen, ob solche Trips dort üblich sind. Nicht, dass mir jetzt jemand auf falsche Gedanken kommt! Ich wollte mich keinesfalls über Schwule lustig machen. Aber alleine schon die Vorstellung, Part – womöglich noch der weibliche! – einer solchen Amour fou zu sein, löste bei mir in jener Zeit ein nachdrückliches Unbehagen aus. Man sollte nicht meinen, wie fürsorglich man nach meinem Kollaps mit mir umging. Unmittelbar nach jeder Behandlung durfte ich mich, ohne dass man mir diese Prozedur berechnet hätte, sogar ein Weilchen bequem hinlegen. Manchmal hielt mir dabei eine Arzthelferin die linke Hand – was damals noch gänzlich unkompliziert möglich war.
Ellmau, Teil eins
Am Morgen des 30. Mai 2002 ging es mir bestens. Also gab es keinen Grund für mich, meine Freunde an Fronleichnam nicht nach Ellmau zu begleiten. Tags zuvor hatte ich angesichts meines scheußlichen Befindens nicht mehr mit dieser freudigen Wendung gerechnet und Ronny meine Unpässlichkeit am Telefon offenbart.
»Ich fahr morgen nicht mit … bin malade!«
»Wie … fahr nicht mit … bin malade? Was soll das heißen? Was hast du denn?«
»Mir schwillt der Arsch nicht ab … hab mordsmäßig Probleme mit den Hämorrhoiden … muss ständig aufs Klo.«
»Seit wann denn das? Giselher Finger und Hämorrhoiden, das ist ja mal was ganz Neues.«
»Das geht schon geraume Zeit so, Ronny. Wird immer schlimmer statt besser. Glaub mir, ich leide wie ein rumänischer Straßenköter. Der Doktor hat gemeint: ›Wenn wir Pech haben, muss ich Sie operieren, Herr Finger!‹ Aber das kann er sich abschminken, kommt nicht in Frage. Niemand schneidet mir am Hintern rum. Schon gar nicht dieser Rohling. Lieber sterbe ich. Ich bin der Giselher, nicht irgendwer!«
»Das kannst du uns nicht antun, Finger! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
»Doch, ist es, nur nicht das mit dem Sterben … aber ansonsten schon. Ich will euch nicht die Tour vermasseln. Nicht mit meinem Arsch, Ronny!«
»Dann schmier halt was drauf!«
»Was meinst du, was ich seit Wochen tue? Tut mir leid, das ist echt kein Spaß. Wie's ausschaut, wird das morgen nix mit mir.«
Gott sei Dank hatte ich mich getäuscht. Vielleicht hatten sie ja nach der schockierenden Neuigkeit auf ihre Art für mich gebetet: Sich auf ein Stubbi getroffen und Wenn et Bedde sich lohne däätkrakeelt. Dabei brauchte sich keiner genieren. Odersie hatten, verwegen statt verlegen, in der Blieskasteler Klosterkapelle eine Kerze für ihren schwer kranken Freund angezündet. Zuzutrauen wäre es ihnen gewesen. Ich selbst bedurfte keiner Rituale, um zu wissen, dass ein Gebet sich immer lohnt. Auch dann, wenn das Leben nicht gerade im Arsch zu sein scheint. Dazu brauchte ich weder BAP noch Kerzenlicht.
Wir brachen zeitig auf. Die fünfhundert Autobahnkilometer Richtung Kufstein konnten sich ziehen. Es war klar, dass an diesem verlängerten Wochenende noch jede Menge weiterer Luftverpester die Alpen ansteuerten. Da Hoss partout nicht in Ronnys roten Z1 passen wollte, war unser Jüngster gezwungen, mit dem hausbackenen VW Passat seines alles andere als hausbackenen Eheweibs Ulla für einen einigermaßen bequemen Transfer nach Tirol zu sorgen. Das protzige BMW-Cabriolet blieb in der Garage. Wenn die mit Petticoat, Stöckelschuhen, Kopftuch und Sonnenbrille aufgebrezelte Ulla Regen ihre Beinchen beim Ein- oder Aussteigen kokett über die türschluckenden Seitenschweller schwang, genoss sie die Blicke auf ihre wohlgeformten Fesseln. Bei dem ein oder anderen dieser selbstbewussten Manöver war angeblich sogar die Farbe ihres Schlüpfers auszumachen gewesen. Diesbezüglich traute ich den Behauptungen meiner Kumpels allerdings nicht über den Weg!
Normalerweise wäre eine Wandertour an Tagen wie diesen, dem vierwöchigen Hochamt des Fußballs, undenkbar gewesen. Aber heuer würden wir ja nichts Wesentliches verpassen. Das Eröffnungsspiel tags darauf und ein, zwei unbedeutende Partien der Vorrunde, mehr nicht. Wie konnte man so bescheuert sein und eine Fußballweltmeisterschaft in Japan und Südkorea stattfinden lassen? »Der Blatter Sepp ist voll der Depp – Paarreim, Männer!« Heiner formulierte es vornehmer: »Ein solches Turnier gehört nach Europa oder Südamerika. In ein Land, wo der Fußball Teil seiner Kultur ist und sich die Massen auch wirklich für ihn begeistern.« Die Erinnerung an die fehlende Atmosphäre in den USA acht Jahre zuvor war noch frisch. Schlimmer gehts nimmer, dachten wir. Selbst meine Phantasie war nicht blumig genug, dass ich mir ernsthaft vorstellen konnte, die FIFA vergäbe eine WM nach Katar. Mannomann, was sollte man dazu noch sagen?
Nach einer erstaunlich geruhsamen Fahrt aßen wir auf der Terrasse der Klosterbräustuben in Oberelchingen zu Mittag. Auf unseren inneren Autopiloten war Verlass. Vor fast zweihundert Jahren war ein berühmter Landsmann von uns – »le brave des braves« (der Tapferste der Tapferen), wie Napoleon Marschall Ney einst bezeichnete – in diesen Gefilden gegen die Streitkräfte des österreichischen Feldmarschallleutnants Graf Riesch in die Schlacht gezogen. Michel Ney, ein Saarländer wie wir und Ricky, mein Schalke 04-verrückter Schwager. Nur dass wir keine Soldaten, Herzöge von Elchingen, Fürsten von der Moskwa oder Söhne armer Böttcher waren und auch nicht in der Bierstraße in Saarlouis zur Welt gekommen sind. Aber immerhin, das ein oder andere Bierchen pitschten auch wir. Ricky wurde sogar ganz in der Nähe von Saarlouis geboren und hatte, wie der zum »duc d'Elchingen« ernannte Gefolgsmann Bonapartes, seine Ausbildung in der Dillinger Hütte absolviert. Mehr noch: Ricky war, wollte man den Recherchen eines heimischen Ahnenforschers Glauben schenken, über ein paar Ecken mit Michel verwandt.
Das naturtrübe Kellerbier im Angebot der Schänke diente uns zum Ausbringen des ersten Trinkspruchs unserer diesjährigen Tour.
»Prost, Saardéros!«
»Prost, auf Rick und den duc! Paarreim, Männer!«
»Und auf Giselher, nicht irgendwer! Paarreim, Finger! Möge dir dein Arsch wohlgesonnen sein!«
»Danke, Hoss!«
»Liberté, égalité, fraternité!«
»Jawohl, Heiner, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Und wenn man bedenkt, das wir sogar den doofsten Kratzbürsten tolerant und geflissentlich humanitär begegnen, gingen wir glatt als Freimaurer durch. Ich meine: Auch wenn der Vatikan die Zugehörigkeit zu dieser edlen Handwerkskunst als unvereinbar mit der katholischen Lehre betrachtet, ist solcherlei menschliches Gebaren ethisch ohne Fehl und Tadel. Meint ihr nicht auch, Saardéros?«
Mein großes Maul funktionierte noch. Für meine Sprüche erntete ich Beifall. Obwohl vermutlich keiner meiner begeistert applaudierenden Freunde verstand, was ich da wieder mal laberte. Egal, Hauptsache mein verlängerter Rücken wurde an dieser historischen Stätte zum Nebenkriegsschauplatz erklärt – trotz meiner unterwegs immer wieder geäußerten Bedenken. Nachdem ich meinen erstaunten Freunden (»Wo haste denn das alles wieder her, Finger?«) abschließend erklärt hatte, dass man den duc in der dreizehnten Spalte des Arc de Triomphe, direkt neben dem schottischstämmigen Étienne Jacques Joseph Alexandre MacDonald, 1. Herzog von Tarent, verewigt hatte, fuhren wir weiter auf der BAB 8 Richtung München. Fürs Erste war der Geschichtsunterricht beendet.
Unterwegs entschieden wir uns, dem ehemaligen Konzentrationslager Dachau einen Besuch abzustatten. Statt, wie für das deutsche Durchschnittsweib typisch, konzeptlos in den auf unserer Route gemeldeten Stau zu brausen, nutzten wir die Zeit sinnvoll und nahmen zum zweiten Mal an diesem Tag historisch erhellende Nachhilfestunden. Dass wir auf Männertour waren, bedeutete entgegen landläufiger Annahme keineswegs, dass wir uns ausschließlich dem Frohsinn hingaben und die bedeutsamen Dinge des Lebens links liegen ließen. Für Typen wie uns traf das Gegenteil zu. Wir waren auf unseren Streifzügen für derartige Abstecher immer zu begeistern.
»Geboren in Braunau – eingebürgert in Braunschweig – Braunhemd – braunes Haus – Eva Braun – braun, braun, braun … überall nur braun. Scheiße ist auch braun, meistens jedenfalls, manchmal aber auch braunrot!«
Ich brauchte kein Gewehr um loszuballern. Wenn der Anlass passte, entwichen, einmal die Automatik entsichert, meiner großen Klappe mitunter großkalibrige Wortsalven. Die konnten einen schwer verletzen. »Braucht der Typ da eigentlich 'nen Waffenschein für seine Gosche?« Diese Frage hatte mal einer gestellt, der Ohrenzeuge meines verbalen Geballeres wurde. Ich muss zugeben, dass es oft nicht einfach war, hinter derartigen Schimpfkanonaden die eigentliche Botschaft zu erkennen.
Dass es ein größenwahnsinniger und brutaler Mensch wie der »Führer«, mag er noch so charismatisch gewesen sein, nach seiner Ernennung zum Reichskanzler fertigbringen durfte, aus einem demokratischen Rechtsstaat in Rekordzeit ein verbrecherisches Unrechtsregime zu formen, um anschließend die ganze Welt ins Unglück zu stürzen, konnte ich meinen Vorfahren nie verzeihen. Schon knapp zwei Monate nach der Machtübernahme hatte die braune Brut damit begonnen, das KZ Dachau zu errichten. Es hielt als Muster für alle späteren Massenvernichtungslager her und stand unter der Herrschaft der SS, Dresscode Hugo Boss. Bis zur Befreiung durch die Amerikaner, zehn Tage vor der bedingungslosen Kapitulation Nazideutschlands, wurde jeder Fünfte dieser mehr als zweihunderttausend unglückseligen Menschen aus ganz Europa ermordet.
»Saardéros, anfangs sollten hier nur die politisch Unbequemen inhaftiert und mundtot gemacht werden. Aber spätestens nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze wurden in Dachau eine Menge weiterer Häftlingsgruppen ihrer Menschenwürde beraubt: Homosexuelle, Juden, Sinti und Roma … und, und, und. Selbst Menschen, die lediglich als arbeitsscheu galten, haben diese Dreckskerle nicht verschont. Stellt euch mal vor, was die mit eurem Giselher gemacht hätten! Eine Schuld an den Gräueltaten in der Hitlerzeit kann man uns nicht zuweisen. Wir haben Glück, durch die Gnade der späten Geburt Exkulpierte zu sein. Aber auch die verdammte Pflicht, ein Vergessen nicht zuzulassen! Wie seht ihr das?«
»Genauso, Finger!«
In dieser Frage waren wir uns einig.
Ohne nennenswerte Verkehrsbehinderungen am frühen Abend in Ellmau angelangt, wurden wir bei einem Begrüßungsbierchen Zeuge einer blau-gelben Punktlandung. Ob es tatsächlich Jürgen Möllemann war, der mit einem FDP-farbenen Fallschirm auf einer saftig grünen Wiese gekonnt aufsetzte, ist eher unwahrscheinlich. Die Bemerkungen, die uns dabei im herrlichen Abendrot über die Lippen kamen, waren nicht alle vom Feinsten. Wir hatten ja nicht ahnen können, dass der Kopf von »Projekt 18« ein Jahr später eine finale Bruchlandung hinlegen würde. Den restlichen Abend ließen wir in einer der Gaststätten des Ortes locker ausklingen. Am nächsten Morgen wollten wir fit sein.
Das Maß aller DINGSE
Menschen neigen zu Vergleichen. Das liegt in ihrer Natur. Genuin ist auch die Tatsache, dass ein Mann einer Frau imponieren will. Dieser Impetus lässt sich unmöglich verhindern, selbst wenn sich das Mannsbild noch so sehr darum bemüht. Die Programmierung einzelner Abschnitte auf seiner schraubenförmigen Doppelhelix sabotiert eine solche Absicht schon im Ansatz. Ist man als Mann bei einem bedeutsamen Vergleich der Loser, hat man ein ernsthaftes Problem. Die Psychofraktion ist der Ansicht, dass letztlich alles unter den Aspekten der Fortpflanzung zu betrachten sei. Der Sexualtrieb sei die Basis unseres Seelenlebens. Und die sei beim Manne nun einmal besonders breit. Was sich der liebe Gott wohl dabei gedacht haben mag?
In den Augen einer Frau ein Großer zu sein, ist für uns Männer das Größte. Selbst wenn Mann klein ist. Und um herauszufinden, auf welcher Sprosse der Erfolgsleiter wir uns befinden, gibt es Vergleiche. Wie jedermann unschwer nachvollziehen können sollte, kann im konkreten Fall leider nicht jeder Mann der Größte sein, sondern immer nur einer. Das ist logisch. Logisch ist auch, dass all die anderen armen Schweine mit einem mehr oder weniger großen Problem leben müssen. Im Falle der »Dingsvergleiche« ist weniger sogar mehr. Was ein Beispiel dafür ist, wie irreführend der Gebrauch mancher Worte sein kann.
Mann schaut gepiesackt drein, wenn der Nachbar seinen nagelneuen Sechs-Zylinder demonstrativ hinter der eigenen Schrottkarre parkt. Mann übersieht nicht, dass die mondäne Gründerzeitvilla des Herrn Neureich in der Schlossallee deutlich mehr Raum beansprucht als das eigene Reihenhäuschen mit Bonsaigarten in der Badstraße. Mann registriert genau, wie schiefmäulig Madame einer guten Freundin am Telefon erzählt, dass sie für ihren schmierigen Chef schon wieder den maßgeschneiderten Marineanzug in die Wäscherei bringen musste. An Deck der Queen Mary 2 will auch ein hoffnungsloser Fall von Unbenimm ordentlich daherkommen. Und Mann weiß um die neidischen Blicke seiner Herzallerliebsten, wenn die aufgedonnerte Direktorengattin ihren Chihuahua im beigefarbenen Gucci-Täschchen Gassi führt.
Umgekehrt hat Mann, je nach Fasson des Vergleichs, in manchen Fällen die Nase wieder vorn. Dann ist der Verglichene der Loser. Und dem wiederum geht es nicht anders. Der moderne, aufgeklärte Mann vergleicht ständig. Ob er will oder nicht. Alles nur wegen dieses blöden Sexualtriebs. Da gibt es kein Entrinnen. Wohin man auch schaut, die Welt ist voller Loser-Boys. Besonders hart trifft manchen Adamskostüm tragenden Mann der Blick in den Spiegel. Um seine Anatomie ins rechte Licht zu rücken, werden heutzutage auch von Männern wahrlich seltsame Methoden in Erwägung gezogen. Gegen Sport ist nichts einzuwenden. Wie auch? Ein knackiger Körper, durch jahrelanges Training redlich erworben, hebt die Laune und ist nett anzuschauen. Darauf darf man stolz sein: gerechter Lohn für eine ehrliche Leistung! Aber leider werden immer häufiger auch unsportliche Mittel eingesetzt. Um an den gewünschten Stellen richtig was herzumachen, wird gefoult auf Teufel komm raus. Botox-Spritzen, Silikonimplantate, Fettabsaugen … Mann kennt da keine Tabus mehr. Wie die Weiber, such a shame!
Manche Mannsbilder verfügen über beträchtliche finanzielle Ressourcen. Sie bemühen nicht Professor Mang, um sich am Bodensee die Ohren anlegen oder ein paar Haare auf die kahlen Stellen ihres hohlen Köpfchens transplantieren zu lassen. Auch nicht die Doktoren Fuentes oder Ferrari, um bei der nächsten Radtour nicht schon wieder am ersten Hügel absitzen zu müssen. Nein, der Ferrari steht bei denen als Drittwagen im Hof, das Motorboot und ein Pferdegespann daneben. Wohl wissend, dass sie mit einem solchen Fuhrpark in der vom Belzebub vernebelten Wahrnehmung ihrer einfältigen Beute auf der Stelle vom schwabbeligen Schmerbauchträger zum unwiderstehlichen Sexpack mutieren.
Der folgenschwerste aller Vergleiche aber ist die »Dingsvergleiche«. Wehe, die geht in die Hose! Dann hilft auch kein dicker Geldbeutel mehr. Da muss einem dann schon jemand wie der Schneekönig zur Hand gehen. Oder wie sonst sollte die Mutter aller Probleme gelöst werden können? Mit Salben, irgendwelchen Streckgeräten oder Vakuumpumpen? Wers glaubt wird selig und kann sich ja gleich von der blöden Dildofee bedienen lassen. Von den besonders Wagemutigen werden sogar riskante Operationen in Erwägung gezogen. Und das an der virilsten Stelle des befruchtenden Geschlechts. Das muss man sich mal vorstellen! Keine Sturmspitze hat es verdient, dermaßen unsanft behandelt zu werden! Wo früher – um ein bisschen Eindruck zu schinden – vielleicht einmal eine Banane strategisch günstig in der Hose platziert wurde, scheuen leidgebeugte Zeitgenossen heuer nicht einmal die obskursten medizinischen Kundendienste. Fortschritt nennt sich so etwas. Die horrenden Kosten für diesen hanebüchenen Unsinn spielen im Zeitalter der Null-Prozent-Finanzierung offensichtlich auch keine Rolle mehr. Allein der Gedanke an die Schmerzen, ganz zu schweigen die Vorstellung vom Megagau einer etwaigen Funktionsstörung, müsste doch die Querdenker unter den Zukurzgekommenen über Alternativen nachdenken lassen. Mann hat doch nur den einen, jeder für sich ein liebenswertes Unikat. Ersatz dafür ist selbst im Baumarkt nicht zu bekommen. Er freut sich über jede Streicheleinheit. Nur so kann er sich in seiner ganzen Pracht entfalten. Auch das ist ein Naturgesetz. Perfekt wäre es, Mann hätte ein Reservedings zur Verfügung. Dann könnte man die zwei miteinander bekannt machen. Keiner bräuchte sich einsam zu fühlen. In Zeiten, wo die falsche Neun und die Doppel-Sechs in aller Fußballer Munde sind, würde eine Doppel-Neun für gewaltigen Wirbel sorgen. Was Klose nicht schafft erledigt Poldi und umgekehrt. Ja, man könnte den Dingsen sogar einen Namen geben. Sie dürften sich nur nicht im Wege stehen.
Poldi müsste nach links rücken!
Der Bierbudentester
Jahr für Jahr, immer genau vierzig Tage nach Ostern, feierten wir die Himmelfahrt des Herrn Jesus wie es sich für anständige Väter gehört: auf die volkstümliche Art. Am Vormittag marschierten wir beizeiten los. Es war nur natürlich, dass wir möglichst viel vom Tag haben wollten. Der lästigen Obhut unserer Frauen entflohen, ließ es sich trefflich entspannen. Eine weibliche Begleitung war allerdings ausdrücklich erwünscht. Die ersten Jahre hieß sie Daisy. Nach Daisys Gang über die Regenbogenbrücke schloss sich Gigi, die Hündin meines Lebens, unserer Truppe an. Die Stopps auf unseren Vatertagstouren waren fast immer die gleichen. An der Ski- und Wanderhütte Kirrberg rissen wir die ersten kühlen Blonden nieder. Meist an einer der wuchtigen Holzgarnituren im Freien, mit Panoramablick ins Tal. »Runter mit euch, ihr Schlampen habt es nicht anders verdient! Prost, Saardéros!« Hier oben spendierte Ronny unserer unterwegs fleißig Stöckchen apportierenden Beschützerin regelmäßig eine Bratwurst mit Weck. Diese Belohnung stand ihr genauso zu, wie die geschmackliche Verfeinerung der viel zu klaren Brühe im Hundenapf. An Christi Himmelfahrt gehörte ein Schuss Bier ins Wasser. »Mmmhhh, fein, das hat sich unser Mädchen verdient.«
Statt einer Belohnung wäre eines schönen Vatertages eine Tracht Prügel nur recht und billig gewesen. Nicht für Gigi, wohl aber für deren angesäuseltes Geleit. Wie konnten wir nur so leichtsinnig sein und einen fast mannshohen Strohballen auf dem Weg zu unserem nächsten Etappenziel vor uns her wälzen? Einige Jahre bevor die Rixdorfer Künstlerkolonie in Berlin-Neukölnn eine alte Tradition wieder aufleben ließ:
»Was genau meinen die böhmischen Kolonisten, wenn sie Popráci sagen?« Der deutsche Dorfschulze wollte im Sommer 1737 vom Pfarrer wissen, warum die deutschstämmigen Rixdorfer bei ihren Versuchen, mit den böhmischen Kolonisten besser in Kontakt zu kommen, immer nur Popráci als Antwort zu hören bekamen. »›Feierabend‹, Fetzke. Popráci bedeutet soviel wie ›Feierabend‹ oder ›nach der Arbeit‹.«
»So kann es nicht weitergehen, Bohumil!« Der Dorfschulze und sein böhmischer Kollege waren sich einig. Sie mussten unbedingt etwas unternehmen. Bei einem Teil der deutsch-böhmischen Dorfjugend reichte oft schon ein falscher Blick, ein missverstandenes Wort oder eine läppische Geste, um sich gegenseitig die Knochen zu brechen. Als Friedrich Fetzke und Bohumil Pachl in der Spandauer Vorstadt heimlich bei Kaffee und Kuchen das Problem besprachen, kam Fetzke beim Stochern in seiner Biskuit-Rolle die Erleuchtung.
»Mensch, Bohumil, ich habs! Wir werden die Jungs Strohballen durchs Dorf rollen lassen. Die Gewinner erhalten zwei Golddukaten.«
»Gute Idee, Fritz! Lass es uns ›Popráci, das erste Rixdorfer Strohballenrollen‹ nennen!«
Der Wettkampf mit Musik, Tanz und Bewirtung avancierte zum Klassiker. »In Rixdorf is Musike« hieß es genau einhundertvierundsiebzig Mal. Bis Kaiser Wilhelm II. im Januar 1912 auf die glorreiche Idee kam, Rixdorf in Neukölnn umzubenennen und Popráci zu verbieten.





























