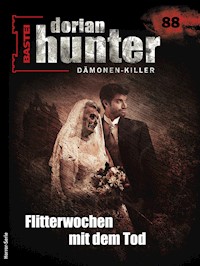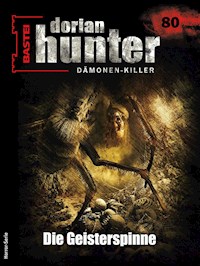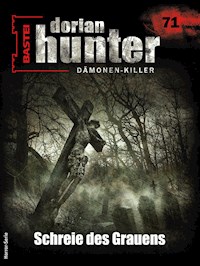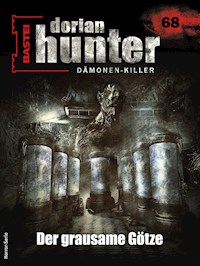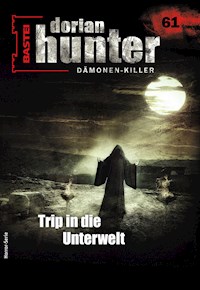
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Ich war ein naiver, ahnungsloser Mann. Doch bisher war ich immer in der Lage gewesen, zwischen meiner Phantasie, den Geschehnissen in meinen Romanen und dem wirklichen Leben zu unterscheiden. Absolut klar und perfekt. Darum ließ ich mich von Fortunatos Worten auch nicht verrückt machen.
»Sie sollten Ihre Schreibmaschine nehmen und die Insel verlassen. Das andere, dort draußen im Maestrale und bei Vollmond, ist stärker.«
»Das andere?«
»Sie sind gezeichnet, Arnoldo. Jeder, der sich mit ihnen abgibt, ist gezeichnet. An Ihnen haftet der Geruch eines Verdammten ...«
Dorian ist dem Theriak verfallen - und hat seinen kompletten Vorrat des Gegenmittels Taxin-Theriak aufgebraucht, um den Dämon Lucius of Alkahest zu vernichten. Von der Gier nach Theriak getrieben, begibt sich der Dämonenkiller nach Sardinien und begegnet dem Schriftsteller Arnold Valgruber, der ebenfalls ein Opfer der Dämonen zu werden droht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Was bisher geschah
TRIP IN DIE UNTERWELT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0643-8
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen. Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Zurück im »Alltag«, konzentriert Dorian sich wieder auf die Dämonenjagd. Doch der Schmerz, seinen Sohn nicht sehen zu können, verleitet ihn schon bald zur Einnahme von Theriak – einer magischen Droge, die eine geistige Verbindung zu seinem Sohn herstellt. Allerdings versäumt Dorian, rechtzeitig das Gegenmittel einzunehmen. Hoffnungslos dem Gift verfallen, bricht er nach Sardinien auf, wo angeblich ein Salz zu finden ist, das zur Herstellung von Theriak nötig ist ...
TRIP IN DIE UNTERWELT
von Hivar Kelasker
Nasskalter März auf Sardinien – das war für mich eine schlecht zu schildernde Mischung aus unentwegtem Frösteln, totaler Einsamkeit und einer Reihe von betäubend schönen Tagen. Dieses Jahr hatte schon so widerwärtig angefangen, dass es nur noch besser oder interessanter werden konnte. Ich war schon seit Tagen nur ein schlechter Witz meiner selbst.
Heulend strich der Mistral aus Korsika um die Mauern des Hauses. Die Schafe drängten sich mit nassen Fellen eng aneinander. Zwischen den dahintreibenden Wolken sickerte sekundenlang Mondlicht hindurch und beleuchtete die ausgewaschenen Felsen der Gallura. Mondlicht glänzte auch auf dem blau schimmernden Stahl der Lupara, der abgesägten Schrotflinte des Fuorilegge, des bärtigen sardischen Banditen im stinkenden Schafspelz. Nini Ruzittu wartete.
Angewidert betrachtete ich die ersten Zeilen des Manuskripts. Es war schätzungsweise der dreizehnte Anfang. Zwölf Vorgänger, ähnlich miserabel, lagen zerknüllt im Papierkorb.
1. Kapitel
Ich hob das Glas und trank einen Schluck Rose di Cannonau. Das Glas hatte ich in Genua gekauft, als ich – wie üblich – drei Stunden auf die Fähre warten musste. Der Wein war sardisch. Auch das Zimmer war sardisch eingerichtet, und meine Stimmung hatte einen Tiefpunkt erreicht, den ich ebenfalls nur als sardisch bezeichnen konnte. Ich kam einfach mit meiner Arbeit nicht voran. Das heißt, ich fand nicht einmal einen einigermaßen passablen Anfang.
Mein Verleger hatte sich darauf versteift, von mir einen möglichst schauerlichen Gruselroman zu bekommen – natürlich für ein Hungerhonorar. Na ja, die Honorare reichten wenigstens aus, um einen Junggesellen mit mäßig hohen Ansprüchen zu ernähren; sie reichten auch, um jeweils von Ostern bis etwa zum Spätsommer dieses ausgebaute sardische Bauernhaus zu mieten und hier zu leben. Innerhalb der dicken Natursteinmauern gab es inzwischen immerhin Strom und sogar – aus einem Boiler kommend – heißes Wasser.
Die Gallura, der nördliche Teil der Insel, war von einer Schönheit, die kaum einen Menschen unberührt lässt. Aber nicht in dieser Märznacht. Draußen heulte tatsächlich ein wütender Sturm. Ich war völlig allein mit meiner Weinflasche, den Zigaretten, der alten, klapperigen Schreibmaschine und dem Kofferradio. Der Sturm jaulte im Kamin und drückte immer wieder Rauch in den lang gestreckten Raum mit den fünf Fenstern und der einen Tür. Am liebsten hätte ich mitgeheult; wenn ich auch noch an Angela dachte, an die junge Frau mit der geradezu unglaublichen Figur, bekam ich auf der Stelle – zu einem Viertel ohnehin betrunken – das heulende Elend. Wie gesagt, im März kann Sardinien die reinste Hölle sein.
»Verdammter Mist!«, sagte ich laut in das Konzert hinein, das vom französischen Sender aus Korsika ausgestrahlt wurde.
Meine Worte störten die Harmonie der Klänge. Ich hob das Glas, das rätselhafterweise immer voll war, trank einen Schluck und warf der Schreibmaschine einen Blick voller Verachtung zu; einen dieser unzähligen verachtungsvollen Blicke dieser qualvollen Tage. Einer meiner wenigen sarkastischen Schriftstellerfreunde hätte gesagt, ich befände mich in einer künstlerischen Krise.
Ich stand auf, zündete mir die vierzigste Zigarette dieses langen, erbärmlichen Tages an, hustete, trank wieder einen Schluck. Dann zog ich die orangefarbene Segeljacke an und rollte die Kapuze halb auf. Ich wusste, dass wir morgen Vollmond haben würden, und ließ die Taschenlampe auf dem Sims mit den bunten Kacheln stehen. Langsam öffnete ich die Tür, die mir ein Windstoß fast aus der Hand riss. Sie knarrte noch immer, obwohl ich sie in jedem Urlaub immer wieder ölte.
Der Sturm schmiss sie zurück ins Schloss.
In der Ferne schrie laut ein Tier; es hörte sich wie ein Esel an. Jetzt fehlte nur noch, dass wirklich ein sardischer Bandit auf mich lauerte. Unsinn! Regentropfen klatschten fast waagrecht in mein Gesicht; der Sturm riss glühende Funken aus der Zigarette.
Ich ging an der Mauer entlang und blieb unter den drei Pinien stehen, die ihre vertrockneten Nadeln nach mir warfen. Eine phantastische, im Mondlicht schauerlich wirkende Landschaft enthüllte sich meinem Blick. Selbst in diesem Regensturm – dem seit drei Tagen tobenden Mistral – sahen die Felsen, die raschelnden Büsche der Mittelmeermacchia und die wenigen Bäume hinter S'Isuledda wie eine von Salvador Dali erdachte Filmkulisse aus.
Das Haus in meinem Rücken stand fast auf der Spitze eines Hügels, der von zwei Reihen unregelmäßiger riesiger Felsklötze gesäumt war.
Dort, wo ich stand, begann ein Dreieck, das unten an der Brandung am breitesten war. Rechts befand sich die unbefestigte Straße, die nie in ihrem Leben Asphalt gesehen hatte und die nächsten Jahrzehnte auch wohl kaum kennenlernen würde.
Einen Schauerroman sollte ich schreiben. Die Landschaft, der Wind und die Regenwolken vor dem Mond sollten mich eigentlich inspirieren, wohl auch die aufgewühlten Wellen dort unten, deren gleichmäßiges Rauschen meinen Schlaf begleitete.
Wieder dachte ich an Angela Puddu, die schöne Sardin. Und wieder schrie dort hinten, in der Richtung, wo der Ort Palau lag, qualvoll und lange ein Tier.
Ich bekam eine Gänsehaut. Wenn ein Esel schreit, dachte ich, dann hört es sich immer so an, als ob er lebendig gehäutet werden würde.
»Da stehst du nun, James Ving«, sagte ich und hörte nicht einmal meine eigenen Worte, weil der Sturm sie mir von den Lippen riss.
Ich warf die Zigarette fort.
James Ving war mein Pseudonym. Eigentlich hieß ich Arnold Valgruber, ein Name, den meine sardischen Freunde nur mit Schwierigkeiten aussprechen können. Mit zweiunddreißig Jahren hätte ich eigentlich über derartige Stimmungstiefs erhaben sein und versuchen müssen, ein einigermaßen anständiges Manuskript herzustellen; aber es war zum Verrücktwerden. Ich schaffte einfach weder einen guten Anfang, noch wusste ich eine Handlung, die gut durchkonstruiert und glaubhaft war. Dabei war das hier der richtige Platz, um mich zu inspirieren. Sämtliche Zutaten waren vorhanden. Ich brauchte mich nur umzusehen.
Eine schauerliche, fremdartige Musik wehte von irgendwoher zu mir herüber. Der Wind schleppte die abgehackten Töne mit. Sie kamen aus Nordwesten, aus der Richtung von Liscia Ruja.
Angela war eine Sardin mit weicher, brauner Haut und hellbraunem Haar, was eine Seltenheit zwischen fast ausnahmslos schwarzhaarigen Menschen war. Im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen war sie groß und schlank. Dreiundzwanzig oder vierundzwanzig Jahre alt. Ich sah sie fast jeden Tag an der Kasse des kleinen Geschäftes, wo sie saß, mich ansah und durch mich hindurchblickte, aber ich wusste, dass sie mich schon an meinen Schritten erkannte.
Ich verließ den geschützten Platz unter den raschelnden Pinien und tappte geduckt zwischen den Felsen und der langen Mauer auf die Granittreppe, die zum höchsten Punkt des Hügels führte, zu. Der Wind riss an mir, aber er vertrieb den Geschmack der Zigaretten aus meinem Mund.
Ich kam immer dann hierher, wenn ich glaubte, durch Ruhe und Einsamkeit und umgeben von einer ursprünglichen Natur zu mir zu finden, um gut arbeiten zu können. In der Regel traf dies auch zu, denn die Ablenkungen waren hier ziemlich gering. Kaum jemand besuchte mich, aber ich konnte jederzeit mit meinem kleinen Fiat überall hinfahren, Geselligkeit erleben, Menschen sehen und mit ihnen sprechen.
Die Musik wurde lauter. Hier oben verwandelte sich der Wind in ein gleichmäßiges Stöhnen. Ich sah undeutlich zwischen den Feldern kleine Lichter schwanken. Was war dort los? Ich blickte genauer hin, erkannte aber keine Einzelheiten.
»Verdammt!«, knurrte ich, unschlüssig, wie ich die Nacht verbringen sollte.
Ich konnte vor dem knackenden, lodernden Kaminfeuer lesen, mich betrinken, gleich ins Bett gehen oder noch einmal versuchen, einen einigermaßen plausiblen Anfang zu erfinden.
Normalerweise schrieb ich ein Manuskript in einem halben Monat nieder – plus einiger Tage Bearbeitung. Aber ich hatte noch keinen richtigen Leitfaden für diesen Roman. Ich besaß mindestens dreißig Szenen von starker Aussagekraft, aber mir fehlte das verbindende Element. Vielleicht sollte ich mich wirklich betrinken, denn erfahrungsgemäß kam ich nicht weiter, wenn ich es allzu angestrengt versuchte.
Ich warf einen letzten langen Blick auf die Szenerie unter mir. Der Golf von Arzachena war weiß von den Schaumkronen des aufgewühlten Meeres. Es roch nach Salzwasser. Die vor dem fast vollen Mond treibenden Wolken veränderten ständig ihre Form. Einzelne Sterne funkelten auf und erloschen. Hin und wieder strahlten die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos die verkrüppelten Bäume an. Und der Leuchtturm von Capo Farru schickte seinen spitzen Lichtstrahl unablässig über das Meer und das Land. Weit und breit war kein einziges erleuchtetes Fenster zu sehen. Um Mitternacht schlief ganz Sardinien.
Oder doch nicht?
Der Esel schrie nicht mehr. Dafür begleiteten die Musik jetzt dumpfe Schreie, und die Lampen schaukelten noch immer über die Felder.
Diese Atmosphäre hätte mich an sich zum Schreiben anregen müssen; aber ich war wie gelähmt. Passierte mir nie – oder jedenfalls so gut wie nie, dachte ich, als ich mich gegen den Sturm stemmend die ausgewaschenen und seit Jahrhunderten ausgetretenen Stufen der Treppe hinuntertastete.
Endlich erreichte ich den schmalen Lichtspalt, der unter der Tür hervorsah. Rauchige Luft und der Geruch nach Zigaretten und schalem Wein schlugen mir entgegen, und es roch auch nach dem alten Gemäuer, das fast siebzig Jahre alt war.
Ich schloss die Tür, zog den Ersatzregenmantel aus, setzte mich, rauchte eine Zigarette und starrte das weiße Blatt in der Maschine an.
Nichts.
Ich schrieb einen dreizehnten oder vierzehnten Anfang. Irgendwo in meinem Schädel entstand eine Idee, doch sie verschwand so schnell, dass ich gar nicht richtig mitbekam, dass ich soeben einen roten Faden für die Handlung gesehen hatte.
Plötzlich ein leises, aber forderndes Pochen an der Tür. Der Mann im feuchten und muffigen Schafspelz fuhr hoch und griff zu der Waffe.
Als ich unterbrach und nach dem Weinglas griff, pochte es an die Tür.
Ich erschrak, hielt mitten in der Bewegung inne. Zwei Sekunden lang wagte ich nicht zu atmen. Die Zigarette verqualmte im Aschenbecher. Dann klopfte es erneut. Ich sprang auf. Im gleichen Moment verzischte ein Harztropfen oder ein Wassertröpfchen im Feuer.
Ich zuckte zusammen. Der Stuhl fiel polternd um, und dann war ich an der Tür und riss sie auf – viel zu schnell.
Ich traute meinen Augen nicht.
»Angela!«, sagte ich und ließ pfeifend die Luft aus den Lungen. »Angela, was tust du hier?«
Ohne zu überlegen, hatte ich sie geduzt. Sie schien es nicht zu merken. Mit ihren fahlblauen Augen, die fast gletscherhaft und milchig wirkten, sah sie mir direkt ins Gesicht. Sie trug einen Schaffellmantel, das Leder nach außen gekehrt.
Ich ergriff ihre eine Hand und zog sie in den schmalen Eingang des Hauses. Sie schüttelte den Kopf. Haarsträhnen, die unter ihrem Kopftuch hervorsahen, waren nass.
»Ich muss dich warnen, Signore Valgruberre«, sagte sie leise, aber eindringlich. Meinen Namen sprachen sie hier immer so oder noch schlimmer aus.
»Ich bin Arnoldo«, sagte ich und nahm ihr den schweren Mantel ab; durch die Nässe wog er noch mehr. »Warnen? Wovor? Komm, trink einen Schluck Wein!«
Ich nahm ihre Hand. Ihre Finger waren warm, aber seltsam leblos. Sie erwiderten den Druck meiner Hand nicht. Ich zog Angela in die Richtung des Feuers. Sie bewegte sich mit traumwandlerischer Sicherheit. Ich packte sie leicht an den Oberarmen, drückte sie in den Schaukelstuhl links von der Kaminöffnung und sagte: »Du siehst verstört aus. Hat dich jemand erschreckt?«
Ohne auf ihre Antwort zu warten, füllte ich ein zweites Glas halb voll und drückte es in ihre Hand. Angela war seit ihrem neunten Lebensjahr blind. Ihr Vater hatte nicht Acht gegeben, als er voller Begeisterung das Haus baute. Kalk war in ihre Augen gekommen, der Netzhaut zerstörende Dampf, der aus ungelöschtem Kalk aufsteigt, wenn man ihn wässert. Die blinde junge Frau mit dem dicken, langen Haar und dem mandelförmigen Gesicht drehte den Kopf herum und sagte: »Ich bin gekommen, um dich zu warnen, Signore Arnoldo.«
Es war unglaublich. Die alte und arme, dafür aber ausgesprochen stolze und etwas mittelalterliche Familie, aus der sie kam, wäre mehr als nur entsetzt gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass ihre unberührte Tochter nach Mitternacht das Haus eines Fremden besuchte. Aber Angela entzog sich jeder Beurteilung. Sie war eine merkwürdige Frau. Oft war sie tagelang verschwunden; niemand sah sie gehen oder kommen, aber immer wieder kehrte sie unversehrt und offensichtlich glücklich zurück.
»Wovor willst du mich warnen?«, fragte ich.
Sie ließ die Hände mit dem Glas in ihren Schoß sinken. Angela trug enge Jeans und einen Pullover, der ihren Körper modellierte. Ihre Figur war ohne jeden Makel.
»Ich mag dich, Arnoldo!«, sagte sie und lächelte verloren.
Trotz der blinden Augen hatte ihr Gesicht eine überraschend große Ausdrucksfähigkeit. Ich begann dumpfe Furcht zu spüren. Die Familie war immer besorgt, sie vor allen fremden Einflüssen zu bewahren. Sie las, das hatte man mir gesagt, ungeheure Mengen in Blindenschrift und sprach ziemlich gut Deutsch und Englisch; sie hatte es im Selbststudium erlernt.
»Das sollte dein Vater besser nicht hören. Ich kenne die Patronen, mit denen er Ostern auf Orangen schießt. Ich will sie nicht im Bauch haben.«
Sie trank einen gewaltigen Schluck Wein, als sei sie kurz vor dem Verdursten. Als sie das Glas absetzte, zitterten ihre Finger.
Ich zündete mir nervös eine Zigarette an und leerte die Flasche ins eigene Glas.
»Mein Vater – er weiß nicht, wo ich bin. Aber sie werden kommen, Arnoldo. Sie suchen dich. Sie kommen und werden dich brandmarken wie einen Stier.«
Ich glaubte, mich verhört zu haben. Brandmarken? Mich? Schließlich zahlte ich Miete, und nicht eben wenig.
»Wer sind sie?«, fragte ich verblüfft.