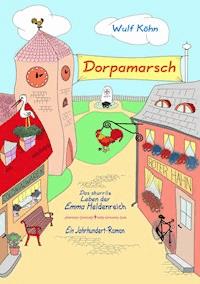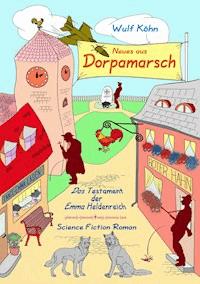Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dorpamarsch
- Sprache: Deutsch
Das kleine Dorf "Dorpamarsch" in Norddeutschland ist so unbedeutend, dass seine Einwohner es auch manchmal als "Dorp am Arsch" bezeichnen. Es zeichnet sich aber durch seine skurrilen Einwohner mit ungewöhnlichen Einfällen aus - also Menschen, wie du und ich. Bekannteste Einwohnerin war Emma Heldenreich, welche den nach ihr benannten ersten "Tante-Emma-Laden" erfand, der schließlich sogar zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Ihr Lebensretter und Haupterbe "Raupe" setzte die Tradition des Ladens fort und machte mit einer Reihe Erfindungen das Dorf weltberühmt. Er entdeckte unter anderem auch die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, um die Welt vor ihrem Untergang zu retten. Die Handlung um Dorpamarsch wird in drei Bänden "Dorpamarsch", "Neues aus Dorpamarsch" und "Dorpamarsch Forever" geschildert (alle als EBook erhältlich) und umfasst die Jahre 1900 bis 2070. Wir können uns also auf einen interessanten Einblick in die Zukunft freuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wulf Köhn
Dorpamarsch Forever
Die Flaschenpost der Emma Heldenreich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
2050 - Der Olm
Wir haben gerade ein Schiff versenkt
Die Flaschenpost
Flying City
Fritz
Jennifer
Raupes Testament
Dorpamarsch – Forever
Raupe ist unverzichtbar
Die Post wird zugestellt
Die Reise nach Dorpamarsch
Die verräterischen Fingerabdrücke
Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart
Ein neuer Anfang
1929 – Das Schicksal Wilhelmine Heldenreichs
2054 - Das Moorbad
Eine haarige Angelegenheit
2060 - Jetzt wird es kompliziert
Der perfekte Doppelgänger
1965 – Reise ins Gewölbe
Gespräch zu dritt
1965 – Drei Münzen im Keller
2021 – Die Begegnung
Hermines Lebenspartner
Das große Krabbeln
2016 – Die Pläne in der Schublade
2023 – Falschgeld
2061 – Staatsbesuch
2025 – Der Lottogewinn
1989 – Lydia wird’s schon richten!
2062 – Hallo Kitty
Nichts als Ärger mit Apophis
1941 – Torfstecher trifft Emma
Little Apophis
1941 – Gefangen in der Zeit
Der Judenstern
Zirkus Bonelli
Mit dem Flohzirkus unterwegs
Das Ende einer Freundschaft
Familie Torfstecher
Die Flucht nach Dorpamarsch
Ohne Hoffnung – ohne Zukunft
Der Schatz im Wald
2064 - Lunar 21 sendet wieder
Die letzte Etappe
2070 – Torfstecher geht nicht allein
1885 – Die Burg des Raubritters
Jennifers Spaziergang
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Vorwort
Hallo Jennifer, ich habe eine Aufgabe für dich.
Du musst die Welt retten!
Fritz
Der dritte Band der Dorpamarsch-Reihe ist der Abschluss der Dorpamarsch-Trilogie, bestehend aus den Büchern
Dorpamarsch – Das skurrile Leben der Emma Heldenreich,
Neues aus Dorpamarsch – Das Testament der Emma Heldenreich,
Dorpamarsch Forever – Die Flaschenpost der Emma Heldenreich.
Während der erste Band das ereignisreiche Leben Emma Heldenreichs im gesamten 20. Jahrhunderts schildert, endet der zweite Band im Jahre 2050, also bereits in der Zukunft, der dritte reicht bis ins Jahr 2070.
Es ist unvorstellbar schwierig, sich als Autor vorzustellen, wie unsere Welt in 50 Jahren aussieht, wenn man bereits während des Schreibens feststellt, dass die technische Entwicklung – insbesondere auf dem Gebiet der Kommunikation – schneller fortschreitet als man sich das vorstellen kann. Manche meiner Überlegungen von einer vielleicht übertriebenen Zukunftsversion wurden auf diese Weise bereits in der Planungsphase überholt.
Im letzten Absatz des Vorwortes zum „Testament der Emma Heldenreich“ schlug ich dem Leser vor, am Ende des Jahrhunderts gemeinsam zu prüfen, ob meine Zukunftsfantasien eingetroffen sind.
So lange müssen wir in vielen Bereichen nicht mehr warten. Ich habe deshalb bereits im zweiten Band ein Thema aufgegriffen, das ich im dritten Band fortsetzte, und über das man bis heute nur spekulieren kann: Sind Zeitreisen möglich?
Das Buch „Dorpamarsch – Die Flaschenpost des Emma Heldenreich“ beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage und führt den Leser weit in die Zukunft, aber auch zurück in die Vergangenheit und deckt auf diese Weise Zusammenhänge innerhalb des Romans auf, die zu immer neuen verblüffenden Erkenntnissen führen.
Es wird deutlich, dass alle drei Bände der Emma-Heldenreich-Trilogie eine Einheit bilden – fast wie ein geschlossener Kreislauf.
Und noch ein Tipp: Wem die eine oder andere Entwicklung zu kompliziert erscheint, sollte es einfach so hinnehmen. Es lohnt sich aber auch, die logische Handlung zu überprüfen. Ich habe alles sorgfältig recherchiert.
Ich wünsche allen Lesern mindestens so viel Spaß beim Lesen, wie ich beim Schreiben hatte.
Wulf Köhn, Mai 2017
2050 - Der Olm
Er schlurfte durch die halbdunklen Gänge, in welche niemals Tageslicht drang. Er kannte es nicht anders, jedenfalls nicht in den vergangenen 36 Jahren. Doch er war zufrieden damit. Das war seine Welt. Dafür hatte er sogar auf die Kellerzulage verzichtet. Vor 20 oder 30 Jahren hatte man festgestellt, dass sein Schreibtisch genau genommen etwa einen halben Meter oberhalb des Straßenniveaus stand. „Das ist kein Keller“, hatte man gesagt und die Kellerzulage für Arbeitsplätze in Kellerräumen gestrichen, obwohl niemals etwas Tageslicht in die Katakomben des Geheimarchivs eindrang. Vorschrift ist nun mal Vorschrift. Er hätte natürlich seinen Arbeitsplatz auch in einem tiefergelegenen Raum einrichten können. In dieser Entscheidung war er vollkommen frei. Er hatte gar keinen Vorgesetzten, abgesehen von der allgemeinen Verwaltung, die auch für alle anderen Bediensteten der Royal Navy zuständig war. Doch diese Behörde gab es praktisch nicht mehr.
Mit der Abdankung des letzten britischen Königs „William V., gab es keine „Royal“ Navy mehr. Sie war nur noch Teil der „Internationalen Friedensarmee“, zu welcher sich die mächtigsten Staaten der Erde USA, Türkei und Großbritannien zusammengeschlossen hatten.
Dabei wurden die US Navy und die Royal Navy dem türkischen Sultanat unmittelbar unterstellt. Das geschah selbstverständlich auch in Einvernehmen mit dem bis dahin mächtigsten Mann der Welt, dem US-Präsidenten Dagobert D. Trumpel. Das war der Enkel des legendären Großmauls, der Dank des skurrilen Wahlsystems der USA mit nur 365 Stimmen die Mehrheit errang. Der Einfachheit halber hatte er sofort nach seinem Sieg unter anderem das präsidiale Erbrecht in den USA nach Vorbild des Türkischen Großreichs eingeführt. Die Amerikaner nahmen es hin, solange man ihnen ihre privaten Waffen ließ.
Was sollten sie auch gegen eine Vereinigung aller Waffensysteme zu einer „Friedensarmee“ einzuwenden haben?
Aber das jetzt alles auseinanderzupflücken, würde hier wirklich zu weit führen, zumal Sir Matthew Olmenburg, der Hüter des Geheimarchivs seiner königlichen Majestät, nichts mehr damit zu tun hatte.
Genauer gesagt, existierte dieses Archiv auch gar nicht mehr, denn ohne König gab es auch kein königliches Archiv. Als das FCO (Foreign and Commonwealth Office) in das ehrwürdige Old Admiralty House in White Hall einzog, wusste man nicht, wohin mit dem Geheimarchiv im Keller. Man konnte es ja nicht einfach so mitnehmen.
Also beließ man es an Ort und Stelle, gemeinsam mit einer Handvoll Archivverwalter und der Aufgabe, das Archiv aufzulösen.
Doch niemand wusste so genau, was in dem weitverzweigten System unterirdischer Räume und Gänge lagerte. Was einmal dort abgelegt war, blieb für alle Zeit verschwunden, denn es durften keinerlei schriftliche Aufzeichnungen vorgenommen werden. Nur so war absolute Geheimhaltung möglich. Die einzigen Sicherheitslecks waren die Gedächtnisse der Archivverwalter, die sich noch eine Zeit lang an das eine oder andere erinnerten. Es gab deshalb auch nur wenige Amtsträger, die meist für den Rest ihrer Dienstzeit in die Katakomben verbannt waren.
Olmenburg war der letzte von ihnen. Vor 36 Jahren wurde er in das Geheimarchiv versetzt und zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Das war ihm eine Ehrenpflicht, und so nach und nach hatte er sich vom einfachen Vorsortierer über den Einstapler bis zum Abstauber hochgearbeitet. Das waren natürlich nicht die offiziellen Funktionsbezeichnungen, die recht einfallslos als GehAPf, das war die Abkürzung von Geheimer Archiv Pfleger, bezeichnet wurden. Dahinter stand dann noch eine Klasse, welche die Bedeutung der Tätigkeit hervorhob. Der Vorsortierer war Klasse 1, der Abstauber aber schon Klasse 5. Dazwischen gab es noch weitere Klassen, doch das würde zu weit führen, sie hier alle zu erklären. Sie trafen für Olmenburg ohnehin nicht zu, der inzwischen die Klasse 10 erreicht hatte. Zu diesem Anlass hatte ihn der König in den Adelsstand erhoben. Auf das „Sir“, das er seitdem tragen durfte, war er besonders stolz, vor allem, weil er gleichzeitig auch Chef der Abteilung geworden war. Seine Kollegen sahen das mit weniger Respekt. Sie nannten ihn weiterhin „Olm“, in Anspielung auf seinen Namen in Verbindung mit seiner Gewohnheit, wie ein Grottenolm durch die Gänge zu schleichen. Da sie ausnahmslos älter waren als er, wurden sie auch vor ihm pensioniert und nicht ersetzt, bis Olmenburg zum Schluss als einziger übrig blieb.
Jeden Morgen verließ er pünktlich um 08.35 Uhr mit der schwarzen Melone auf dem Kopf, dem Regenschirm in der linken Hand und der Aktentasche unter dem linken Arm, das Haus. So hatte er immer seine rechte Hand frei, um die anderen Bediensteten zu grüßen, die mit ihm dem Old Admiralty House zustrebten.
Doch während die anderen ihre mehr oder weniger komfortablen FCO Büros in den oberen Etagen aufsuchten, benutzte er eine schmale Kellertreppe nach unten, die zu einer schweren Sicherheitstür führte. Nur er besaß einen unhandlichen Schlüssel dazu, um sie zu öffnen. Gewissenhaft sperrte er hinter sich wieder zu. Sollte ihn da unten einmal das Schicksal ereilen, gäbe es keine Möglichkeit, in diesen abgeschlossenen Teil einzudringen. Die dicken Betonmauern würden jeder Sprengung widerstehen. Es würde ihn auch niemand vermissen, außer vielleicht seine Wirtin, die ihm jeden Tag einige Sandwichs und die Thermoskanne mit Tee in die Aktentasche packte. Aber was wollte sie schon machen? Alles an ihm war geheim. Das war das Einzige, was sie wusste. Sie würde ihn noch nicht mal als vermisst melden, solange die Zimmermiete monatlich eintraf.
Wir schreiben das Jahr 2050, und vor zwei Jahren hatte der Zentralcomputer der Verwaltung ihn mit Erreichen der Altersgrenze in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Das bekam kein Mensch mit, aber so stand es auf der Entlassungsurkunde, die man ihm ins Postfach legte, und die jetzt an der Wand gegenüber seinem Schreibtisch hing.
Doch niemand kam auf die Idee, ihn aus seiner Funktion als oberster Geheimhalter des Geheimarchivs zu entlassen. So machte der Olm einfach weiter. Was sollte er auch zu Hause tun? Den ganzen Tag Zeitung lesen oder spazieren gehen?
Nein, hier in den düsteren Gängen – und inzwischen fast leeren unterirdischen Räumen – war seine Berufung. Er hatte sich vorgenommen, auch die allerletzten Geheimnisse des Geheimarchivs zu lüften, ohne genau zu wissen, was er dann damit anfangen sollte. Darüber konnte er sich später Gedanken machen.
Im Augenblick war er dabei, einen merkwürdigen Hinweis aus der Akte „Lusitania“ zu verfolgen.
Das britische Passagierschiff „Lusitania“ war am 7. Mai 1915 von einem deutschen U-Boot abgeschossen und versenkt worden. Unter den 1198 umgekommenen Menschen befanden sich auch 124 Bürger der Vereinigten Staaten Amerikas, welche sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Kriegszustand befanden. Deutschland behauptete damals, dass sich an Bord der Lusitania Geschütze befanden, ferner habe sie Waffen und Munition geladen. Also hätten sie das Schiff als Kriegsschiff abschießen dürfen. Die Briten stritten das ab und meinten, es wäre ein reines Passagierschiff gewesen. Dieser Meinung schloss sich der amerikanische Präsident an und trat in den Krieg ein.
Die internationale Meinung schlug damals gegen Deutschland hohe Wellen. Was wirklich geschehen war, wusste nur die britische Admiralität, welche die entsprechenden Dokumente im Geheimarchiv verschwinden ließ.
Nur kurze Zeit später wurde dem US-Präsidenten Woodrow Wilson die Ladeliste der Lusitania zugespielt, aus der ersichtlich war, dass das Schiff große Mengen Kriegsgut mitgeführt hatte: 1248 Kästen mit 7,5-Zentimenter-Granaten, 4927 Kisten mit Gewehrpatronen, 2000 Kisten mit weiterer Munition für Handfeuerwaffen.
Wilson steckte das Schreiben in einen Umschlag, versiegelte ihn und schrieb darauf: „Nur vom Präsidenten der Vereinigten Staaten zu öffnen.“ Dann gab er Order, es im Geheimarchiv des US-Schatzamtes unter Verschluss zu nehmen. Kein Außenstehender sollte jemals erfahren, welche unrühmliche Rolle die USA gespielt hatten.
Die britische Admiralität bezeichnete den Akt dagegen als Verbrechen der Unmenschlichkeit durch die deutsche Kriegsführung und beschuldigte den Kapitän der Lusitania Turner, die Katastrophe durch eine Kursänderung verursacht zu haben. In einem Schreiben an den Richter Lord Mersey wies die Admiralität diesen sogar an, Turner als Hauptschuldigen darzustellen. Doch der Lord sprach Turner von jeder Schuld frei. Er war von der Haltung der Admiralität so angewidert, dass er sich schwor, nie wieder ein Richteramt auszuüben. Als „ein verdammt schmutziges Geschäft“ bezeichnete er die Machenschaften der Admiralität.
Trotzdem nistete sich die Legende von der unprovozierten Versenkung eines harmlosen Passagierdampfers in die Geschichtsbücher ein. Tatsächlich hatte der Erste Lord der Admiralität Sir Winston Churchill persönlich den Auftrag gegeben, die Lusitania in eine Position zu dirigieren, in der sie mit Sicherheit abgeschossen werden konnte. Er opferte bewusst 1198 ahnungslose Menschen, um die USA zum Kriegsbeitritt zu zwingen. Erst über fünfzig Jahre später wurde dieses Kriegsverbrechen durch Journalisten aufgedeckt
Soweit waren der Untergang der Lusitania und die unrühmliche Rolle, welche die britische Admiralität dabei gespielt hatte, schon lange geklärt. Doch nach der öffentlichen Freigabe verschwand die Akte wieder im Geheimarchiv. Sie war zwar nicht mehr geheim, doch wo sollte sie hin? Die Verantwortlichen der Admiralität scheuten sich begreiflicherweise, sie der historischen Sammlung zuzuführen. Vielleicht geriet der Vorfall doch einmal in Vergessenheit.
Aber Sir Matthew Olmenburg war in der Akte etwas aufgefallen. Es war ein Zettel mit einem handschriftlichen Vermerk, der sich in einer Ecke des Archivkartons verborgen hatte. Darauf stand:
„Die deutsche Kaiserliche Marine hat den Seekrieg begonnen. Es gibt einen Beweis, dass sie bereits 1912 die Titanic abgeschossen und versenkt hat. Siehe dort!“
Unterschrieben war der Zettel mit dem Kürzel des damaligen Ersten Lords der Admiralität Sir Winston Churchill mit Datum vom 12. Juli 1915. Das war kurz nach dem Untergang der Lusitania und sah fast wie eine Rechtfertigung aus.
Der Vermerk regte sofort das detektivische Interesse des Olms an. Immerhin war der Untergang der Titanic weltgeschichtlich so bedeutend, dass ihn auch heute noch – fast 140 Jahre später – jedermann kannte. Doch was war damals wirklich geschehen? Es gab kaum ein maritimes Ereignis, das so umfassend aufgeklärt worden war, wie dieses Schiffsunglück.
Aber offensichtlich gab es dabei einen Beweis, der auf die Mitwirkung der deutschen Kriegsmarine hinwies. Anders war der Hinweis: „Siehe dort!“ nicht zu deuten.
Andererseits war die Akte „Titanic“ nie geheim und lagerte deshalb auch nicht in Olms Geheimarchiv, das er seit der offiziellen Auflösung als sein Privateigentum ansah.
Er wollte sich trotzdem versichern und schlurfte durch die halbdunklen Gänge auf der Suche nach einer Akte „Titanic“.
Die meisten Regale, an denen er vorbeikam, waren inzwischen leer, doch die Jahresschilder klebten noch an den Brettern. Der Raum mit der Jahreszahl 1912 wurde nur durch eine veraltete Neonlampe ausgeleuchtet, die zudem auch noch flackerte. Alle Regale waren leer. Nirgendwo befand sich einer der üblichen Archivkartons, in denen die Ereignisse des Jahres nach Monaten und Tagen geordnet, abgelegt waren. Der Olm konnte sich auch nicht erinnern, hier jemals einen Karton mit der Aufschrift „Titanic“ gesehen zu haben.
Nachdenklich sah er an den Regalen entlang, die hier sorgfältig aufgereiht wie Soldaten standen. Wo sollte hier der angebliche Beweis sein?
Doch da fiel ihm etwas an der Ausrichtung der Regale auf. Eines stand im Vergleich zu den anderen etwas schief. Gewissenhaft versuchte Olmenburg es wieder zurechtzurücken, doch es klappte nicht. Irgendetwas schien dahinter zu liegen. Das störte sein Ordnungsbedürfnis. Möglicherweise war dort eine verreckte Ratte mumifiziert oder sogar schon versteinert. Die musste auf jeden Fall beseitigt werden.
Der Olm vergaß die Akte „Titanic“ und widmete sich vorrangig der Aktion „Fossile Ratte“. Dazu musste das ganze Regal zwischen den anderen herausgezogen werden. Das war anstrengend genug, doch schließlich hatte er es geschafft. Im trüben Licht der Neonröhre sah er wirklich einen dunklen Gegenstand, der keineswegs wie eine tote Ratte aussah. Vorsichtig bückte sich der Olm und holte eine Flasche hervor. Genauer gesagt, eine leere Sektflasche. Wie kam die denn dahin? Er konnte sich kaum vorstellen, dass hier unten ein Sektgelage stattgefunden hatte.
Olm rückte das Regal wieder zurecht und trug die Flasche in sein fensterloses Büro ohne Kellerzulage. Dort stand wenigstens eine helle Schreibtischlampe, unter der er seinen Fund besser betrachten konnte. Sorgfältig breitete er einen Zeitungsbogen aus, um die Flasche von dem anhaftenden Schmutz zu befreien. Generationen von Spinnen hatten dort ihre Netze hinterlassen, in denen die ausgesaugten Reste von Kellerasseln, Silberfischchen, Motten und anderem Ungeziefer ihre letzte Ruhestätte erhalten hatten. Voller Ekel beseitigte Olmenburg diesen Dreck und wusch sich sorgfältig die Hände unter dem Wasserhahn am Waschbecken in der Ecke – der Einfachheit halber gleich auch die Flasche.
Der Olm war ein reinlicher Mensch, deshalb wollte er sie auch von innen ausspülen, doch dann dachte er, dass vielleicht etwas darin sein könnte. Auf dem ersten Blick war sie leer. Es deutete auch kein Etikett auf den ehemaligen Inhalt hin. Es war aber unzweifelhaft eine Sektflasche, und nach der gediegenen Stärke zu urteilen, hatte sie auch keinem billigen Sekt gedient. Vielleicht sogar Champagner.
Olmenburg versuchte, durch den Flaschenhals hineinzusehen. Innen sah es genauso aus wie vorher außen. Alles voller Spinnenweben und Ungezieferleichen. Doch er konnte noch etwas anderes in dem grünen Halbdunkel erkennen. Es schien ein Stück Papier zu sein. Vorsichtig fischte es der Olm mit einer Pinzette heraus. Es war tatsächlich ein eng zusammengerollter Papierbogen, schon etwas brüchig und mit einigen Wasserflecken versehen, aber noch gut erkennbar, ein offizieller Briefbogen des „Panzerkreuzers SMS Blücher“ von der Kaiserlichen Deutschen Marine, wie man dem Briefkopf entnehmen konnte.
Darunter war ein handschriftlicher Text in einer Schrift, die Olm nicht entziffern konnte. Das sah aus wie eine verschlüsselte Nachricht und weckte sofort Olms Interesse. Für Geheimnachrichten fühlte er sich zuständig. Allerdings hatte er diese bisher nur gelagert und nicht ausgewertet.
Der Briefbogen war eindeutig von der Kaiserlichen Marine. Das Schreiben trug kein Datum, aber der Zeitraum ließ sich eingrenzen. Die „Blücher“ (Schiffe sind immer weiblich!) war Anfang des 20. Jahrhundert im Dienst gewesen, konnte er sich erinnern.
Aber aus welchem Grund hatte sie eine Flaschenpost verschickt?
Damals gab es die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten noch nicht. Das Heer hatte sogar Brieftauben verschickt, aber von einer Flaschenpost der Marine hatte er noch nie etwas gehört. Wie sollte sie auch gezielt den Adressaten erreichen? Höchstens Schiffsbrüchige taten so etwas.
Da erinnerte er sich wieder der Notiz aus der Akte „Lusitania“. Hatte er hier den angedeuteten Beweis in der Hand? Eine Flaschenpost? Wollte der Absender auf diese Weise etwas sichern, in der Hoffnung, irgendjemand würde die Flasche einmal finden?
Ohne den Text lesen zu können, kam er nicht weiter. Da musste ein Fachmann ran!
Es gab ja im Marineministerium eine ganze Dechiffrierabteilung.
Er griff zum Telefon auf seinem Schreibtisch. Das war noch so ein alter Kasten aus Bakelit mit Wählscheibe. Er hatte hier unten schon seit Jahren nicht telefoniert. Wer weiß, ob das Ding überhaupt noch funktionierte.
Mit dem Abnehmen des Hörers setzte er einen komplizierten Sicherheitsmechanismus in Gang. Davon merkte er aber nichts. Stattdessen hörte er eine Automatenstimme.
„Sie rufen von einem nicht autorisierten Endapparat an. Bitte geben Sie Ihre Berechtigung ein.“
„Ich bin Sir Matthew Olmenburg vom Geheimarchiv der Admiralität seiner Königlichen Majestät.“
Noch ehe er den Satz zuende gesprochen hatte, unterbrach ihn die Stimme: „Ich kann Sie nicht verstehen, geben Sie Ihre Berechtigung auf dem Ziffernblock ein!“
Was für ein Ziffernblock? Das Telefon hatte nur eine Wählscheibe. Und was für eine Berechtigung?
Olmenburg versuchte es erneut mündlich: „Ich möchte jemanden von der Dechiffrierabteilung sprechen!“
„Geben Sie ihre Berechtigung ein! Sie haben noch zwei Versuche!“, erwiderte der Automat unerbittlich.
Olm versuchte es erneut: „Himmel und Hölle, geben Sie mir die Vermittlung!“
„Ich kann Sie nicht verstehen! Geben Sie ihre Berechtigung auf dem Ziffernblock ein. Sie haben noch einen Versuch!“
Zum Teufel mit dem Ziffernblock! Und außerdem: Wer ist eigentlich „Ich“?
Eine Automatenstimme konnte doch kein „Ich“ haben. „Ich denke, also bin ich!“, soll wohl Hamlet gesagt haben. Oder war das Shakespeare? Ach nein, das war ja der mit dem Totenkopf. „Sein oder Nichtsein!“
Jetzt war Sir Matthew Olmenburg völlig durcheinander und legte wieder auf. Er musste mal bei Gelegenheit ein neues Telefon bestellen und nach seiner Berechtigung fragen. Hier unten schien die Zeit an ihm vorbeigegangen zu sein. Nachdenklich betrachte er erneut den geheimnisvollen Briefbogen.
Eine Etage höher war inzwischen wirklich der Teufel los. Eine Alarmsirene weckte alle Bediensteten des FCO aus ihrer mehr oder weniger eintönigen Tätigkeit.
Die Sirene verstummte aber nach zehn Sekunden wieder, dafür ertönte ein unangenehmer Alarmton, wie man ihn allgemein auf Kriegsschiffen hört, der sich alle zehn Sekunden wiederholte. Dazwischen quäkte eine Automatenstimme: „Alarm! Alarm! Nicht identifizierter Eindringling im Gebäude. Behalten Sie die Ruhe und verlassen Sie nicht ihre Arbeitsplätze. Angehörige der Sicherheitsgruppe A sammeln sich in der Eingangshalle und warten dort auf weitere Instruktionen. Achtung, das ist keine Übung!“
Von wegen „Behalten Sie die Ruhe!“. Der Alarm hatte die vorhandene Ruhe auf einen Schlag in das Gegenteil verwandelt. Es war wie der berüchtigte Stich ins Wespennest. Je nach Temperament schwankten die hochdotierten Lords und Sirs zwischen Heldenmut und „unter den Tisch kriechen“, doch niemand zeigte das so deutlich.
Wie sollte man einem „nicht identifierten Eindringling“ begegnen? Das wusste niemand, und wirklich niemand, noch nicht einmal die Stimme des Alarmsystems, die lediglich einen vorprogrammierten Alarm abspulen ließ.
Die Sicherheitsgruppe A war weisungsgemäß in der Eingangshalle versammelt. Doch wie ging es jetzt weiter?
Major Fishman war der routinemäßige Leiter, wusste aber auch nicht mehr. Zunächst ließ er die Leute erst einmal antreten und die Anwesenheit feststellen. Das konnte nicht falsch sein und brachte Zeitgewinn. Dann schrie er laut: „Kann denn das nicht jemand mal abschalten!?“
Ein Second Lieutenant rannte zur Schaltzentrale. Kurz danach verstummte die Schiffströte. Eine wohltuende Ruhe setzte ein. Nun konnte jeder auch wieder besser denken.
Der Second Lieutenant brachte auch eine Nachricht von der Schaltzentrale mit. Dort war ein weißes Licht aufgeleuchtet und hatte den Alarm ausgelöst. Was dieses Licht bedeutete, musste erst in den Handbüchern nachgesehen werden.
Fishman stand derweil mit dem Schichtführer der Alarmzentrale in Funkkontakt. Das war ein unerfahrener Lieutenant, der noch nie einen Sicherheitsalarm erlebt hatte. Er blätterte hektisch in dem dicken Handbuch, in der Hoffnung, durch Zufall den richtigen Hinweis zu finden. Gleichzeitig schrie er pausenlos sich ständig widersprechende Befehle in die Runde. Seine nachgeordneten Mitarbeiter verzichteten deshalb, irgendetwas zu tun, taten aber alle beschäftigt, blätterten ihrerseits ebenfalls in Unterhandbüchern oder drückten auf Verdacht die verschiedensten Knöpfe. Das Schalttableau erstrahlte in einer feuerwerkähnlichen Illumination.
„Ich habe etwas gefunden!“, meldete ein Staff Sergeant. „In einem alten Handbuch. Das gilt schon lange nicht mehr!“
Lieutenant Colonel Elias Brathering griff nach diesem Strohhalm und überzeugte sich selbst. Tatsächlich: Der Alarm war im ehemaligen Geheimarchiv von einem nicht autorisierten Kommunikationsapparat ausgelöst worden. Ein unbekannter Benutzer hatte sich auf Nachfrage geweigert, seine Zugangsberechtigung einzugeben. Da der gesamte Trakt des Geheimarchivs aber seit Jahren leer stand und verschlossen war, gab es nur zwei Erklärungen: Entweder gab es einen unberechtigten Eindringling oder einen technischen Fehlalarm. Beides musste geklärt werden.
Brathering gab seine Erkenntnis an Fishman in der Eingangshalle weiter. „Der Alarm kommt aus dem Trakt des Geheimarchivs im Kellergeschoss.“
Fishmann eilte mit drei Mann die schmale Treppe nach unten. Dort gab es nur eine schwergepanzerte Tür. „Schlüssel holen!“, befahl er, und einer der Männer rannte zur Schlüsselzentrale. Er kam aber ziemlich schnell ohne Schlüssel zurück und meldete, dass der einzige Schlüssel schon vor Jahren an den GehAPf Olmenburg ausgegeben worden war. Das war ordnungsgemäß im Schlüsselbuch verzeichnet.
„Dann holen Sie den Olmenburg!“, herrschte Fishman den Mann an. Doch dieser hatte mitgedacht und sich bereits erkundigt.
„Olmenburg ist seit zwei Jahren im Ruhestand“, meldete er.
„Das kann nicht sein!“, rief ein Kollege der Sicherheitsmannschaft. „Ich sehe ihn jeden Morgen auf dem Wege zum Dienst.“
„Dann muss er doch irgendwo im Hause sein!“, stellte Fishman fest.
Alle schauten plötzlich bedeutungsvoll zu der gepanzerten Tür.
„Es muss doch einen Nachschlüssel geben!“, überlegte Fishman und telefonierte erneut mit der Sicherheitszentrale.
„Es gibt noch ein Problem“, meldete sich Brathering. „Der Alarm hat einen alten Sicherheitsmechanismus in Gang gesetzt. Nun ist der gesamte Trakt hermetisch abgeschlossen und wird geflutet.“
„Geflutet?“, erregte sich Fishman, „mit Wasser?“
„Natürlich nicht!“, antwortete Brathering. Das würde ja alle Akten zerstören.“
„Ich denke, das Archiv wurde aufgelöst!“
„Das stimmt, aber als die Sicherheitsschaltung eingebaut wurde, war es noch aktiv. Die Flutung sollte alles Leben in dem Trakt vernichten. Auf diese Weise wollte man auch Erpressungsversuche oder Selbstmordattentate verhindern.“
„Wie kann man denn Selbstmord mit einer Tötung verhindern?“ schäumte Fishman.
„Ich hab die Anlage nicht gebaut“, gab Brathering beleidigt zurück. „Die Flutung erfolgt mit Stickstoff. Nach kurzer Zeit ist da unten alles tot. Sogar die Ratten.“
„Was interessieren mich die Ratten!“, brauste Fishman auf. Er behielt das Funkgerät weiterhin am Ohr und wandte sich an seine Leute: „Wir fassen zusammen: Dort unten im Geheimtrakt befindet sich mit großer Sicherheit eine Person, welche in Kürze ersticken wird, wenn wir sie nicht vorher befreien können.“ Er fragte noch einmal ins Funkgerät: „Wann erfolgt denn die Flutung? Wie viel Zeit haben wir noch?“
„Ich muss mal nachschauen“, sagte Brathering. Fishman hörte Papier rascheln und dann die Antwort: „Sechs Stunden nach Alarmbeginn.“
Fishman wandte sich wieder an seine Leute. „Wir haben noch rund fünfeinhalb Stunden Zeit, die Tür zu öffnen. Hat jemand einen Vorschlag?“
„Dynamit!“, schlug einer der Männer vor.
„Das ist nicht lustig!“, rügte Fishman. „Da fliegt das ganze Gebäude mit in die Luft.“
„Und zum Schluss bleibt die Tür alleine stehen“, schob ein anderer Witzbold hinterher.“
Fishman ging nicht darauf ein. „Wir brauchen schweres Gerät: einen Presslufthammer oder so was.“
„Oder eine Sauerstofflanze. Die schneidet sich auch durch dicken Stahl“, kam ein weiterer Vorschlag.
„Wir gehen zweigleisig vor und versuchen, durch die Wand zu gehen und gleichzeitig, die Tür zu durchdringen“, entschied der Einsatzleiter. Welche Kräfte stehen uns zur Verfügung?“
„Nur die Technische Einheit, doch können wir die nicht in fünf Stunden herbeischaffen. Und etwas Zeit zum Arbeiten brauchen die auch noch!“
„Die Werft!“, meinte ein Sergeant. „Die könnte in einer Stunde hier sein.“
„Das ist der bisher einzige vernünftige Vorschlag“, lobte Fishman und gab den entsprechenden Befehl an die Zentrale.
Kurze Zeit danach waren die Werftleute schon unterwegs. Es ging um Leben und Tod. Niemand achtete gerade auf die Tür im Keller, die sich plötzlich öffnete. Der Olm blinzelte etwas irritiert in das helle Scheinwerferlicht und schloss gewissenhaft die Tür wieder von außen ab. „Was ist denn los?“, sprach er einen vorbeihastenden Kollegen an.
„Alarm!“, rief dieser zurück. „Da droht einer zu ersticken!“
„Wo denn?“, rief ihm Olmenburg hinterher.
„Ich hab keine Zeit!“, rief der Eilende zurück. „Jede Minute zählt!“
„Das will ich nicht verpassen“, dachte sich der Olm und setzte sich in der Eingangshalle auf die Marmorbank neben dem großen Portal. Seine Aktentasche stellte er neben sich und streichelte gedankenvoll die Sektflasche, die jetzt neben der Thermoskanne steckte. Sein Geheimnis konnte noch etwas warten.
Bereits eine halbe Stunde später rückte ein Arbeitstrupp mit einem großen Presslufthammer an und brachte ihn an der Wand neben der Tür in Stellung. Olmenburg war etwas verwirrt. Wollten die etwa „sein“ Geheimarchiv anbohren?
Als dann einige andere Leute auch noch der Tür mit der Sauerstofflanze zu Leibe gingen, stand er langsam auf und versuchte, sich bei dem infernalischen Lärm von Presslufthammer und zischender Feuerlanze bemerkbar zu machen. Mit der linken Hand die Aktentasche umklammernd und dem rechten Arm in der Luft herumfuchtelnd, drängte er sich durch die gaffende Menschenmenge hindurch in Richtung Kellertreppe, wurde aber schnell aufgehalten.
„Halt! Hier ist alles abgesperrt! Gehen Sie zurück!“, forderte ihn ein Corporal auf.
„Was wollen Sie denn da drin?“, fragte der Olm verzweifelt.
„Das geht Sie gar nichts an! Machen Sie, dass Sie wegkommen!“
Olmenburg ließ sich zurückdrängen und verlangte nach einem Offizier.
„Mann, verstehen Sie nicht?“, herrschte Major Fishman ihn an. „Wir haben jetzt keine Zeit für Sie.“ Er zeigte auf die Betonmauer, an der bereits der Presslufthammer herumknabberte. „Da drinnen sitzt ein Mann, der in weniger als drei Stunden tot ist, wenn wir ihn nicht herausholen.“
„Dann schließen Sie doch einfach auf!“, meinte der Olm und zog den unförmigen altmodischen Schlüssel aus der Tasche.
Fishman fielen fast die Augen aus dem Kopf. „Wo haben Sie denn den her?“, herrschte er den Olm an.
„Den habe ich ordnungsgemäß empfangen und gehütet wie meinen Augapfel.“
„Augapfel?“ Fishman lief feuerrot an. „Wer sind sie überhaupt?“
„Ich bin Sir Matthew Olmenburg, Verwalter des Geheimarchivs der Admiralität. Aber ich kann Ihnen gleich sagen: Da unten gibt es niemanden.“
„Wie heißen Sie?“, vergewisserte sich Fishman noch einmal. „Olmenburg? Wir suchen Sie die ganze Zeit.“
„Ich saß dort drüben auf der Bank“, sagte Olmenburg bescheiden. „Niemand wollte mir sagen, was hier los ist.“
„Einsatz abbrechen und Alarm beenden!“, befahl Fishman in die Runde, und zu Olmenburg gewandt: „Kommen Sie mit. Wir haben noch ein Wörtchen zu reden!“
In der nächsten halben Stunde klärte sich in kleiner Runde der beteiligten Offiziere endlich alles auf. Als Fishman auch noch erfuhr, dass Olmenburg schon seit zwei Jahren außer Dienst war und nur noch aus purer Gewohnheit täglich die geheimen Mauern aufsuchte, nahm er unwillkürlich Haltung ein. Das war wahres Pflichtgefühl für den Dienst am Vaterland. Volle Hochachtung!
„Und Sie sind sicher, dass es da unten nichts mehr gibt? Weder Menschen noch Akten?“
„So ist es!“, bestätigte Olmenburg. „Ich habe gerade alles aufgearbeitet.“
„Dann gibt es auch keinen Grund mehr, weiterzumachen. … Sir Matthew Olmenburg, hiermit entbinde ich sie von allen Ämtern und entlasse Sie im Namen des ehemaligen Königs endgültig aus dem Dienst der britischen Admiralität!“
Die anderen Offiziere konnten sich ein heimliches Lächeln kaum verkneifen, doch der Olm schien noch nicht zufrieden zu sein.
„Abtreten!“, befahl Fishman.
„Nein!“, widersprach der Olm. „Ich bitte um den Schlüssel! Ich habe ihn persönlich gegen Unterschrift in Empfang genommen und werde ihn auch persönlich wieder abgeben.“
Dafür hatte Fishman Verständnis, und so kam es, dass eine kleine Karawane von acht Offizieren ihm durch die Gänge bis zur Schlüsselzentrale folgte. Der diensthabende Schlüsselverwalter salutierte ehrfurchtsvoll vor diesem pflichtgetreuen Mann, der anschließend von einer immer größer werdenden Kollegenschar bis zum Ausgang begleitet wurde. Man würde ihn vermissen, den unscheinbaren Mann, der sie täglich gegrüßt, doch von dem niemand wusste, wo er eigentlich gearbeitet hatte. Nun wusste man es. Er würde als „der Olm“ in die Geschichte dieses altehrwürdigen Hauses eingehen.
Wir haben gerade ein Schiff versenkt
Zu Hause stellte Olmenburg die Aktentasche auf seinen kleinen Schreibtisch, holte die Thermoskanne heraus und brachte sie seiner Wirtin. „Ab morgen brauchen Sie mir nichts mehr einzupacken. Ich muss nicht mehr ins Amt“, sagte er. „Ansonsten wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir weiterhin das Frühstück machen.“
Frau Pennysucker erschrak. „Mein Gott, hat man sie entlassen?“
„Schon vor zwei Jahren“, bestätigte ihr Mieter, „aber ich bin trotzdem hingegangen.“
Das verstand Pennysucker schon gar nicht, doch sie sagte nichts. Hauptsache, die Miete wurde gezahlt.
In seinem Zimmer breitete Olmenburg auf dem Tisch eine Zeitung aus und holte die Sektflasche aus der Tasche. Nun stand sie vor ihm mit all ihren Geheimnissen. Ein Glück, dass niemand in seine Aktentasche geschaut hatte. Er hatte alle Zeit der Welt, das letzte Geheimnis des Geheimarchivs zu lösen.
Zunächst betrachtete er die Flasche selbst. Sie sah wie eine ganz normale Sektflasche aus, war aber ziemlich verschmutzt. Olm betrachtete sie genauer mit einem Vergrößerungsglas. Ihm fiel ein Glasrelief mit der Jahreszahl 18*26 zwischen einem fünfzackigen Stern auf fünf nach unten strebenden Linien auf. Das sah aus wie der Stern von Bethlehem oder eine Silvesterrakete. Die Jahreszahl war interessant. Sollte diese das Alter der Flasche darstellen?
Der Koogl Analysator würde mehr über sie herausbringen.
Der Laserscanner benötigte ganze 5 Sekunden und eine ganze Umdrehung der Flasche um ihre Längsachse, dann kam schon das Ergebnis:
Messung infolge starker Verschmutzungen durch Fremdmaterial ungenau. Vorläufige Analyse: Sektflasche der Sektkellerei Kessler in Esslingen, Deutschland, mundgeblasen, mit Anhaftungen von …
Es folgte eine lange Liste von verschiedenen Algen, Strukturen aus Kieselsäuren, Kristallen und Insektenteilen.
Zusammenfassung: Nach den bisher ausgewerteten anhaftenden Spuren stammt die Flasche aus den ersten 14 Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie wurde zunächst geöffnet und geleert, danach erneut verkorkt und in das Wasser eines verschmutzten Hafenbeckens verbracht. Weitere Spuren, insbesondere mehrere Kratzer am Hals und eine winzigkleine Absplitterung am Boden lassen vermuten, dass die Flasche längere Zeit in Gletschereis eingefroren war.
Eine genauere Bestimmung der Glasbläserei und der Sektkellerei könnte durch eine Hohlraumanalyse herbeigeführt werden.
Olmenburg staunte. Das deutete doch stark auf eine Flaschenpost hin, was er ohnehin schon vermutet hatte.
Auch die Hohlraumanalyse war schnell erledigt und brachte weitere Ergebnisse zutage. Zunächst überflog Olm die technischen Daten von Länge, Breite und Höhe. Das war weniger interessant, die Aussage über die Wandstärke schon eher. Seitenweise folgten weiter Einzelaussagen. Die meisten lasen sich wie eine Liste der Teilnehmer einer Insektenvollversammlung, die sich alle im Laufe der Zeit in der Flasche getroffen hatten. Igittigitt!
Er scrollte schnell zur Zusammenfassung an das Ende der Analyse. Dort fand er das, was er suchte:
Die Flasche wurde 1909 in der Schwarzwälder Glashütte Buhlbach in Baiersbronn mundgeblasen. Dies ergibt sich aus der Form und den Glasbestandteilen. Das Glasrelief zeigt das Gründungsjahr 1826 der Sektkellerei Kessler mit dem „Großen Kometen“. Dieser Komet steht für den Jahrhundertwein von 1811, an dessen Erzeugung der Firmengründer in seinem früheren Champagnerhaus in Reims maßgeblich beteiligt war. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts tauchte dieser Komet auf zahlreichen Flaschen und Etiketten der Firma Kessler auf. Der Firmengründer Christian Georg von Kessler verstarb im Jahre 1842.
Der so genannte „Große Komet“ (Komet Flaugergues) wurde 1811 von Honoré Flaugergues zuerst entdeckt und war so hell, dass er mit bloßem Auge gut erkennbar war. In diesem Jahr gelang den Winzern in Europa ein Jahrhundertwein, was man mit dem Einfluss des Kometen erklärte. Der Wein wurde allgemein als „Kometenwein“ bezeichnet.
Die analysierte Flasche gehört zu einer Serie von nur 250 Flaschen und wurde für die Sektkellerei Kessler in Verbindung mit der Werbeaktion „Kessler Sekt - Der siegende Dreadnought“ hergestellt.
Als „Dreadnut“(frei übersetzt: Fürchtenichts) bezeichnete man in Großbritannien ein Einkaliberschlachtschiff (Linienschiff). Dieser Begriff wurde später auch in anderen Ländern, wie auch von der Kaiserlichen Marine übernommen.
Der Analysator wies ferner auf ein Werbeplakat von 1910 hin. Darauf war ein Kriegsschiff mit zwei Schornsteinen, drei Masten und vielen Kanonen abgebildet. Den Schiffsrumpf bildete eine Kessler Sektflasche. Die Grafik war von dem Simplizissimus-Zeichner Th. Th. Heine (1867-1948) gefertigt und sollte eine Anspielung auf die 1902 eingeführte Sektsteuer zur Finanzierung der Flottenaufrüstung des Deutschen Reiches sein. Im oberen Bildbereich stand der Schriftzug „Kessler Sekt – Der siegenden Dreadnought“. Das Impressum unter dem Plakat verzeichnete: G. C. Kessler & Co., Kgl. Hoflieferant, Esslingen. Aelteste deutsche Sektkellerei. Gegründet 1826.
Olmenburg starrte nachdenklich auf den Monitor mit der Analyse. Seine Vermutung hatte sich bestätigt. Es war tatsächlich eine Flaschenpost aus der Zeit um 1910. Die Flasche stammte eindeutig aus einer Produktion von 1909, die ausschließlich an die Kaiserliche Marine für einen Empfang auf dem Panzerkreuzer SMS Blücher, anlässlich der Ernennung des Admirals Alfred von Tirpitz zum Großadmiral ausgeliefert wurde. Das deckte sich mit dem beigefügten Briefbogen. Doch weshalb, zum Teufel, hatte man die Flaschenpost ins Meer geworfen? Das konnte vielleicht die Geheimnachricht aufklären.
Die Handschrift auf dem Blatt bestand aus merkwürdig kantigen, überwiegend spitz zulaufenden Schriftzeichen. Olm ließ auch dieses Blatt durch den Scanner laufen. Vielleicht gab es ja eine Dechriffierung dafür.
Die Antwort war viel einfacher. Bei der Handschrift handelte es sich um die deutsche Kurrentschrift, welche um 1911 durch die Sütterlinschrift abgelöst wurde. Der Text lautete:
Das ist eine wichtige Flaschenpost.
Wir sind hier auf dem Panzerkreuzer SMS Blücher zusammen mit Kaiser Wilhelm dem Zweiten und Leutnant zur See Hellmuth von Ruckteschell. Wir haben gerade ein Schiff versenkt. Das hat Spaß gemacht. Bitte schicken Sie diese Nachricht an Wilhelmine Heldenreich, Dorpamarsch im Deutschen Reich. Unser Vater ist gerade bei dem großen Admiral Tirpitz und lässt auch grüßen.
Viele Grüße von Emma und Berta.
Der Text war eindeutig eine verschlüsselte Nachricht. Kein Wunder, dass Churchill darin den Beweis für ein Kriegsverbrechen der Deutschen Marine vermutete. Olmenburg musste die Zusammenhänge nur noch klären. Wenn die Titanic tatsächlich von der Blücher versenkt worden war, dann war das eine Sensation. Alles deutete darauf hin. Die Zeit stimmte. Die Flasche befand sich zum Zeitpunkt des Untergangs mit großer Wahrscheinlichkeit im Meer.
Doch wie kam sie in das Geheimarchiv der Britischen Admiralität? Warum wurde sie überhaupt mit der chiffierten Botschaft ins Meer geworfen?
Das waren alles Fragen, die der Olm noch klären musste.
Die Flaschenpost
Es gab mehrere Ansatzpunkte in der Nachricht. Das waren zunächst die genannten Personen:
Kaiser Wilhelm II, den gab es ja wirklich. Doch war er beim Untergang der Titanic in der Nähe? Kaum vorstellbar. Das hätten die Geschichtsschreiber erwähnt.
Der „große Admiral Tirpitz“. Olmenburg kooglete: Tirpitz wurde am 27. Januar 1911 zum Großadmiral ernannt. Er könnte also mit dem „großen Admiral“ gemeint sein.
„Leutnant zur See Hellmuth von Ruckteschell“. Auch diesen fand der Olm beim Kooglen. Doch welche Rolle spielte er bei der Flaschenpost. Hatte er den Schuss auf die Titanic abgegeben?
„Emma und Berta“, die Unterzeichner der Flaschenpost. Das waren vermutlich Tarnnamen, denn Frauen an Bord eines Kriegsschiffes erschienen unmöglich. Hier schien also der entscheidende Ansatz zu sein, ebenso wie der anonyme „Vater“, der sich gerade beim Admiral befand.
Adressiert war die Nachricht an „Wilhelmine Heldenreich in Dorpamarsch“. Das war natürlich auch Unsinn, denn niemand konnte eine Flaschenpost so genau adressieren.
Es blieb geheimnisvoll – vor allem, wie die Flaschenpost ins Geheimarchiv der Admiralität gelangt war.
Am nächsten Morgen suchte er das Nationalarchiv auf, wo man ihn erfreut begrüßte. Die meisten Archivare kannte er seit Jahren, und sie waren ihm bei seiner Suche in den Titanic-Dokumenten behilflich. Wonach Olmenburg suchte, wusste er selbst nicht so genau. Es musste etwas sein, das auch Churchill aufgefallen war.
Doch dann bekam er plötzlich eine Liste in die Hände, welche Kapitän Rostron von der „Carpathia“ nach dem Untergang der Titanic an die Britische Admiralität geschickt hatte. Es war eine Aufstellung verschiedener Gegenstände und Dokumente, die bei der Rettung sichergestellt worden waren.
Unter anderem war eine Flaschenpost aufgeführt, mit einer Nachricht vom Panzerkreuzer SMS Blücher, die Rostron nicht deuten konnte. In einer Fußnote hatte er der Admiralität vorgeschlagen, eine mögliche Verstrickung der SMS Blücher mit dem Untergang der Titanic zu prüfen.
Jemand hatte handschriftlich daruntergeschrieben:
Unsinn! S.M.S Blücher war zum Zeitpunkt des Untergangs als Ausbildungsschiff für Marineinfanteristen in der Ostsee eingesetzt.
Die Unterschrift war nicht zuzuordnen.
So war die Liste ohne weitere Beachtung zu den Akten gelegt worden, sie bewies aber auch, dass Churchills Behauptung falsch gesen war.
Olmenburg kooglete erneut und stieß auf eine weitere geheimnisvolle Spur. In Deutschland gab es tatsächlich ein Dorf namens „Dorpamarsch“. Es war berühmt durch den von Emma Heldenreich gegründeten und nach ihr benannten „Tante-Emma-Laden“, der inzwischen zum Weltkulturerbe ernannt worden war. Aus dem Lebenslauf der Emma erfuhr er, dass ihre Eltern „August und Wilhelmine Heldenreich“ hießen und Emma noch zwei Schwestern mit den Namen Berta und Dora hatte. Emma und Berta waren zum Zeitpunkt des Untergangs der Titanic 12 und 6 Jahre alt, während Dora erst zwei Jahre später zur Welt kam.
Als Olmenburg auch noch las, dass August Heldenreich Kaiserlicher Hoflieferant in Marineangelegenheiten war, hielt er das Geheimnis der Flaschenpost für gelöst: Es gab gar keine geheime Nachricht! Vielmehr hatten die Mädchen bei einem Besuch auf dem Schiff die Flasche ins Meer geworfen. Das war wahrscheinlich während des Empfangs anlässlich der Ernennung von Tirpitz zum Großadmiral in Wilhelmshaven gewesen.
Irgendwo und irgendwann hatte jemand die Flasche aus dem Meer gefischt und an die Britische Admiraltät geschickt, wo Churchill sie als Beweis für ein Kriegsverbrechen der Deutschen angesehen hatte.
Es musste aber noch geklärt werden, wie die Flasche mit der Nachricht zu der Britischen Admiralität gelangt war. Sonst hätte sich der damalige Lordadmiral Sir Winston Churchill wohl kaum darum gekümmert.
Alles Unsinn also! Es gab kein Kriegsverbrechen! Es gab nur einen harmlosen Mädchenspaß!
Und nun hatte Sir Matthew Olmenburg ebenfalls seinen Spaß damit. Immerhin war die Flaschenpost inzwischen 138 Jahre alt. Ob man sie noch zustellen konnte?
Der Olm schaute ins „International Adress Book“ (IAB) und fand sehr schnell die Ortschaft Dorpamarsch, aber keine Eintragungen auf den Namen Heldenreich. Natürlich! Die Personen waren ja schon lange tot. Aber er hatte auf noch lebende Nachkommen gehofft. Die gab es nicht – nur den „Tante-Emma-Laden“ in Dorpamarsch.
Kurzerhand verpackte Olmenburg die Flasche samt Inhalt sorgfältig und schickte sie an den Tante-Emma-Laden. Irgendjemand würde sich schon melden.