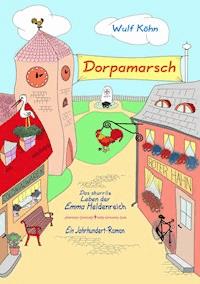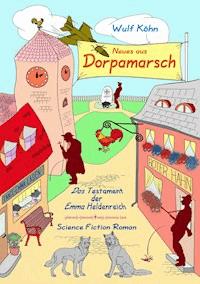
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dorpamarsch
- Sprache: Deutsch
Der kleine Ort "Dorpamarsch" irgendwo im Norden Deutschlands war so unbedeutend, dass seine Einwohner ihn manchmal als "Dorp am Arsch" bezeichneten. Er kam jedoch durch zwei Besonderheiten zu einer gewissen Berühmtheit: Die eine war Emma Heldenreich, die älteste lebende Frau Deutschlands, die im Alter von 114 Jahren starb und deren Grabstein man seit 2014 hier besichtigen kann, die andere war der erste "Tante-Emma-Laden" Deutschlands, der seit 1971 als Weltkulturerbe galt. In Dorpamarsch hatte Emma sich mit ihrem Dorfladen erfolgreich gegen die Übermacht der großen Supermarktketten gestellt und damit das Modell der Tante-Emma-Läden geprägt. Touristen aus aller Welt kamen inzwischen, um diesen Laden – und damit auch Dorpamarsch zu besuchen. Vielleicht wäre nach dem Tode Emmas auch Dorpamarsch wieder in die Bedeutungslosigkeit zurückgefallen, wenn sie nicht in ihrem Testament vorgesorgt hätte. Sie vererbte ihr halbes Vermögen Raupe, ihrem Lebensretter und Bordingenieur des Seniorenschiffes "Welt & Mehr", zum Erwerb und Betrieb eines Tante-Emma-Ladens. So kam dieser mit seiner Frau Rieke zu dem Laden in Dorpamarsch. Doch selbst Emma Heldenreich hätte mit ihrer Voraussicht niemals ahnen können, was damit auf Raupe zukam. Bald passierten geheimnisvolle Dinge, die sich nicht erklären ließen. Während der Autor im ersten Band "Dorpamarsch – Das skurrile Leben der Emma Heldenreich" die Verknüpfung Emmas mit dem gesamten 20. Jahrhundert betrachten konnte, wagte er mit seinem zweiten Band "Neues aus Dorpamarsch – Das Testament der Emma Heldenreich" einen Blick in die Zukunft des 21. Jahrhunderts. Der zweite Band driftet damit eindeutig in Richtung Science Fiction. Beide Bände sind jedoch durch die Handlung so stark verzahnt, dass es sich empfiehlt, auch beide zu lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wulf Köhn
Neues aus Dorpamarsch
Das Testament der Emma Heldenreich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
2015 - Rückblick
Seniorenschiff „Welt & Mehr“
Dorpamarsch
2016 - Das Attentat
Das merkwürdige Grab
Ein Erbe mit Folgen
Schwarz und ohne Zucker
Die geheimnisvollen Pläne
2017 - Rieke
Schwarzmarkt – Made im Gewölbe
2018 - Duell der Behörden
2019 - Der Prototyp
Wolfs Revier
2021 - Mensch oder Maschine
Rieke und der alte Mann
Schatzsuche
2022 - Das Wunder von Dorpamarsch
Der heilige Friedrich
2023 - Unheimliche Begegnung der gefährlichen Art
Dorpamarsch und die Sahara
Der Herr mit der Aktentasche
Der Taucher
Das Geheimnis der Metallkassette
Die Suche im Zeitungsarchiv
Ein Gruß aus dem Jenseits
2024 - Gasthaus zur Drohne
Es werde Licht
Dobbermann kennt sich mit Keilschrift aus
2025 - Der Wolfspelz
„Männerkram“
Der Blubb
Colossus geht auf’s Ganze
Das Patent
Der Erlkönig
Es raschelt in der Kiste
Raupes Traum
2026 - Colossus wandelt sich
Eine unglaubliche Entdeckung
Auf der Suche nach den Wurzeln
Fritz
2035 - Gedanken auf dem Weg nach Stockholm
Sternenlicht
Selbstversuch
Raupes Entscheidung
Die Planung
2050 - Das Dorf feiert
Das Ende
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Vorwort
Das Heute ist das Gestern von morgen.
Doch wer weiß das schon so genau?
Wulf Köhn
Eigentlich müsste es „Zwischenwort“ heißen, denn es steht zwischen dem ersten Band mit dem Titel „Das skurrile Leben der Emma Heldenreich“ und dem hier vorliegenden zweiten Band „Das Testament der Emma Heldenreich“. Es stellt sozusagen eine Verbindung her, denn es empfiehlt sich, den ersten Band gelesen zu haben, um den zweiten verstehen zu können. Genau genommen, bilden beide Bände eine Einheit. Einige Geschehnisse aus Emmas Leben bekommen erst nach ihren Tod einen Sinn, andere in der Zukunft greifen auf ihr Leben zurück, also auf die Vergangenheit.
Natürlich kann man auch nur den zweiten Band lesen. Dann wird man einiges aber nicht verstehen, weil der Wissensvorsprung aus dem ersten Band fehlt. Es hat auch keinen Sinn, den zweiten vor dem ersten Teil zu lesen. Dann geht die Spannung aus dem ersten Teil verloren. Wer will das schon? Man kann es drehen und wenden wie man will, es kommt immer aufs Gleiche heraus: beide Bände oder nur den ersten!
Falls euch jemand den zweiten Band geschenkt hat, fragt bescheiden nach dem ersten. Ich bin sicher, dann wird auch dieser bald dazu geschenkt werden. Wenn nicht, müsst ihr ihn eben selber besorgen.
Noch eine Anmerkung: Alle Personen und Handlungen des Romans sind frei erfunden, auch wenn sie zum Teil an tatsächliche Ereignisse anknüpfen und sich auf reale Personen des Zeitgeschehens beziehen. Beim ersten Band konnte ich da beliebig aus dem Vollen schöpfen, denn das 20. Jahrhundert lag ja schon hinter mir. Ich wusste also, was so alles in der Weltgeschichte passiert war.
Der zweite Band beginnt aber im 21. Jahrhundert, also in der Zukunft. Das ist ungleich schwerer zu bewältigen als die Vergangenheit. Schon beim Schreiben merkte ich, dass die Zukunft manchmal schneller war, als ich schreiben konnte.
Am Ende des Jahrhunderts können wir ja dann mal gemeinsam prüfen, ob meine Zukunftsfantasien eingetroffen sind. Bis dahin wünsche ich einfach nur viel Spaß beim Lesen.
Wulf Köhn
August 2016
2015 - Rückblick
In Bremen kehrte der Schiffsarzt Dr. Rasputin auf das Seniorenschiff „Welt & Mehr“ zurück. Er hatte eine wichtige Mission zu erfüllen gehabt, von der jedoch niemand etwas wissen durfte. Das war sein Geheimnis und sollte es auch bleiben.
Die älteste Frau Deutschlands war zu Grabe getragen worden, und Rasputin hatte sie in ihren letzten 24 Lebensjahren begleitet. Daraus war eine tiefe Freundschaft entstanden.
Wenn er jetzt zurückblickte, wusste er allerdings nicht mehr so genau, wann diese Freundschaft begonnen hatte – und vor allem, mit wem. Drei Schwestern, Emma, Berta und Dora, hatten als Kinder einen Bund geschlossen: „Eine für alle – alle für Eine“, frei nach dem Schwur der „Drei Musketiere“ in dem Roman von Alexandre Dumas.
Nach diesem Schwur hatten sie gelebt und waren immer füreinander eingetreten – hatten alle Widrigkeiten des Zwanzigsten Jahrhunderts gemeinsam gemeistert.
Emma Heldenreich war am 1. Januar 1900 in Dorpamarsch zur Welt gekommen, Berta folgte 1906 und Dora 1914. Als Emma am 1. August 2014 starb, galt sie als die älteste Frau Deutschlands, doch nur Rasputin wusste, dass sie in Wirklichkeit schon seit 1990 in einem Schweizer Kloster begraben war.
Damals war ihre Schwester Berta in die Rolle der Verstorbenen geschlüpft, um sich die Rentenzahlungen aus einer Lotterie weiterhin zu sichern. Auch sie starb im Jahre 2000 im Alter von fast 94 Jahren. Da nutzte Dora, die Jüngste und letzte Überlebende der Schwestern die Gunst der Stunde und übernahm ihrerseits die Identität der jetzt angeblich 100-jährigen Emma, um sich die Rentenzahlungen zu erhalten. Sie starb unter dem Namen „Emma Heldenreich“ und war somit vermeintlich die älteste Frau Deutschlands. In Wirklichkeit wurde sie aber „nur“ 100 Jahre alt. Auf diese Weise hatten die beiden Schwestern fast 24 Jahre lang die Rente von Emma kassiert, immerhin fast zehntausend Euro monatlich. Da war ein recht hübsches Vermögen zusammengekommen und Rasputin der Einzige, der den Schwindel durchschaut hatte. Nun war er der Vermögensverwalter.
Emma Heldenreich hatte notariell verfügt, dass die Hälfte ihres Gesamtvermögens an ihren Lebensretter Friedrich Rupp, auf dem Schiff nur „Raupe“ genannt, zur Gründung eines „Tante-Emma-Ladens“, ging. Der Betrieb eines solchen Ladens, wie ihn Emma mit ihren Schwestern jahrzehntelang betrieben hatte, war eine ausdrückliche Bedingung des Testaments. Die andere Hälfte sollte einer noch zu gründenden Stiftung, die sich um in Not geratene Mannschaftsmitglieder des Seniorenschiffes kümmerte, zufließen.
Nun stand Rasputin vor der nicht gerade einfachen Pflicht, den Letzten Willen Emmas zu erfüllen.
Etwas Sorge bereitete ihm, dass die Tatumstände des missglückten Mordanschlags an Emma zwar aufgeklärt waren, doch der Täter weigerte sich nach wie vor, seinen Auftragsgeber zu nennen. Wer steckte dahinter, und welche Gefahr ging weiterhin von ihm aus?
Rasputin nahm seine Pflichten als Testamentsvollstrecker sehr ernst. Da er aber auch nicht auf die Tätigkeit als Schiffsarzt verzichten wollte, richtete er für die Stiftung ein Büro auf der „Welt & Mehr“ ein. Das war auch im Sinne der Reederei, deren Mannschaft ja davon profitieren sollte. Die Stiftung wurde „Emma Heldenreich Stiftung“ genannt und von dem dreiköpfigen Vorstand Rasputin als Vorsitzenden und den Beisitzern Reeder Hansen und Kapitän Harmsen geführt.
Allein konnte der Arzt aber die Mehrfachbelastungen nicht tragen und suchte nach einem geeigneten Geschäftsführer.
Hartmut Kömmel, inzwischen stellv. Direktor der Nordelbischen Lotteriegesellschaft, ärgerte sich immer noch darüber, dass er bezüglich der Rentenzahlungen von Emma Heldenreich ausgetrickst worden war. Er vermutete weiterhin, dass er einem großen Betrug aufgesessen war, was ja zweifellos stimmte, doch es war ihm nicht möglich, das zu beweisen. Jetzt, wo Emma nicht mehr lebte, brauchte die „Nordelbische“ auch nicht weiterzuzahlen, aber Kömmel hoffte, eines Tages beweisen zu können, dass die Renten zu Unrecht gezahlt worden waren. Da Emma tot war, konnte er natürlich die Zahlungen nicht zurückfordern, doch vielleicht das angesammelte Vermögen beanspruchen. Das wäre eine Katastrophe für die Stiftung und ganz besonders für Raupe und seine Frau Rieke. Der Traum vom eigenen Tante-Emma-Laden wäre damit geplatzt.
Nun las Kömmel die Ausschreibung der Stiftung für einen Geschäftsführer. Wenn es ihm gelänge, den Posten zu bekommen, hätte er vollen Einblick in alle Unterlagen und könnte sicherlich auch beliebig an Rasputin vorbei manipulieren.
Seniorenschiff „Welt & Mehr“
Er hatte sich auf die Ausschreibung bei der EHS beworben und von Rasputin einen Vorstellungstermin erhalten. Das klappte erst, als das Schiff gerade wieder in Bremen war.
Drei Bewerber gab es bisher, doch die ersten beiden hatten auf Rasputin keinen sehr zuverlässigen Eindruck gemacht. Pünktlich um 10.00 Uhr betrat Kömmel über die Gangway die „Welt & Mehr“ und fragte bei der Rezeption nach Dr. Rasputin. Die freundliche Rezeptionistin bat ihn, in der Lounge Platz zu nehmen. Kurz darauf erschien Dr. Rasputin persönlich und stellte sich vor. Er wolle den Weg zu seinem Büro ausnutzen, ihm einen kleinen Überblick über das Schiff zu geben. Unterwegs sah der Arzt ihn mehrmals prüfend von der Seite an. „Sie kommen mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal kennengelernt?“, fragte er schließlich.
Kömmel zögerte. Sollte er sich gleich als Vertreter der Lotteriegesellschaft zu erkennen zu geben? Warum nicht? Spätestens beim Vorstellungsgespräch würde er ohnehin damit herausrücken müssen. „Wir haben uns bereits bei der Nordelbischen Lotteriegesellschaft kennengelernt, als Frau Emma Heldenreich ihr Los verlegt hatte. Das ist aber schon 25 Jahre her.“
Rasputin erinnerte sich, doch er kannte natürlich die Beweggründe nicht, die damals zu dem Versuch geführt hatten, Emma ihren Gewinn vorzuenthalten. Der Schuss war ja leider auch nach hinten losgegangen, dachte Kömmel. Nich zuletzt deshalb war er jetzt hier, aber davon durfte Rasputin nichts merken. Dieser schwieg nachdenklich und versuchte, sich die damaligen Ereignisse in Erinnerung zu bringen. Aber eigentlich war alles für Emma gut ausgegangen. Es gab also keinen Grund, Kömmel gegenüber misstrauisch zu sein.
Die Geschäftsstelle der Stiftung an Bord des Schiffes bestand aus zwei nebeneinanderliegenden Büros: eines für den Vorsitzenden Dr. Rasputin, das andere für den zukünftigen Geschäftsführer.
„Das würde Ihr Büro werden“, stellte Rasputin es vor, „vorausgesetzt, wir können uns einigen. Was haben Sie denn für Vorstellungen?“
Ein Steward brachte eine Kanne Kaffee, zwei Gedecke und etwas Gebäck und zog sich dezent wieder zurück. „Das gehört zu den Annehmlichkeiten hier an Bord“, bemerkte Rasputin, „ich genieße es durchaus.“
„Was haben Sie denn für diesen Posten vorgesehen?“, fragte Kömmel zurück. Erst mal hören.
„Nun“, überlegte der Arzt, „das ist eine Stiftung für gemeinnützige Zwecke. Wir müssen die Kosten natürlich niedrig halten. Ich habe sogar an eine ehrenamtliche Tätigkeit gedacht – natürlich mit einer angemessenen Aufwandsentschädigung. Mir liegt vornehmlich an einem Mitarbeiter, dem ich vertrauen kann, … der sich voll und ganz mit der Stiftung identifiziert.“
Kömmel wurde ungeduldig. Er musste den Posten haben, ganz gleich, wie er honoriert wurde. Es würde ohnehin nicht lange dauern, außerdem bekam er ja noch sein Gehalt von der Nordelbischen. „Ich schlage vor, dass ich zunächst mal rein ehrenamtlich arbeite, damit Sie mich besser kennenlernen können. Man soll ja nie die Katze im Sack kaufen. Wenn Sie meinen, ich bin der Richtige, werden wir uns schon über die weiteren Modalitäten einigen.
Rasputin war erfreut. So stellte er sich einen Geschäftsführer vor. Von Anfang an die Initiative übernehmen. Die beiden wurden sich schnell einig. Kömmel würde zunächst für sechs Wochen ohne Bezüge die Geschäftsführung übernehmen und beweisen, was in ihm steckt. Rasputin hatte auch schon den ersten Auftrag für ihn.
„Mein lieber Herr Kömmel“, sagte er, „ich habe noch eine Pflicht zu erfüllen, die zwar nicht mit der Stiftung, dafür aber mit der Erbschaft zusammenhängt.“
Kömmel hörte aufmerksam zu. Jetzt erfuhr er die Einzelheiten des Testaments von Emma Heldenreich. Die Hälfte ihres Vermögens sollten ihr Lebensretter Friedrich Rupp und seine Ehefrau Rieke für den Erwerb und Betrieb eines Tante-Emma-Ladens erhalten. Das war ausdrücklich so festgelegt. Nur für diesen Zweck durfte das Geld angelegt werden, und Rasputin war für die einwandfreie Erfüllung verantwortlich. Selbstverständlich hätte sich Raupe auch allein um den Erwerb eines solchen Ladens kümmern können, doch bisher waren alle seine Bemühungen erfolglos geblieben. Es gab einfach keinen Laden, der auf Dauer den Lebensunterhalt der beiden sichern konnte.
Rasputin bat deshalb Kömmel darum, eine geeignete Immobilie zu finden. Da konnte sich dieser schon mal beweisen.
Kömmel stimmte erfreut zu. Das war seine Chance.
Mit einem ganz besonderen Tante-Emma-Laden wollte er sich sozusagen in die Stiftung „einkaufen“. Ihm schwebte da etwas vor.
Dorpamarsch
Auf den ersten Blick hatte sich Dorpamarsch seit Emmas Geburt vor 115 Jahren kaum verändert. Die Kirche stand immer noch inmitten des Dorfes, doch sie war inzwischen ein Beispiel ökumenischer Zweisamkeit geworden. In ihr waren sowohl die evangelische als auch die katholische Gemeinde untergebracht. Der evangelisch-lutherische Pastor Grummel und der katholische Pfarrer Sixtus verstanden sich prächtig, was besonders am Stammtisch deutlich wurde. Die Gottesdienste waren allerdings immer noch getrennt, außer zu Weihnachten. Da es nur die eine Kirche gab, hatten beide Gemeinden auch nur einen Küster. Er musste aber nicht mehr wöchentlich in den Turm klettern, um die Uhr aufzuziehen. Das geschah jetzt mittels eines Elektromotors, der den schweren Stein wieder nach oben zog, wenn er weit genug unten angekommen war. Zusätzlich kam eine Wartungsfirma, die einmal jährlich den Zustand überprüfte.
Das Gasthaus hieß immer noch „Zum Roten Hahn“ und war Treffpunkt der Freiwilligen Feuerwehr, allerdings wurden bei Ausbruch eines Feuers nicht mehr die Turmglocken geläutet, sondern die Signalempfänger der Feuerwehrmitglieder ausgelöst.
Eine Dorfschule gab es nicht mehr – die Grundschulklassen hatte man in die Kreisstadt Pamphusen verlegt. Die Kinder wurden mit dem Schulbus in die Stadt und zurückgekarrt, obwohl das genau genommen der normale Linienbus war, den man dafür eingesetzt hatte. So profitierten die Erwachsenen auch davon. Ohne diese Schultransporte wäre der Bus auch nicht gefahren, was zum Beispiel in den Schulferien geschah. Dann wurde der Betrieb „mangels Fahrgastaufkommen“ eingestellt.
Den Unterschied zwischen 1900 und heute sah man am besten an den Menschen. Während man sich vor hundert Jahren bei einer Begegnung auf der Straße noch begrüßte und zu einem kleinen Schwätzchen stehen blieb, rannte man heute mit einem Handy am Ohr und leerem Blick aneinander vorbei.
Auch im Roten Hahn machte sich das bemerkbar. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch die Polizeistunde um Mitternacht. Heute verzogen sich die Gäste freiwillig vor Beginn des Abendprogramms, um zu Hause auf den großformatigen Flachbildfernsehschirmen die von Werbung unterbrochenen Wiederholungen alter Sendungen zu sehen.
Die vielen Werbeunterbrechungen boten allerdings die Möglichkeit, den Getränkenachschub zu organisieren. Es bestand durchaus ein Nachholbedarf nach dem Gasthofbesuch, weil dort der Alkoholkonsum aus Sorge um den Führerschein erheblich eingeschränkt war.
Eine Oase der Ruhe, in der die Zeit stehen geblieben schien, gab es aber doch. Das war der ehemalige Tante-Emma-Laden gegenüber dem Roten Hahn, der seit den siebziger Jahren zum Weltkulturerbe gehörte. Seitdem war der jeweilige Besitzer verpflichtet, den Charakter eines „Tante-Emma-Ladens“ zu erhalten. Das hatten zunächst die drei Schwestern getan, danach – mehr oder weniger halbherzig – der neue Besitzer Arno Pototzki, der den Laden mit seinen Verpflichtungen gerne wieder losgeworden wäre. Inzwischen war das Geschäft in die Posuma-Märkte eingegliedert worden, allerdings weiterhin als Tante-Emma-Laden. Wie es die drei Heldenreich-Schwestern schon gehalten hatten, diente der Laden auch heute noch als gemütlicher Treffpunkt zum Klönen, oder „Tratschen“, wie die Männer gerne sagten, denn er wurde hauptsächlich von den Damen besucht. Die Männer gingen lieber in den Roten Hahn. Das Warensortiment war nicht zu vergleichen mit dem eines Supermarktes, aber man bekam alles, was man so an Kleinigkeiten benötigte. Das Wichtigste aber war die Kaffee-Ecke, wo es noch ganz normalen Kaffee gab, aufgebrüht in der Kanne aus selbst gemahlenen Kaffeebohnen, mit Kaffeesatz oder „Sumpf“, wie die Dörfler sagten. Auf Wunsch gab es auch noch einen Schuss „Pamphusener Goldperle“ hinein, doch das war eigentlich verboten. Dafür hatte der Laden keine Ausschankerlaubnis. Aber wen kümmerte es schon?
Zurzeit wurde der Tante-Emma-Laden von der Witwe Helma Schattenbein mit ihrer noch unverheirateten Tochter Luise geführt. Das geschah im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Erhalt des Weltkulturerbes. Als Aufwandsentschädigung gestatteten ihnen die Eigentümer, die Wohnung hinter dem Laden kostenlos zu nutzen.
Für Pototzkis Nachkommen war das Haus nur noch ein Klotz am geschäftlichen Bein. Es brachte keinen Gewinn. Aber darauf baute der Vizedirektor der Nordelbischen Lotteriegesellschaft und designierter Geschäftsführer der Emma Heldenreich Stiftung auf.
Bevor Josef Pototzkis Sekretärin das Telefongespräch durchstellte, teilte sie ihm mit, dass ein gewisser Herr Kömmel von der Nordelbischen Lotteriegesellschaft am Apparat sei.
„Würgen Sie ihn ab!“, antwortete Pototzki und legte wieder auf, weil er das für einen lästigen Werbeversuch der zahlreichen Lotterievermittlungen hielt. Aber gleich darauf stand seine Sekretärin in der Tür und meinte, der Herr ließe sich nicht abwimmeln, er hätte ein sehr persönliches interessantes Angebot.
„Dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie man das macht!“, knurrte Pototzki und nahm den Hörer wieder ab. „Das Gespräch ist hiermit beendet, und wagen Sie es nicht, mich noch einmal zu belästigen!“, schrie er in den Hörer. Doch bevor er wieder auflegte, hörte er gerade noch den Einwand des Anrufers: „Es geht nicht um die Lotterie! Ich möchte den Laden kaufen!“
Pototzki wurde hellhörig. „Was für einen Laden?“, fragte er verblüfft.
Endlich kam Kömmel zu Wort. „Ich bin an dem Tante-Emma-Laden in Dorpamarsch interessiert und habe gehört, er steht zum Verkauf.“
Das stimmte zwar nicht, dachte Pototzki, wollte jetzt aber mehr wissen. „Wie kommen Sie denn darauf?“, fragte er.
„Gerüchte, Gerüchte“, antwortete Kömmel ausweichend. „Ich wollte einfach mal hören, ob das stimmt“.
„Nein, das ist Unsinn“, erwiderte Pototzki, überlegte aber gleichzeitig, ob das eine Gelegenheit wäre, das ganze unter Denkmalschutz stehende Haus mit dem Weltkulturerbe-Laden wieder loszuwerden. Notfalls hätte er ihn sogar verschenkt, wenn er jemanden gefunden hätte, der in alle Auflagen und Verpflichtungen eingetreten wäre.
„Wozu wollen Sie denn den Laden haben?“, fragte er vorsichtig.
„Das kann ich Ihnen noch nicht sagen“, teilte Kömmel mit. „Ich bin nur befugt, für einen Kaufinteressenten erste Gespräche zu führen. Wenn der Laden aber nicht zum Verkauf steht, können wir das Gespräch jetzt wirklich wieder abbrechen“.
„Nein, nein, nicht so schnell!“, warf Pototzki schnell ein. „Die Frage kommt nur etwas überraschend. Wissen Sie, der Laden ist sozusagen ein Erbstück, das unserer Familie sehr viel bedeutet …“, jetzt nur nichts falsch machen, dachte er.
„Wie wäre es denn, wenn ich Sie mal aufsuche“, schlug Kömmel vor. Dann können wir uns in Ruhe besprechen, und Sie haben Zeit, sich das grundsätzlich einmal zu überlegen“.
Damit war Pototzki einverstanden, und man verabredete sich für den nächsten Donnerstag.
Bei diesem Treffen redete Kömmel erst gar nicht um den heißen Brei herum. Er fühlte sich ohnehin in der stärkeren Position, denn es war kein Geheimnis, dass Pototzkis Erben, die Geschwister Josef und Anka, die lästige Immobilie loswerden wollten. Kömmel teilte sein Interesse mit, den Laden samt Haus und allen Verpflichtungen für eine Stiftung zum Erhalt des Tante-Emma-Ladens zu erwerben. Das stimmte in der Form natürlich nicht, denn die Emma Heldenreich Stiftung hatte einen ganz anderen Zweck. Aber das war ohne Belang, da es sich zunächst nur um ein Vorgespräch handelte und die Nordelbische Lotteriegesellschaft die volle Bürgschaft übernehmen würde.
„Das klingt interessant“, überlegte Josef Pototzki.
„Vorausgesetzt, der Preis stimmt“, bremste Kömmel übertriebene Erwartungen. „Was haben Sie sich denn vorgestellt?“
Als Josef einen Preis nannte, klappte Kömmel demonstrativ seinen Aktenkoffer zu und erhob sich zum Gehen. „Das ist doch nicht Ihr Ernst!?“
„Warten Sie doch ab!“, beschwichtigte Pototzki. „Wir können uns doch sicherlich einigen!“
Die „Einigung“ dauerte fast eine ganze Stunde und trieb Pototzki fast Tränen in die Augen, aber dann hatte man sich auf einen Preis geeinigt, der weit unter dem Verkehrswert lag. Und doch hatten beide anschließend das Gefühl, den anderen über den Tisch gezogen zu haben. Man legte die Eckpunkte in einem Vorvertrag nieder und verabschiedete sich in bestem Einvernehmen.
„Ich habe den idealen Tante-Emma-Laden“, meldete sich Kömmel an Bord zurück. Rasputin staunte, vor allem, nachdem er den Preis erfuhr. Das war ja weit weniger als gedacht.
Der Rest war nur noch Formsache. Kömmel war in seinem Element. Das Grundstück mit beiden Gebäuden, das ehemalige Heldenreich-Haus mit Laden und das Hibbel-Haus, wurden mit allen Verpflichtungen des Denkmalschutzes und als Weltkulturerbe übertragen. Witwe Schattenbein und Tochter durften in das Hibbel-Haus umziehen und weiterhin ehrenamtlich im Tante-Emma-Laden tätig sein. Für sie änderte sich wenig, doch Friedrich Rupp und seine Frau Rieke bekamen endlich ihren Tante-Emma-Laden, wie es sich Raupe einmal gewünscht hatte.
Beide ahnten nicht, dass Kömmel, dem sie unendlich dankbar waren, bereits die ersten Vorbereitungen traf, ihnen die Beine wegzuhauen.
2016 - Das Attentat
Den ersten Schritt hatte er geschafft. Er war Geschäftsführer der Stiftung und Rasputin völlig arglos. An einem der nächsten Tage benutzte Kömmel die Abwesenheit Rasputins, um dessen Büro zu durchsuchen. Vielleicht fand er belastendes Material. Schließlich war der Doktor Emmas Vertrauter und Berater gewesen. Im Büro waren sämtliche Behältnisse unverschlossen. Rasputin hatte keinerlei Argwohn ihm gegenüber.
In einem Wandschrank fand Kömmel einen abgeschabten Karton. Möglich, dass es einmal ein Schuhkarton gewesen war. Die waren meist sehr ergiebig, weil viele Menschen dort Krimskrams aller Art aufbewahrten, den sie nicht wegwerfen wollten.
Außer einigen Fotos und einer Vielzahl alter privater Rechnungen und Kaufbelege gab der Karton aber nicht viel her. Die Fotos waren allerdings recht interessant, weil sie Emma und ihre Schwestern zu verschiedenen Gelegenheit zeigten. Meist gemeinsam, später nur noch zu zweit, dann Emma ganz alleine. Das war ganz logisch, denn schließlich hatte sie Berta und Dora um Jahre überlebt.
Doch dann fiel Kömmel etwas auf: Die Jüngste von allen – Dora – hatte immer einen etwas spöttischen Gesichtsausdruck. Ansonsten sahen alle fast gleich aus. Er verglich die Fotos mit den Jahreszahlen. Die drei Schwestern ähnelten sich desto mehr, je älter sie wurden. Die Ähnlichkeit war frappierend. Nur das spöttische Lächeln Doras brannte sich immer stärker in ihr Gesicht ein.
Dann gab es ein Foto, auf dem nur zwei Schwestern zu sehen waren: nach der Aufschrift „Emma und Berta zum 91. Geburtstag 1991“.
Wo aber war Dora? Sie war doch sicherlich auch auf der Feier.
Was jedoch noch merkwürdiger war: Auf diesem Foto zeigte Berta das merkwürdige Lächeln. Das schien aber Dora gewesen zu sein. Die Beschriftung auf der Rückseite entsprach nicht den abgebildeten Personen.
Kömmel begann, innerlich zu triumphieren. Das passte genau zu seiner Theorie. Emma lebte zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr und hätte gar keine Rente mehr beziehen können. Die weiteren Fotos bestätigten seine Vermutung. Zum Schluss war nur noch Dora abgebildet. Sie hatte die Lotteriegesellschaft hereingelegt und um Millionen betrogen. Aber wie sollte er das beweisen? Dora galt seit 2000 als verschollen. Wenn sie jedoch bis zu 2014 unter der Identität Emmas weitergelebt hatte, welche der Schwestern war dann verschwunden, und wo war ihr Leichnam abgeblieben?
An einem der letzten Fotos, das angeblich Emma kurz vor ihrem Tode zeigte, war mit einer Büroklammer eine Rechnung aus der Schweiz abgebildet – für ein Holzkreuz mit der Aufschrift „Dora Heldenreich – 1900“. Das wurde immer seltsamer. 1900 war das Geburtsjahr Emma Heldenreichs. Dora Heldenreich kam erst 1914 auf die Welt. Kömmel steckte das Foto samt Rechnung ein. Wer weiß, ob er beides nicht noch gebrauchen konnte.
Ihm wurde plötzlich bewusst, dass es ihm vermutlich nie gelingen würde, gegen den Willen Rasputins das Verbrechen aufzuklären. Da half nur eins: Er musste ihn so schnell wie möglich loswerden. Das schien unproblematisch zu sein, wenn man das Alter des Arztes bedachte. Da konnte schon mal ein Unfall passieren. Doch Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht. Das war dann der letzte Schritt.
Aber Rasputins Tod nutzte ihm nur, wenn er anschließend die Geschäftsführung behalten konnte.
Er bereitete ein Schreiben vor, in dem ihm Rasputin Generalvollmacht über alle Geschäfte der Stiftung erteilte, und besprach dieses mit ihm. Nachdem sich Rasputin einverstanden erklärt hatte, formulierte Kömmel das Schreiben neu und Rasputin unterzeichnete es ohne weitere Sichtung. Er unterschrieb damit sowohl die Generalvollmacht als auch eine Verfügung, in der er Kömmel als seinen Nachfolger dem Vorstand vorschlug. Das war’s! Jetzt konnte Rasputin ausgeschaltet werden.
Sein Plan war recht einfach, aber wirkungsvoll.
Die beiden Büros lagen nebeneinander und waren nur über den Gang verbunden. Wollte einer den anderen aufsuchen, musste er den Gang benutzen.
Beide Kabinen hatten einen in die Bordwand eingelassenen kleinen Balkon – wie übrigens jede andere Kabine an Bord auch. Die Balkons waren nicht miteinander verbunden, damit kein Bewohner dem Nachbarn beim Sonnenbad zusehen konnte. Kömmel hatte aber bemerkt, dass sich ober- und unterhalb der Balkons lange durchgehende Stangen befanden, an denen sich Matrosen und Handwerker bei kleineren Außenbordarbeiten festhalten konnten. Das hatte er schon einige Male beobachtet. Dabei hängte sich der Matrose mit einem Spezialgeschirr in die obere Stange ein und stand auf der unteren. Genau das wollte Kömmel tun, um sich unbemerkt von einem Balkon zum anderen zu hangeln. Er musste sich nur ein Sicherungsgeschirr besorgen.
Dann würde er über den Gang in das Büro Rasputins gehen, den alten Mann irgendwie über die Balkonreling stoßen, die Tür von innen verschließen und sich außen an der Bordwand entlang zu seiner eigenen Kabine hangeln.
Später würde er dann die verschlossene Tür „entdecken“ und einen Offizier benachrichtigen. Man würde das Verschwinden des Arztes feststellen und einen Unfall vermuten, denn Rasputin würde nie wieder auftauchen. Kaum vorstellbar, dass der Balkonsturz von irgendjemandem bemerkt werden würde.
Das Schiff war inzwischen auf dem Weg zu den Azoren. Bei der Durchfahrt durch den Ärmelkanal und in der Biskaya hatten schon die ersten Herbststürme getobt. Das wäre nicht gut gewesen für Kömmels Vorhaben. Jetzt, auf dem offenen Atlantik, wurde es ruhiger. Das Azorenhoch begünstigte die Überfahrt, was die Senioren an Bord durchaus genossen, konnten sie doch täglich noch einige Zeit auf ihren Balkons in der Sonne liegen. Allerdings nur auf der Backbordseite, die nachmittags nach Süden gerichtet war. Leider lagen die Kabinen von Kömmel und Rasputin auch auf dieser Seite. Die Gefahr, bei seinem Mordplan gesehen zu werden, war also relativ hoch. Er musste deshalb eine Zeit abwarten, wo sich möglichst wenige – am besten keiner – der anderen Bewohner auf den Balkons befanden. Das war entweder am Vormittag oder kurz nach Sonnenuntergang.
Kömmel wartete ab. Außerdem hatte er noch kein Sicherungsgeschirr, und das würde er unbedingt brauchen.
An einem Nachmittag spielte ihm wieder einmal der Zufall in die Hände. Der Steward informierte ihn, dass einige Malerarbeiten an der Bordwand erledigt werden müssten, und fragte, ob es möglich wäre, dass sich der Maler von seinem Balkon aus abseilen dürfte. Einen anderen Bewohner hätte man nicht gefragt, da er aber sozusagen zum Personal gehörte …
Kömmel stimmte sofort zu. Was Besseres hätte ihm gar nicht passieren können.
Der Maler – in weißem Overall – erschien kurz darauf mit einem kleinen Rollwagen, den er im Gang stehen ließ. Er entnahm diesem einen breiten Gurt, den er sofort umlegte. Daran war ein Stropp mit zwei Karabinerhaken befestigt. Der obere passte genau um die Haltestange. Der Seemann hängte sich einen Eimer Farbe um die Schulter, betrat den Balkon und sicherte sich mit dem Stropp an der oberen Haltestange. So konnte er auch bei einem Fehltritt nicht abstürzen.
Während er sich langsam an der Bordwand zu der Schadenstelle vorarbeitete, bemerkte Kömmel in dem Rollwagen noch zwei weitere Sicherungsgeschirre. Eines nahm er heraus und versteckte es in seinem Schrank.
Die Malerarbeit nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Kaum eine Viertelstunde später kletterte der Mann auf den Balkon zurück, verstaute seine Gerätschaften wieder im Rollwagen und verschwand. Geschafft! Kömmel hatte seine Sicherungsleine. Damit man sie aber nicht bei ihm entdeckte, versteckte er sie, als Rasputin seine Kabine kurz verlassen hatte, in dessen Schrank unter dem Waschbecken in der Nasszelle. Nun war sie dort, wo er sie später brauchen konnte.
Schon einen Tag später ergab sich eine günstige Gelegenheit. Die Sonne stand bereits recht tief, die Bewohner zogen sich in ihre Kabinen zurück und machten sich fertig für das Abendessen. Da rief Rasputin an und meinte, er benötige seine Hilfe. Kömmel sah seine Zeit für gekommen. Für ihn war das Ganze nichts weiter als eine notwendige „Aktion“. Den Gedanken an skrupellosen Mord schob er weit von sich.
Er nahm seine Schreibmappe, schob die Generalvollmacht hinein und legte einige leere Blätter darauf. Dann eilte er nach nebenan zu Rasputin. Dieser saß an seinem Schreibtisch und hatte den Kopf auf die Schreibtischplatte gelegt, als ob er schliefe. Das sah sehr unnatürlich aus, dachte Kömmel. Außerdem hatte er doch gerade noch angerufen. So schnell konnte er doch nicht eingeschlafen sein. Er räusperte sich, und als sich Rasputin nicht regte, sprach er ihn an: „Herr Dr. Rasputin“, sagte er, „kann ich Ihnen helfen?“
Der Arzt antwortete nicht. Kömmel versuchte, ihm in die Augen zu sehen. Diese waren geschlossen. Er suchte den Puls an den Halsschlagadern und fühlte nichts. Der Doktor war tot – mausetot!
Einen Augenblick war Kömmel erschrocken. Das warf seine ganzen Mordpläne durcheinander. Dr. Rasputin war schon tot! Besser konnte es gar nicht laufen.
Jetzt hieß es aber, Ruhe bewahren. Nur nichts falsch machen! Der Zufall hatte ihm in die Hände gespielt, nun musste er seinen Plan ändern.
Zunächst ging er zur Tür und schloss diese von innen ab. Jetzt hatte er Ruhe zum Überlegen. Sollte er die Leiche trotzdem über Bord werfen? Das ergab jetzt keinen Sinn mehr. Am besten ließ er alles so, wie es war. Man würde den Mann finden und eine natürliche Todesursache feststellen. Kein Verdacht würde auf ihn fallen. Warum auch? Er hatte den Alten ja nun wirklich nicht umgebracht. Aber die Nachfolge musste noch in die Wege geleitet werden. Kömmel zog die Vollmacht aus seiner Briefmappe und legte sie neben dem Toten auf die Schreibtischplatte.
Zur gleichen Zeit hatte sich auch Raupe auf den Weg zu Dr. Rasputin gemacht, um mit ihm einige Einzelheiten bezüglich des Tante-Emma-Ladens zu besprechen. Inzwischen hatte seine Frau den Laden übernommen und nach ihrem Geschmack – unter Beachtung der Auflagen als Weltkulturerbe – eingerichtet. Er klopfte an Rasputins Tür, bekam aber keine Antwort. Die Tür war auch verschlossen, wie Raupe feststellte. Der Arzt schien also nicht anwesend zu sein. Schade! Dabei hatte er sich doch extra angemeldet. Er klopfte noch einmal und rüttelte an der Türklinke, doch von innen kam keine Reaktion. Also würde er warten. Ach, fiel ihm ein, vielleicht konnte ihm ja der Geschäftsführer weiterhelfen. Er klopfe an dessen Tür, bekam aber ebenfalls keine Antwort. Die Tür war jedoch nicht verschlossen, und Raupe steckte seinen Kopf hinein. „Hallo, Herr Kömmel, sind Sie da?“
Keine Antwort. Ein heftiger Windstoß fegte durch die Kabine. Das Fenster zum Balkon stand offen, und draußen entwickelte sich ein kräftiger Wind. Raupe fühlte sich als Schiffsingenieur durchaus auch für solche Kleinigkeiten zuständig, ging zum Fenster, schaute auf den Balkon hinaus und schloss die Tür. Dann verließ er die Kabine wieder und setzte sich im Gang auf einen der dort stehenden Stühle, um auf den Arzt zu warten.
Kömmel war zusammengezuckt, als es an die Kabinentür klopfte. Er verhielt sich abwartend, auch als jemand an der Türklinke rüttelte. Das gefiel ihm gar nicht. Was sollte man von ihm denken, wenn er sich mit dem toten Rasputin einschloss und auf Klopfen nicht reagierte? Das sah verdächtig aus. Jetzt konnte er noch nicht einmal so tun, als hätte er die Leiche gerade erst gefunden. Er durfte die Kabine auch nicht durch die Tür verlassen, weil er nicht wusste, ob jemand draußen wartete.
Was also tun?
Einen Augenblick dachte er daran, den Alten doch noch über die Reling zu wuchten und seinen ursprünglichen Plan auszuführen, doch dann entschied er sich dafür, einfach auf dem geplanten Weg zu flüchten.
Er ging ins Badezimmer, um die Sicherungsleine zu holen, doch diese war verschwunden. Er hatte nämlich beim Verstecken einen kleinen, aber entscheidenden Fehler begangen. Er hatte nicht kontrolliert, ob sich noch genügend Toilettenpapier auf der Rolle befand. Warum hätte er das auch kontrollieren sollen? In diesem Fall wäre es aber wichtig gewesen, denn in dem Schrank unter dem Waschbecken lagerten die Ersatzklopapierrollen.
Als die Putzkolonne am nächsten Morgen routinemäßig auch Rasputins Büro aufsuchte, stellte die Putzfrau fest, dass das Papier auf der Rolle fast aufgebraucht war, und wollte es auswechseln. Im Schrank entdeckte sie das Sicherungsgeschirr und fragte Rasputin, ob er das noch benötigte. Dieser schüttelte nur den Kopf. Wer weiß, wer es dort vergessen hatte. Die Putzfrau gab den Stropp im Lager ab, wo man schnell herausfand, wo er fehlte. Keiner der Malerhandwerker die den Rollwagen in den letzten Tagen benutzt hatten, konnte sich erinnern, es bei dem Arzt vergessen zu haben. So blieb es ein ungeklärtes Geheimnis.
All das wusste Kömmel natürlich nicht, aber das Ergebnis war fatal. Der Sicherungsstropp war verschwunden.
Kömmel trat auf den Balkon und schaute sich die Haltestangen noch einmal an. Das müsste er auch ohne Sicherung schaffen. Vorsichtig kletterte er auf die Reling und von dort auf die untere Haltestange. Viel Platz hatte er nicht mit seinem Fuß. Nur nicht nach unten schauen. Er war fast zwölf Meter über dem Wasser. Mit ausgestrecktem Arm konnte er die obere Haltestange erreichen und sich daran festhalten. Langsam, Schritt für Schritt, bewegte er sich seitwärts, immer mit beiden Händen an der Haltestange. Es war gar nicht so schwierig.
Der Wind hatte zugenommen, und einige Böen drückten ihn immer wieder beiseite. Er schaute nach unten zu den Bugwellen, die sich keilförmig von dem Schiff entfernten. Schließlich erreichte er seinen Balkon und wollte zu diesem hinunterklettern. Es stellte sich heraus, dass es leichter war, nach oben als nach unten zu klettern. Um die Balkonreling zu erfassen, musste er die obere Haltstange loslassen und nach unten umgreifen. In diesem Moment fegte ein weiterer Windstoß heran und erwischte ihn gerade, als er die obere Sicherung verlassen hatte. Für eine Sekunde stand er nur mit einem Fuß auf der Reling … in der nächsten begann er zu fliegen.
„Da schwimmt jemand!“, rief Isolde von Flickenberg erschrocken und zeigte mit ausgestrecktem Finger nach achtern in das strudelnde Heckwasser des Seniorenkreuzfahrtschiffes „Welt & Mehr“. Doch resigniert nahm sie den Arm wieder herunter und sah sich um. Sie stand allein an der Reling. Auch wenn andere in der Nähe gewesen wären, hätte man sie kaum beachtet. Zu dünn und gebrechlich war ihr Stimmchen. Zu oft hatte sie Dinge gesehen, die nur in ihrer Einbildung existierten. Sie glaubte sich ja selbst nicht mehr!
Als Rasputin zu sich kam, war er zunächst völlig desorientiert. Er hob den Kopf und sah sich um. Ach ja, die Kabine! Jetzt setzte die Erinnerung wieder ein. Er hatte gerade einen Herzanfall bekommen und Kömmel angerufen, damit dieser ihm die Herztropfen aus dem Wandschrank geben konnte. Ein Steward wäre nicht schnell genug zur Stelle gewesen. Dann muss er wohl das Bewusstsein verloren haben. Aber warum war Kömmel nicht gekommen?
Rasputin stand auf und versuchte ein paar Schritte. Jetzt schien alles wieder in Ordnung zu sein. Er ging zur Tür und fand diese verschlossen. Von innen! Der Schlüssel steckte noch. Das erklärte natürlich, warum Kömmel nicht hereingekommen war, warf aber eine andere Frage auf. Warum war die Tür verschlossen? Er schloss sie niemals ab, wenn er sich in der Kabine befand. Sollte er so verwirrt gewesen sein?
Auf seinem Schreibtisch bemerkte er das Schreiben mit der Vollmacht. Wie kam die dort hin? Die bewahrte doch Kömmel bei sich auf. Die Vollmacht war ja auf ihn ausgestellt. Gedankenverloren nahm er sie in die Hand und las sie durch. Wollte Kömmel sie noch einmal mit ihm besprechen? Aber was er jetzt las, erstaunte ihn. Das war doch niemals so besprochen worden. Gewiss, seine Unterschrift stand darunter, doch eine solche Empfehlung hätte er nicht gegeben. Da wollte ihm jemand etwas unterschieben.
Jetzt bemerkte Rasputin auch die Schreibmappe, die auf einem Stuhl am Fenster lag. Sie war bis auf ein paar unbeschriebene Blätter leer. Kömmel muss also doch hier gewesen sein.
Aber wie war dieser hereingekommen? Das blieb ein Rätsel.
Es klopfte an der Tür. Rasputin öffnete, und Raupe stand davor. „Ich habe im Gang gewartet und gehört, dass die Tür aufgeschlossen wird“, sagte er bescheiden.
Rasputin bat ihn herein. „Wie lange haben Sie denn vor meiner Tür gewartet?“, wollte er wissen.
Raupe schaute auf die Uhr und antwortete: „Ziemlich genau 26 Minuten. Wir waren um 16.00 Uhr verabredet, und jetzt ist es 16 Uhr 26.“
„Und Sie waren die ganze Zeit vor meiner Tür?“
„Ja, bis auf die Minute, in der ich bei Herrn Kömmel war.“
„Sie waren bei Herrn Kömmel?“, hakte Rasputin nach.
„Ich war zumindest in seiner Kabine, aber er war nicht da. Da habe ich noch das Fenster geschlossen und mich wieder in den Gang gesetzt.“ Ihm kam die ganze Fragerei etwas merkwürdig vor.
„Fenster geschlossen“, murmelte Rasputin vor sich hin und dachte an das Fenster der eigenen Kabine. Das war auch offen, obwohl er sicher war, es nicht geöffnet zu haben. Und auf dem Stuhl neben dem Fenster lag Kömmels Schreibmappe. Ihm kam ein ganz merkwürdiger Verdacht, doch den behielt er zunächst für sich.
„Was kann ich für Sie tun?“, kam er zurück zu Raupe. Das kleine Problem war schnell besprochen und Raupe wollte sich verabschieden, als Rasputin ihn noch zurückhielt. „Lassen Sie bitte Herrn Kömmel ausrufen, ich brauche ihn dringend in meinem Büro“, bat er.
„Mach ich, Doktor!“, nickte Raupe und begab sich zur Rezeption.
Hartmut Kömmel meldete sich nicht und wurde auch bei der eingeleiteten Suchaktion nicht gefunden. Er tauchte nie wieder auf – und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Wortlos zerriss Dr. Rasputin das Schreiben mit seiner Unterschrift, das er niemals in dieser Form unterschrieben hätte.
Jetzt brauchte er einen neuen Geschäftsführer.
Das merkwürdige Grab
Kömmels Verschwinden löste natürlich eine kriminalpolizeiliche Untersuchung aus. Da der Tatort auf einem deutschen Schiff lag, war die Bundespolizei zuständig. Polizeihauptkommissar Onno Nörenberg von der Küstenwache wurde mit der Aufklärung beauftragt. Es schien nur ein Routinefall zu sein. Alle Anzeichen deuteten auf einen Unglücksfall hin, bei dem Kömmel über Bord gefallen war. Bei der Befragung der Passagiere meldete sich die Seniorin Isolde von Flickenberg und erzählte, sie hätte jemanden im Wasser schwimmen gesehen. Sie klang etwas verwirrt, doch die angegebene Uhrzeit passte ziemlich genau mit dem ermittelten Zeitpunkt des Verschwindens überein. Der Verdacht, Kömmel sei über Bord gegangen, wurde damit bestätigt.
Bei der Sichtung von Kömmels Schreibtisch fand der Hauptkommissar jedoch ein Foto und eine Quittung über ein hölzernes Grabkreuz. Das wäre normalerweise nichts Besonderes gewesen, wenn Nörenberg sich nicht an den Namen auf dem Grabkreuz erinnert hätte: „Dora Heldenreich“. Diese Frau war vor einigen Jahren vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen und seitdem verschwunden. Wie kam jedoch eine Rechnung für ihr Grabkreuz in Kömmels Unterlagen?
Nörenberg ließ sich die Ermittlungsakte „Dora Heldenreich“ schicken. Der Fall war unaufgeklärt zu den Akten gelegt worden, da es sich aber um den Verdacht eines Verbrechens im Jahre 2000 handelte, war die Verjährungsfrist von 30 Jahren noch lange nicht abgelaufen. Bei Mord gab es ohnehin keine Verjährung.
Doch lag hier ein Mord oder ein anderes Kapitalverbrechen vor? Das konnte bisher nicht geklärt werden.
Onno beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.
Zunächst gab es nur die Quittung. Sie war im Jahre 2014 in der Schweizer Ortschaft Claro von einem Holzschnitzer ausgestellt worden. Das war gerade erst vor zwei Jahren. Auf der Rechnung stand Dora Heldenreichs Name und die Jahreszahl 1900. Diese Kombination ergab keinen Sinn, denn Doras Schwester Emma wurde 1900 geboren, Dora selbst aber erst 1914. Das Holzkreuz trug also den Namen von Dora mit dem Geburtsjahr von Emma. Was hatte das nur zu bedeuten? Vielleicht war das auch nur eine zufällige Namensgleichheit.
Der Polizeihauptkommissar holte sich die Genehmigung für eine Dienstreise in die Schweiz. Das musste er vor Ort klären.
Claro war ein kleiner Ort im Tessin mit etwa 2.500 Einwohnern und lag an der E35, knapp zehn Kilometer von Bellinzona entfernt. Der Ort war von der Stazione Bellinzona mit der Bahn gut zu erreichen. Am Bahnhof erwartete ihn schon ein Carabiniere, denn die Bremer Staatsanwaltschaft hatte offiziell um Amtshilfe und einen Dolmetscher gebeten. Der Brigadiere Roberto Rocco sprach leidlich deutsch, was wohl an den vielen deutschen Touristen lag, die in langen Kolonnen täglich über den St. Gotthard über die Alpen kamen, und er kannte alles und jeden in Claro. Das war durchaus von Vorteil. Er wusste sofort, von wem die mitgebrachte Rechnung stammte. Es war der Schreiner und Bildhauer Luigi Dolfo, der in Claro praktischerweise sowohl Särge als auch hölzerne Grabkreuze anfertigte.
Sie machten sich sofort auf den Weg. Dolfo war persönlich anwesend, und nach der üblichen wortgewaltigen Begrüßung, von der Nörenberg nur verstand, dass sich die beiden schon lange kannten, zeigte er schließlich die Rechnung, was Rocco mit einem erklärenden Wortschwall begleitete.
Dolfo nickte. Er konnte sich noch gut an den Auftrag erinnern, zumal es einige Probleme gab, dolmetschte Rocco. Er suchte in einem Karton voller Papiere – vermutlich seine Ablage – und fischte einen Auftrag mit einem angehängten Zettel heraus.
Nörenberg bedauerte, das Gespräch nicht selbst führen zu können, jedoch mit Hilfe des Brigadieres ergab sich folgender Ablauf.
Ein Mann, der seinen Namen nicht genannt hatte, war in Dolfos Werkstatt erschienen, um ein Holzkreuz in Auftrag zu geben, das an das Kloster Santa Maria Assunta geliefert werden sollte. Die Daten hatte er auf einen Zettel geschrieben, der jetzt dem Auftrag beilag. Wie Nörenberg sehen konnte, stand dort „Dora Heldenreich – 1900“. Die vorletzte Null war jedoch mehrmals überschrieben. Die Jahreszahl konnte sowohl eine 1900 als auch eine 1990 sein. Das war nicht mehr so genau zu erkennen. Der Schreiner erinnerte sich, dass ihm die weit zurückliegende Jahreszahl 1900, die ursprünglich auf dem Zettel stand, aufgefallen war. Er hatte nochmals nachgefragt, und der Mann hatte gesagt, es müsse 1990 heißen. Nachdem Dolfo die Zahl geändert hatte, lachte der Unbekannte aber und meinte, er soll ruhig 1900 schreiben. Das macht das Ganze noch rätselhafter. Was damit gemeint war, konnte sich Dolfo aber nicht erklären, zumal die Verständigung etwas schwierig war. Jedenfalls hatte er den Auftrag angenommen und der Mann bar bezahlt. Er bekam darüber eine quittierte Rechnung über die Anfertigung eines hölzernen Grabkreuzes mit der Aufschrift „Dora Heldenreich – 1900“.
Der unbekannte Mann musste Kömmel gewesen sein, überlegte Nörenberg. Was hatte es aber mit den Jahreszahlen auf sich?
Der Holzschnitzer erzählte, dass er sich nach dem Weggang des Mannes nicht mehr sicher war, welche Jahreszahl er eigentlich schreiben sollte. Da er weder Namen noch Anschrift des Mannes hatte, konnte er auch nicht mehr nachfragen. Also fuhr er zum Kloster hinauf, um sich dort zu erkundigen. Schwester Barbara wusste angeblich Bescheid.
Die Ordensschwester zeigte ihm ein Grab, das bisher immer als „Emmas Grab“ bezeichnet wurde. Vor Kurzem wäre aber ein Mann gekommen, der meinte, es wäre „Doras Grab“. Das hatte sie zwar nicht verstanden, jedoch nicht nachgefragt.
Für den Schreiner war es aber wichtig, die genaue Jahreszahl zu erfahren. Das Grab existiere seit 1990, erklärte Schwester Barbara. Also hatte er diese Jahreszahl, entgegen den Angaben auf der Rechnung in das Kreuz geschnitzt und es dann an das Kloster geliefert und dort aufgestellt. Für ihn war der Auftrag damit erledigt.
Für Nörenberg begann es aber erst. Die Sache wurde immer verworrener.
Er ließ sich von dem Brigadiere zum Kloster, das auf einem Felsplateau oberhalb der Stadt lag, hinauffahren und fragte nach Schwester Barbara, die ihnen bereitwillig das Grab an der Klostermauer zeigte. Sie bestätigte die Angaben des Schreiners. In dem Grab war im Jahre 1990 eine unbekannte weibliche Person, die im Wald gefunden worden war, beigesetzt worden. Nach den Angaben der inzwischen verstorbenen Schwester Adalgisa wurde es immer „Emmas Grab“ genannt, bis vor zwei Jahren ein Mann erschienen sei, der behauptete, es wäre das Grab von Dora Heldenreich. So stand es auch auf dem Grabkreuz: Dora Heldenreich – 1990.
Doch das warf wieder neue Fragen auf.
Dora Heldenreich lebte nachweislich bis zu ihrem Verschwinden 2000.
Emma Heldenreich lebte bis 2014 und wurde damit zur ältesten Frau Deutschlands.
Ihre Schwester Berta Heldenreich lebte bis 2000. Die Todesumstände von Emma und Berta waren damals geklärt worden. Beide lagen auf den Friedhof von Dorpamarsch. Nur Doras Verschwinden gab noch Rätsel auf. Hier schien also ihr Grab zu sein. Doch dann konnte sie nicht schon 1990 beerdigt worden sein, denn sie verschwand erst 2000. Das wiederum war das Sterbejahr von Berta.
Der Brigadiere wusste schon lange nicht mehr, worum es ging. Er hatte die Übersicht verloren und beschränkte sich inzwischen nur noch auf das Dolmetschen. Doch Nörenberg bekam so langsam eine Ahnung – es war nicht viel mehr als ein Gefühl.
Dora verschwand im gleichen Jahr, in dem Berta starb. Aber wie kam sie in den Wald bei Claro?
Bei der italienischen Carabiniere-Station befand sich noch die Ermittlungsakte von 1990. Rocco übersetzte, dass von der Ordensschwester Adalgisa die Leiche einer unbekannten Frau im Wald zwischen Claro und dem Kloster aufgefunden worden war. Die Obduktion hatte eine natürliche Todesursache durch Herzversagen – vermutlich aufgrund des Alters – ergeben. Ein Fremdverschulden hatte man ausgeschlossen und die Leiche dem Kloster zur Beisetzung überlassen. Lediglich die Identität der Toten konnte nicht geklärt werden. Der Fall war hier abgeschlossen.
Nörenberg hätte den Fall für sich auch gerne abgeschlossen, doch der Todeszeitpunkt der Unbekannten stimmte nicht mit dem Verschwinden Doras überein. Wer lag also in dem Grab, und wo war Dora abgeblieben? Beides war noch immer offen.
Eine dritte Frage war ebenfalls noch ungeklärt. Warum hatte Kömmel dieses Grabkreuz anfertigen lassen? Und noch dazu mit dem Geburtsdatum von Emma, was dann allerdings geändert wurde.
Dreh- und Angelpunkt schien Kömmel zu sein, den man aber nicht mehr befragen konnte. Lebte dieser vielleicht auch noch? Er war ebenfalls verschwunden, galt aber nach den polizeilichen Ermittlungen als tot. Hatte sich Nörenberg da geirrt? Hatte Kömmel alle an der Nase herumgeführt, und wenn ja, welche Vorteile brachte ihm das?
Es wurde immer verworrener, doch hier in Claro ließ sich nicht mehr ermitteln. Der Hauptkommissar beschloss, in Deutschland weiterzumachen und ließ einen mehr als verwirrten Rocco Roberto zurück.
In Bremen begann er, sich mit dem Vorleben Kömmels zu befassen und ermittelte, dass dieser neben der Tätigkeit als Geschäftsführer der EHS auch Vizedirektor bei der Nordelbischen Lotteriegesellschaft gewesen war. Von dieser hatte Emma Heldenreich bis zu ihrem späten Tod eine monatliche Rente von rund 10.000 Euro bezogen. Da gab es möglicherweise einen Zusammenhang. Nörenberg beschaffte sich einen Durchsuchungsbefehl für die Geschäftsräume der Lotteriegesellschaft und beschlagnahmte diverse Unterlagen. Bei der Sichtung wurde die Betrugsabsicht gegenüber Emma Heldenreich offenkundig. Kömmel hatte 1990 versucht, Emma über den Tisch zu ziehen, was jedoch dank der Hilfe ihres Arztes Dr. Rasputin nicht gelungen war. Es gab genügend handschriftliche Aktenvermerke von Kömmel, die das bewiesen.